Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Streit um Sozialleistungen: Wenn Einnahmen aus Drogengeschäften die Berechnung kompliziert machen
- Der Weg durch die Instanzen: Vom Amtsgericht bis zum Oberlandesgericht
- Die Kernfrage: Was genau musste das Oberlandesgericht prüfen?
- Die Entscheidung des Oberlandesgerichts: Zurück auf Anfang
- Die Begründung: Warum das Landgericht falsch rechnete
- Konsequenzen für die Einziehung: Was passiert mit dem Geld?
- Ein wichtiger Hinweis für das neue Verfahren: Die Gesamtstrafe
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Muss ich auch Einnahmen aus illegalen Tätigkeiten melden, wenn ich Sozialleistungen beziehe?
- Welche rechtlichen Folgen drohen, wenn ich meine Einkünfte beim Bezug von Sozialleistungen nicht oder falsch angebe?
- Werden bei der Berechnung von Sozialleistungen auch Ausgaben berücksichtigt, die ich hatte, um Einnahmen – auch aus illegalen Quellen – zu erzielen?
- Wie wird die Höhe des Betrags ermittelt, der bei Sozialleistungsbetrug zurückgefordert oder eingezogen werden kann?
- FAQ-Frage: Was bedeutet es, wenn ich bereits eine Strafe habe und für frühere Taten nun wegen Sozialleistungsbetrugs erneut verurteilt werde?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 1 ORs 51/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht Oldenburg
- Datum: 25.03.2025
- Aktenzeichen: 1 ORs 51/25
- Verfahrensart: Revisionsverfahren
- Rechtsbereiche: Strafrecht, Sozialrecht (SGB II)
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Der Angeklagte, der Revision gegen das Urteil des Landgerichts Aurich eingelegt hat.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Ein Angeklagter wurde wegen Betruges im Zusammenhang mit zu Unrecht bezogenen SGB II-Leistungen verurteilt, da er Einnahmen aus Drogenverkäufen nicht angegeben hatte. Das Landgericht Aurich bestätigte die Verurteilung und ergänzte eine Einziehungsentscheidung. Der Angeklagte legte Revision gegen dieses Urteil ein.
- Kern des Rechtsstreits: Der Kern des Rechtsstreits lag in der Frage, ob das Landgericht Aurich die zu Unrecht bezogenen Leistungen nach SGB II korrekt berechnet hatte, insbesondere unter Berücksichtigung von Aufwendungen aus Einnahmen aus Straftaten. Zudem ging es um die Auswirkungen auf die Einziehungsentscheidung und die Gesamtstrafenbildung mit einer bereits bestehenden Vorverurteilung.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Oberlandesgericht hob das Urteil des Landgerichts Aurich aufgrund der Revision des Angeklagten auf. Die Sache wurde zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine andere kleine Strafkammer des Landgerichts Aurich zurückverwiesen.
- Begründung: Das Gericht begründete die Aufhebung mit einer fehlerhaften Berechnung der anzurechnenden Einnahmen durch das Landgericht. Dieses hatte übersehen, dass bei der Ermittlung des Einkommens aus Straftaten auch notwendige Aufwendungen, wie die Kosten für den Einkauf der Drogen, abzuziehen sind. Da die Einkommensberechnung die Grundlage der Einziehungsentscheidung war, wurde auch diese aufgehoben.
- Folgen: Die rechtliche Folge ist eine erneute Verhandlung vor einer anderen Kammer des Landgerichts Aurich zur Feststellung der fehlenden Angaben. Zudem wies das Gericht darauf hin, dass aufgrund einer früheren, noch nicht vollstreckten Verurteilung nachträglich eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet werden muss.
Der Fall vor Gericht
Streit um Sozialleistungen: Wenn Einnahmen aus Drogengeschäften die Berechnung kompliziert machen
Stellen Sie sich vor, jemand bezieht staatliche Unterstützung, zum Beispiel Arbeitslosengeld II. Gleichzeitig hat diese Person aber noch andere Einnahmen, vielleicht aus einem kleinen Nebenjob. Diese zusätzlichen Einnahmen müssen natürlich bei der Berechnung der Sozialleistungen angegeben werden. Was aber, wenn diese Einnahmen aus illegalen Quellen stammen, wie zum Beispiel Drogenverkäufen? Und was, wenn man beim Erzielen dieser illegalen Einnahmen auch Ausgaben hatte, etwa um die Drogen überhaupt erst einzukaufen? Genau um solche kniffligen Fragen ging es in einem Fall vor dem Oberlandesgericht Oldenburg.
Der Weg durch die Instanzen: Vom Amtsgericht bis zum Oberlandesgericht
Wie kam es überhaupt zu diesem Verfahren vor dem Oberlandesgericht? Alles begann mit einer Verurteilung durch das Amtsgericht Emden.
Die erste Verurteilung und die Berufung
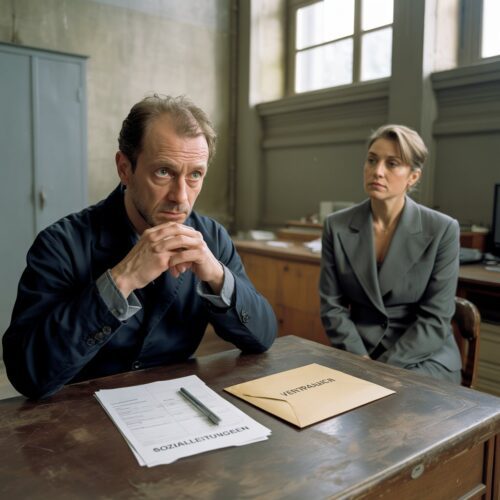
Das Amtsgericht Emden hatte einen Mann, nennen wir ihn Herrn K. (den Angeklagten), am 15. April 2024 wegen Betruges in zwei Fällen verurteilt. Betrug bedeutet, dass jemand einen anderen täuscht, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. In einem der Fälle handelte Herr K. laut Amtsgericht sogar gewerbsmäßig, also mit der Absicht, sich durch wiederholte Taten eine Einnahmequelle von gewisser Dauer und Erheblichkeit zu verschaffen. Zudem wurde ihm vorgeworfen, den Betrug durch Unterlassen begangen zu haben – er hatte also etwas nicht getan, was er hätte tun müssen, nämlich seine Einnahmen dem Jobcenter melden. Das Urteil lautete auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Eine Bewährungsstrafe bedeutet, dass der Verurteilte nicht ins Gefängnis muss, wenn er sich während einer bestimmten Zeit nichts mehr zuschulden kommen lässt. Zusätzlich ordnete das Gericht eine Einziehungsentscheidung an. Das heißt, der Staat wollte den Geldbetrag einziehen, den Herr K. durch den Betrug erlangt hatte.
Gegen dieses Urteil legte Herr K. Berufung ein. Eine Berufung ist ein Rechtsmittel, mit dem ein Urteil einer unteren Instanz (hier das Amtsgericht) von einer höheren Instanz (hier das Landgericht) noch einmal vollständig überprüft werden kann, sowohl was die festgestellten Tatsachen als auch was die rechtliche Bewertung angeht.
Das Urteil des Landgerichts Aurich
Das Landgericht Aurich – genauer gesagt die 2. kleine Strafkammer – befasste sich mit der Berufung. Am 6. November 2024 fällte es sein Urteil: Die Berufung von Herrn K. wurde als unbegründet verworfen. Das bedeutet, das Landgericht bestätigte im Wesentlichen die Entscheidung des Amtsgerichts. Allerdings gab es zwei Änderungen: Die Einziehungsentscheidung wurde um einen Betrag von 3.142,20 Euro ergänzt. Herr K. sollte also noch mehr Geld an den Staat zurückzahlen. Und der Schuldspruch, also die genaue Bezeichnung der Straftat, wurde leicht geändert: Statt Betrug in zwei Fällen, davon einer gewerbsmäßig und durch Unterlassen, hieß es nun nur noch Betrug in zwei Fällen.
Die Einnahmen, deren Nichtangabe zu den Betrugsvorwürfen führte, stammten aus Drogenverkäufen. Das Landgericht stellte fest, dass Herr K. die Betäubungsmittel im relevanten Zeitraum von zwei Dealern auf Kommission gekauft hatte. Auf Kommission kaufen bedeutet, dass er die Drogen nicht sofort bezahlen musste, sondern sie erst verkaufte und dann einen Teil des Erlöses an seine Lieferanten abgab. Die letzte Auszahlung von Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (kurz SGB II – das Gesetz, das die Grundsicherung für Arbeitsuchende regelt, oft auch als „Hartz IV“ bekannt), die aufgrund der Täuschung erfolgte, fand im September 2020 statt.
Die Revision zum Oberlandesgericht Oldenburg
Mit dem Urteil des Landgerichts Aurich war Herr K. immer noch nicht einverstanden. Er legte Revision ein. Die Revision ist ein weiteres Rechtsmittel, unterscheidet sich aber von der Berufung. Bei der Revision prüft das nächsthöhere Gericht (hier das Oberlandesgericht Oldenburg) das Urteil der Vorinstanz nur noch auf Rechtsfehler. Es wird also nicht mehr neu verhandelt, ob die Tatsachen stimmen, sondern nur, ob das Landgericht das Recht richtig angewendet hat. Herr K. begründete seine Revision mit der sogenannten Sachrüge. Damit machte er geltend, dass das Landgericht bei der Anwendung des materiellen Rechts – also der Strafgesetze und der dazugehörigen Bestimmungen – Fehler gemacht habe. Eine Verfahrensrüge, die sich auf Fehler im Ablauf des Gerichtsverfahrens beziehen würde, erhob er nicht.
Erschwerend kam hinzu, dass es zum Zeitpunkt der Entscheidung des Oberlandesgerichts noch eine andere, rechtskräftige Verurteilung gegen Herrn K. gab. Rechtskräftig bedeutet, dass gegen dieses Urteil keine Rechtsmittel mehr möglich sind. Diese Vorverurteilung stammte vom Amtsgericht Emden vom 23. Mai 2023 und war noch nicht vollstreckt, also die Strafe war noch nicht angetreten oder bezahlt worden.
Die Kernfrage: Was genau musste das Oberlandesgericht prüfen?
Das Oberlandesgericht Oldenburg (der zuständige Senat, also die Gruppe von Richtern, die in dieser Sache entschieden) musste nun also prüfen, ob das Landgericht Aurich bei seiner Entscheidung Rechtsfehler gemacht hatte. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage: Hat das Landgericht die Höhe der zu Unrecht bezogenen Sozialleistungen korrekt berechnet? Besonders knifflig war hierbei, wie mit den Einnahmen aus den Drogenverkäufen umzugehen ist. Durfte das Landgericht einfach die gesamten Verkaufserlöse als Einkommen anrechnen? Oder hätte es berücksichtigen müssen, dass Herr K. ja auch Ausgaben hatte, um die Drogen überhaupt erst zu beschaffen? Und welche Auswirkungen hätte eine möglicherweise fehlerhafte Berechnung auf die Höhe des eingezogenen Betrages und auf die Bildung einer Gesamtstrafe unter Einbeziehung der früheren Verurteilung?
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts: Zurück auf Anfang
Das Oberlandesgericht Oldenburg gab der Revision von Herrn K. statt. In seinem Beschluss vom 25. März 2025 hob es das Urteil des Landgerichts Aurich vom 6. November 2024 mitsamt den dazugehörigen Feststellungen auf. Aufheben bedeutet, das Urteil ist ungültig. Die Sache wurde zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere kleine Strafkammer des Landgerichts Aurich zurückverwiesen. Das bedeutet, der Fall muss nun von anderen Richtern am Landgericht Aurich komplett neu aufgerollt werden. Diese neue Kammer muss dann auch über die Kosten des Revisionsverfahrens entscheiden.
Die Begründung: Warum das Landgericht falsch rechnete
Aber warum kam das Oberlandesgericht zu dieser Entscheidung? Der Hauptgrund lag in der Berechnung der Einnahmen von Herrn K. für den Bezug von Sozialleistungen nach dem SGB II.
Einkommen ist nicht gleich Gewinn: Die vergessenen Ausgaben
Das Landgericht Aurich ging zwar zunächst richtig davon aus, dass auch Einnahmen aus Straftaten, die zur Deckung des täglichen Bedarfs zur Verfügung stehen, als Einkommen im Sinne des SGB II gelten. Wenn also jemand Geld durch Drogenverkäufe verdient und damit seinen Lebensunterhalt bestreitet, muss dieses Geld grundsätzlich bei den Sozialleistungen angerechnet werden.
Das Landgericht übersah jedoch einen wichtigen Punkt: Nach § 11b Absatz 1 Nummer 5 des SGB II müssen notwendige Ausgaben, die mit der Erzielung des Einkommens verbunden sind, vom Einkommen abgezogen werden. Was bedeutet das konkret? Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen selbstgemachte Marmelade auf dem Markt. Ihr Einkommen ist nicht der gesamte Verkaufserlös. Sie müssen ja auch die Früchte, den Zucker und die Gläser abziehen, die Sie eingekauft haben. Diese Kosten sind notwendige Ausgaben, um das Einkommen überhaupt erzielen zu können. Ähnlich verhält es sich im SGB II. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen Werbungskosten bei nichtselbständiger Arbeit (also Ausgaben, die ein Arbeitnehmer hat, um seinen Job auszuüben, wie Fahrtkosten) und Betriebsausgaben bei selbständiger Tätigkeit (also Ausgaben, die ein Selbständiger hat, um sein Geschäft zu betreiben).
Warum auch „kriminelle Ausgaben“ zählen können
Jetzt könnte man einwenden: Aber Drogenhandel ist doch illegal! Kann man da überhaupt von abzugsfähigen Ausgaben sprechen? Das Oberlandesgericht sagt hier: Ja, das kann man. Bei der Berechnung des Einkommens nach dem SGB II kommt es auf eine wirtschaftliche und wertungsindifferente Betrachtungsweise an. Wertungsindifferent bedeutet, dass moralische Gesichtspunkte keine Rolle spielen dürfen. Es geht rein darum, was wirtschaftlich als Einkommen zur Verfügung steht. Das Gericht zog hier Vergleiche zum Steuerrecht heran. Dort ist es anerkannt, dass auch strafbare Handlungen, die im Zusammenhang mit der Einnahmenerzielung stehen, sogenannte Erwerbsaufwendungen begründen können. Als Beispiel wurde ein Fall genannt, bei dem Depotgebühren im Zusammenhang mit der Hinterziehung von Kapitaleinkünften als abzugsfähig angesehen wurden.
Nach diesen Maßstäben hätte sich das Landgericht Aurich nicht damit begnügen dürfen, einfach die gesamten Erlöse aus den Drogenverkäufen als anrechenbare Einnahmen anzusehen. Es hätte vielmehr feststellen müssen – notfalls durch eine Schätzung –, wie hoch die Ausgaben waren, die Herr K. für den Einkauf der Betäubungsmittel hatte. Dies war umso wichtiger, als in den Gründen der früheren Verurteilung durch das Amtsgericht Emden ausdrücklich erwähnt wurde, dass Herr K. die Drogen auf Kommission gekauft hatte. Das legt nahe, dass er eben nicht den vollen Verkaufspreis als Gewinn verbuchen konnte, sondern einen Teil an seine Lieferanten abgeben musste.
Die Folgen der falschen Berechnung für den Schuldumfang
Dieser Rechtsfehler bei der Berechnung der Einnahmen führte zur Aufhebung des Urteils. Warum? Weil nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, dass die lückenhaften Feststellungen des Landgerichts Herrn K. in Bezug auf den Schuldumfang beschwerten. Der Schuldumfang bezieht sich darauf, wie schwer die Tat wiegt. Wenn Herr K. tatsächlich weniger Nettoeinkommen aus den Drogengeschäften hatte, als vom Landgericht angenommen, dann hat er möglicherweise auch das Jobcenter um einen geringeren Betrag betrogen. Das könnte sich auf die Höhe der Strafe auswirken.
Konsequenzen für die Einziehung: Was passiert mit dem Geld?
Die fehlerhafte Berechnung des Einkommens hatte auch direkte Auswirkungen auf die Einziehungsentscheidung. Wenn unklar ist, wie hoch die tatsächlich zu Unrecht bezogenen Sozialleistungen waren, dann ist auch unklar, welcher Betrag korrekterweise eingezogen werden darf. Da also eine Neuberechnung des Einkommens notwendig ist, war auch der Einziehungsentscheidung die Grundlage entzogen.
Das Oberlandesgericht entschied sich dafür, die gesamten Feststellungen des Landgerichts aufzuheben und nicht nur Teile davon. Damit soll dem neuen Tatrichter, also der Kammer am Landgericht Aurich, die den Fall neu verhandeln muss, ermöglicht werden, insgesamt widerspruchsfreie Feststellungen zu treffen.
Ein wichtiger Hinweis für das neue Verfahren: Die Gesamtstrafe
Das Oberlandesgericht nutzte die Gelegenheit, um dem Landgericht Aurich noch einen wichtigen Hinweis für die neue Hauptverhandlung mit auf den Weg zu geben. Dieser Hinweis betrifft die Bildung einer sogenannten nachträglichen Gesamtstrafe.
Wenn alte und neue Strafen zusammentreffen
Das Landgericht hatte nämlich übersehen, dass es noch die bereits erwähnte, rechtskräftige Vorverurteilung von Herrn K. durch das Amtsgericht Emden vom 23. Mai 2023 gab, die noch nicht vollstreckt war. Wenn jemand wegen mehrerer Taten verurteilt wird, oder wenn zu einer bestehenden Verurteilung neue Taten hinzukommen, die vor der früheren Verurteilung begangen wurden (oder hätten mit abgeurteilt werden können), dann sieht das Gesetz in vielen Fällen vor, dass eine Gesamtstrafe gebildet wird. Das bedeutet, es werden nicht einfach die Einzelstrafen addiert, sondern es wird eine neue, angemessene Strafe für alle Taten zusammen gefunden.
Im Fall von Herrn K. hätte das Landgericht Aurich prüfen müssen, ob die Voraussetzungen für die Bildung einer solchen nachträglichen Gesamtstrafe nach § 55 des Strafgesetzbuches (StGB) vorliegen. Dies würde erfordern, die im Urteil des Amtsgerichts Emden vom 23. Mai 2023 gebildete Gesamtfreiheitsstrafe aufzulösen. Dann müssten die Einzelstrafen aus dieser Vorverurteilung zusammen mit den Einzelstrafen aus dem aktuellen Verfahren (also für die Betrugstaten zulasten des Jobcenters) zu einer neuen Gesamtfreiheitsstrafe zusammengeführt werden. Die genauen Einzelstrafen der aktuellen Verurteilung waren im Urteil des Landgerichts Aurich allerdings nicht näher mitgeteilt worden, was ein weiterer Punkt ist, den die neue Kammer klären muss.
Der entscheidende Zeitpunkt für die Strafberechnung
Warum ist das so wichtig? Für die Bildung einer Gesamtstrafe ist der Zeitpunkt entscheidend, zu dem die Taten begangen bzw. beendet wurden. Das Landgericht hatte festgestellt, dass die letzte täuschungsbedingte Auszahlung von Sozialleistungen an Herrn K. im September 2020 erfolgte. Dies ist der maßgebliche Beendigungszeitpunkt für die Betrugstaten, um die es hier ging. Wenn dieser Zeitpunkt vor dem Urteil der früheren Verurteilung lag, spricht viel für die Bildung einer Gesamtstrafe.
Das Landgericht Aurich hat nun also die Aufgabe, den Fall unter Berücksichtigung all dieser Aspekte neu zu verhandeln und zu entscheiden. Es muss insbesondere die Einkünfte von Herrn K. aus den Drogengeschäften korrekt ermitteln, dabei seine Ausgaben berücksichtigen und dann auf dieser Basis neu über den Betrugsvorwurf, die Höhe einer möglichen Strafe und die Einziehung entscheiden. Zudem muss es die Frage der Gesamtstrafenbildung mit der Vorverurteilung prüfen.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil zeigt, dass auch illegale Einnahmen grundsätzlich bei Sozialleistungen angegeben werden müssen, aber nicht der komplette Erlös zählt. Wer zum Beispiel durch Drogenhandel Geld verdient, dem werden nur die tatsächlichen Gewinne angerechnet – die Kosten für den Drogeneinkauf müssen abgezogen werden, auch wenn die Tätigkeit selbst illegal ist. Das Gericht machte deutlich, dass es bei der Berechnung von Sozialleistungen rein um wirtschaftliche Fakten geht, nicht um moralische Bewertungen. Für Betroffene bedeutet das: Eine genaue Aufschlüsselung aller Ausgaben kann die Höhe des Betrugsschadens und damit auch die Strafe erheblich reduzieren.
Befinden Sie sich in einer ähnlichen Situation? Fragen Sie unsere Ersteinschätzung an.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Muss ich auch Einnahmen aus illegalen Tätigkeiten melden, wenn ich Sozialleistungen beziehe?
Ja, grundsätzlich müssen Sie alle Einnahmen melden, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie Sozialleistungen beziehen. Dies gilt unabhängig davon, aus welcher Quelle diese Einnahmen stammen oder ob sie aus einer legalen oder illegalen Tätigkeit resultieren.
Warum zählt auch illegales Einkommen?
Der Grundsatz der Sozialleistungen ist, dass der Staat denjenigen finanziell unterstützt, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Dabei ist für die Berechnung der Sozialleistungen entscheidend, welche tatsächlichen Geldmittel Ihnen zur Deckung Ihres Bedarfs zur Verfügung stehen. Es spielt keine Rolle, ob diese Einnahmen rechtmäßig erzielt wurden oder nicht. Wenn Sie über Geld verfügen, das zur Deckung Ihres Lebensunterhalts genutzt werden kann, mindert dies Ihren Bedarf an staatlicher Unterstützung. Die Behörden prüfen, welche Mittel Sie insgesamt zur Verfügung haben, um sicherzustellen, dass Leistungen nur in dem Umfang gezahlt werden, der tatsächlich zur Bestreitung des Lebensunterhalts notwendig ist.
Welche Folgen hat das Verschweigen?
Wenn Sie Einnahmen – gleich welcher Art – verschweigen und weiterhin Sozialleistungen beziehen, kann dies ernsthafte Konsequenzen haben:
- Rückforderung der Leistungen: Die zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen müssen Sie in der Regel vollständig an die Behörde zurückzahlen.
- Strafrechtliche Verfolgung: Das Verschweigen relevanter Einkommen beim Bezug von Sozialleistungen kann als Sozialleistungsbetrug gewertet werden. Dies ist eine Straftat und kann zu Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen führen. Die Tatsache, dass die ursprünglichen Einnahmen bereits illegal waren, schützt Sie nicht vor der zusätzlichen Strafe wegen Sozialleistungsbetrugs.
Für Sie als Leistungsempfänger bedeutet dies, dass Sie eine umfassende und wahrheitsgemäße Auskunft über alle Ihre Einkommensverhältnisse geben müssen. Dies dient der korrekten Berechnung Ihrer Leistungsansprüche und der Vermeidung rechtlicher Probleme.
Welche rechtlichen Folgen drohen, wenn ich meine Einkünfte beim Bezug von Sozialleistungen nicht oder falsch angebe?
Wenn Sie beim Bezug von Sozialleistungen, wie beispielsweise Bürgergeld oder Wohngeld, Ihre Einkünfte nicht oder nicht korrekt angeben, drohen Ihnen mehrere ernsthafte rechtliche Konsequenzen. Dies kann sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche beziehungsweise öffentlich-rechtliche Folgen haben.
Strafrechtliche Folgen: Betrug
Das absichtliche Verschweigen oder Falschmelden von Einkünften, um höhere Sozialleistungen zu erhalten, stellt in der Regel einen Betrug dar. Dieser Straftatbestand ist im Strafgesetzbuch (StGB) geregelt.
- Betrug (§ 263 StGB): Wer in der Absicht handelt, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, indem er Tatsachen vorspiegelt, entstellt oder unterdrückt und dadurch einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Im Kontext von Sozialleistungen spricht man oft von Sozialleistungsbetrug.
- Mögliche Strafen: Abhängig von der Höhe des Schadens und der Häufigkeit der Vergehen können die Strafen von einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe reichen. Bei einem Betrug geringer Höhe oder wenn es sich um ein einmaliges Vergehen handelt, ist oft eine Geldstrafe wahrscheinlicher. Bei größeren Summen oder wiederholten Taten kann eine Freiheitsstrafe verhängt werden. Eine Vorstrafe kann weitreichende negative Auswirkungen auf Ihr weiteres Leben haben.
Rückforderung zu Unrecht bezogener Leistungen
Unabhängig von strafrechtlichen Konsequenzen haben die Sozialleistungsträger (z.B. Jobcenter, Rentenversicherung) das Recht und die Pflicht, zu Unrecht gezahlte Leistungen zurückzufordern.
- Rückzahlungsanspruch: Wenn festgestellt wird, dass Sie durch falsche oder fehlende Angaben zu viel Geld erhalten haben, müssen Sie die überzahlten Beträge zurückzahlen. Das ist eine rein öffentlich-rechtliche Forderung.
- Zinsen und Gebühren: Oft werden zusätzlich zu den rückzufordernden Beträgen auch Zinsen auf die zu viel gezahlten Summen sowie gegebenenfalls Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung der Rückforderung erhoben.
- Vollstreckung: Wenn Sie die geforderten Beträge nicht freiwillig zurückzahlen, kann der Sozialleistungsträger die Forderung zwangsweise eintreiben. Dies kann durch Pfändung von Einkommen (Lohnpfändung) oder Vermögen (Kontenpfändung) geschehen. Auch eine Einziehung von vorhandenem Vermögen ist möglich.
Weitere Konsequenzen im Sozialrecht
Neben den strafrechtlichen Verfolgungen und der Rückzahlungspflicht können auch die laufenden Sozialleistungen beeinflusst werden.
- Einstellung oder Entzug der Leistungen: Ihre aktuellen Leistungen können gekürzt, eingestellt oder ganz entzogen werden, wenn sich herausstellt, dass Sie die Voraussetzungen für den Bezug nicht mehr erfüllen oder nicht erfüllt haben.
- Sperrzeiten/Sanktionen: Bei bestimmten Sozialleistungen können auch Sperrzeiten verhängt werden, in denen Sie keine neuen Leistungen beantragen oder erhalten können, auch wenn Sie die Voraussetzungen eigentlich erfüllen würden.
- Ansehensverlust und Misstrauen: Die Folgen eines Sozialleistungsbetrugs können auch zu einem erheblichen Vertrauensverlust seitens der Behörden führen, was zukünftige Antragsstellungen erschweren kann.
Es ist somit von großer Bedeutung, alle relevanten Einkünfte und Vermögensverhältnisse stets wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben, um solche weitreichenden und schwerwiegenden Konsequenzen zu vermeiden.
Werden bei der Berechnung von Sozialleistungen auch Ausgaben berücksichtigt, die ich hatte, um Einnahmen – auch aus illegalen Quellen – zu erzielen?
Ja, bei der Berechnung von Sozialleistungen werden grundsätzlich nur Ihre tatsächlichen Einnahmen berücksichtigt, also das Geld, das Ihnen nach Abzug notwendiger Ausgaben tatsächlich zur Verfügung steht. Dies gilt auch für Einnahmen, die aus illegalen Quellen stammen.
Abzug von notwendigen Ausgaben
Das Sozialrecht geht vom sogenannten Netto-Prinzip aus. Das bedeutet, dass nicht alle Geldeingänge als volles Einkommen zählen, sondern nur der Betrag, der Ihnen nach Abzug bestimmter Kosten übrig bleibt. Ziel ist es, den tatsächlichen wirtschaftlichen Vorteil zu ermitteln, den Sie aus einer Einnahme hatten.
Dazu zählen Ausgaben, die direkt und notwendig mit der Erzielung der Einnahme verbunden waren. Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen etwas. Nur das Geld, das Sie nach Abzug der Kosten für den Einkauf oder die Herstellung des Artikels erhalten, ist Ihr tatsächlicher Gewinn. Bei Sozialleistungen wird ähnlich gerechnet: Es zählt nur, was Sie tatsächlich gewonnen haben.
Umgang mit illegalen Einnahmen
Auch wenn Einnahmen aus illegalen Quellen, wie zum Beispiel aus Drogenhandel oder Diebstahl, stammen, wird bei der Berechnung der Sozialleistungen oder der Feststellung eines möglichen Betrugs nur der reine Gewinn herangezogen. Wenn Sie also Ausgaben hatten, um diese illegalen Einnahmen zu erzielen – beispielsweise Kosten für die Beschaffung von illegalen Waren, die Sie weiterverkauft haben – können diese unter Umständen vom Bruttoertrag abgezogen werden.
Der Grund hierfür ist, dass der Gesetzgeber und die Rechtsprechung (also die Gerichte) bei der Anrechnung von Einkommen auf Sozialleistungen den Wert der tatsächlichen Bereicherung feststellen wollen. Nur der Betrag, der Sie wirklich reicher gemacht hat, kann als Einkommen angerechnet werden. Das bedeutet: Haben Sie Geld ausgegeben, um eine (illegale) Einnahme zu erzielen, haben Sie diesen Betrag nicht als Gewinn zur Verfügung.
Wichtig ist jedoch: Es müssen nachweislich notwendige und direkt mit der Einnahmeerzielung verbundene Ausgaben sein. Die Beweislast dafür liegt bei der Person, die die Ausgaben geltend machen möchte. Nicht jede Ausgabe, die irgendwie im Zusammenhang mit einer illegalen Tätigkeit steht, wird anerkannt. Es geht spezifisch um Ausgaben, die unumgänglich waren, um die Einnahmen überhaupt zu erzielen.
Für Sie bedeutet das: Wenn es um die Berechnung von Sozialleistungen oder die Frage geht, ob Sie zu Unrecht Leistungen erhalten haben, wird der tatsächliche finanzielle Überschuss aus allen Einnahmen – ob legal oder illegal – berücksichtigt, nachdem notwendige Ausgaben abgezogen wurden.
Wie wird die Höhe des Betrags ermittelt, der bei Sozialleistungsbetrug zurückgefordert oder eingezogen werden kann?
Die Höhe des Betrags, der bei einem Sozialleistungsbetrug zurückgefordert oder eingezogen werden kann, bemisst sich grundsätzlich nach dem finanziellen Vorteil, den die Person unrechtmäßig erhalten hat. Es geht darum, die Differenz zwischen den tatsächlich gezahlten Sozialleistungen und den Leistungen zu ermitteln, die der Person bei korrekter Angabe aller relevanten Informationen zugestanden hätten.
Das Grundprinzip der Rückforderung
Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II (Bürgergeld), Sozialhilfe oder Wohngeld werden oft im Voraus gezahlt. Die Grundlage für diese Zahlungen sind die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der leistungsbeziehenden Person. Ändern sich diese Verhältnisse (z.B. durch Aufnahme einer Arbeit, Erbschaft oder Änderungen in der Haushaltsgemeinschaft) oder wurden relevante Informationen von Anfang an nicht oder falsch angegeben, entsteht eine sogenannte Überzahlung. Diese Überzahlung stellt den Betrag dar, der zurückgefordert wird.
Wie der überzahlte Betrag berechnet wird
Die Berechnung erfolgt durch einen Vergleich zweier Werte:
- Was die Person tatsächlich erhalten hat: Dies sind die monatlichen Sozialleistungen, die von der Behörde überwiesen wurden.
- Was der Person rechtmäßig zugestanden hätte: Hierfür wird eine fiktive Neuberechnung der Leistungen vorgenommen, und zwar unter Berücksichtigung aller Tatsachen, die verschwiegen oder falsch angegeben wurden.
Besonders wichtig ist hierbei die Unterscheidung zwischen Bruttoeinnahmen und dem tatsächlich anrechenbaren Einkommen. Nicht jeder Euro, der verdient wird, reduziert die Sozialleistung im gleichen Maße. Vom Bruttoeinkommen werden verschiedene Beträge abgezogen, bevor es auf die Sozialleistungen angerechnet wird.
Die Berechnung des überzahlten Betrags lässt sich vereinfacht so darstellen:
Überzahlter Betrag = Tatsächlich erhaltene Leistung – Rechtmäßig zustehende Leistung
Um die rechtmäßig zustehende Leistung zu ermitteln, wird zunächst das anrechenbare Einkommen berechnet.
Anrechenbares Einkommen = Bruttoeinnahmen – Absetzbeträge – Freibeträge
- Bruttoeinnahmen sind alle Einkünfte vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben.
- Absetzbeträge sind beispielsweise pauschale Beträge für Werbungskosten (Ausgaben, die mit der Arbeit zusammenhängen) oder Beiträge für notwendige Versicherungen.
- Freibeträge sind bestimmte Einkommensteile, die gar nicht auf die Sozialleistung angerechnet werden, um beispielsweise die Aufnahme einer Arbeit zu fördern oder bestimmte Ausgaben zu decken (z.B. der Erwerbstätigenfreibetrag bei Bürgergeld).
Für Sie bedeutet das: Wenn beispielsweise jemand 1.000 Euro brutto verdient hat, aber durch Freibeträge und Absetzbeträge nur 400 Euro angerechnet werden dürfen, dann mindert sich die Sozialleistung nur um diese 400 Euro und nicht um die vollen 1.000 Euro. Die Überzahlung entsteht also nur aus dem Teil des Einkommens, der nach Abzug aller zulässigen Posten die Leistung gemindert hätte.
Rückforderung durch die Behörde und Einziehung im Strafverfahren
Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen der Rückforderung und der Einziehung:
- Rückforderung: Dies ist ein verwaltungsrechtlicher Vorgang. Die Sozialbehörde (z.B. das Jobcenter oder Sozialamt) erlässt einen Bescheid, mit dem sie die zu viel gezahlten Leistungen zurückfordert. Dies geschieht in der Regel auf Grundlage von Gesetzen wie dem Sozialgesetzbuch (SGB). Das Ziel ist die Erstattung des Betrags an die Staatskasse.
- Einziehung: Dies ist eine strafrechtliche Maßnahme, die im Rahmen eines gerichtlichen Urteils wegen Sozialleistungsbetrugs erfolgen kann. Hierbei ordnet das Gericht die Einziehung des Wertes des Erlangten an. Der Zweck dieser Maßnahme ist es, dem Täter den finanziellen Vorteil zu entziehen, den er durch die Straftat (Betrug) erzielt hat. Oft ist der Wert des eingezogenen Betrags identisch mit dem überzahlten Betrag der Rückforderung. Es handelt sich jedoch um zwei unterschiedliche rechtliche Wege mit verschiedenen Rechtsgrundlagen und Verfahren. Die Einziehung nach einem Strafurteil tritt in der Regel an die Stelle der Rückforderung durch die Behörde, sodass der Betrag nicht doppelt gezahlt werden muss.
Einfluss von Freibeträgen und Absetzbeträgen auf die Höhe
Die Berücksichtigung von Freibeträgen und Absetzbeträgen ist entscheidend für die korrekte Ermittlung der Überzahlung. Stellen Sie sich vor, eine Person meldet ein Einkommen nicht. Bei der späteren Neuberechnung wird das tatsächlich erzielte Bruttoeinkommen herangezogen. Davon werden dann alle gesetzlich zulässigen Abzüge und Freibeträge subtrahiert. Nur der Betrag, der nach diesen Abzügen übrig bleibt und die Sozialleistungen tatsächlich gemindert hätte, wird zur Grundlage der Rückforderung. Wenn beispielsweise ein Einkommen von 500 Euro erzielt wurde, aber ein Freibetrag von 200 Euro darauf anwendbar gewesen wäre, dann wird die Überzahlung nur auf Basis der restlichen 300 Euro berechnet, die die Leistung tatsächlich reduziert hätten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Höhe des zurückzufordernden oder einzuziehenden Betrags stets individuell berechnet wird. Die Sozialbehörden prüfen dabei sehr genau, welche Einkünfte und Ausgaben im jeweiligen Zeitraum tatsächlich vorlagen und wie diese nach den geltenden Gesetzen korrekt zu berücksichtigen gewesen wären.
FAQ-Frage: Was bedeutet es, wenn ich bereits eine Strafe habe und für frühere Taten nun wegen Sozialleistungsbetrugs erneut verurteilt werde?
Wenn Sie bereits wegen einer Tat verurteilt wurden und nun eine weitere Verurteilung für Taten erhalten, die zeitlich vor Ihrer ersten Verurteilung begangen wurden – wie es bei nachträglich aufgedecktem Sozialleistungsbetrug oft der Fall sein kann – dann tritt ein besonderer Mechanismus des Strafrechts in Kraft: die nachträgliche Gesamtstrafenbildung.
Was ist die nachträgliche Gesamtstrafenbildung?
Stellen Sie sich vor, die Gerichte hätten bei Ihrer ersten Verurteilung bereits von allen Taten gewusst, die Sie bis zu diesem Zeitpunkt begangen haben. Dann hätte der Staat eine einzige, umfassende Strafe für alle diese Taten gebildet. Da aber die Informationen zu den „älteren“ Taten (wie beispielsweise einem früheren Sozialleistungsbetrug) erst später bekannt wurden, muss dies nun „nachgeholt“ werden. Die nachträgliche Gesamtstrafenbildung dient dazu, zu vermeiden, dass Sie für denselben zeitlichen Lebensabschnitt übermäßig hart bestraft werden, nur weil die Taten zu unterschiedlichen Zeitpunkten entdeckt und abgeurteilt wurden. Es geht um eine gerechte und verhältnismäßige Gesamtwürdigung.
Wie wird die neue Gesamtstrafe gebildet?
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Strafe für die „neuen“ älteren Taten nicht einfach zu Ihrer bereits bestehenden Strafe hinzuaddiert wird. Das wäre in den meisten Fällen ungerecht und würde der Idee widersprechen, alle Taten als eine Einheit zu betrachten, wenn sie zeitlich zusammengehören. Stattdessen wird eine fiktive Gesamtstrafe gebildet, so als ob alle Taten von Anfang an gemeinsam verurteilt worden wären.
Dabei läuft der Prozess vereinfacht gesagt so ab:
- Zuerst wird die Einzelstrafe für die nun neu verurteilten „älteren“ Taten (z.B. der Sozialleistungsbetrug) bestimmt.
- Diese Strafe wird dann mit der Strafe aus Ihrer früheren Verurteilung in Beziehung gesetzt.
- Die neu gebildete Gesamtstrafe muss höher sein als die höchste der beiden Einzelstrafen.
- Gleichzeitig darf die Gesamtstrafe nicht die Summe aller Einzelstrafen erreichen. Das Gesetz schreibt hier einen „Strafrahmen“ vor, der die Höchstgrenze deutlich unterhalb der Summe der Einzelstrafen festlegt. Dieser Mechanismus soll einen „Rabatt“ oder eine „Milderung“ bewirken, weil mehrere Taten, die zeitlich zusammengehören, von Anfang an als Einheit betrachtet werden.
Die rechtliche Grundlage für diese Vorgehensweise findet sich in § 55 des Strafgesetzbuches (StGB).
Was bedeutet das für Betroffene?
Für Sie als Betroffene bedeutet das, dass das Gericht eine neue, umfassende Gesamtstrafe festsetzt, die die gerechte Bestrafung für alle vor der ersten Verurteilung begangenen Taten abbilden soll. Diese neue Strafe ersetzt dann die bisherige Strafe. Ob sich die tatsächliche Zeit, die Sie in Haft verbringen müssen, oder die Höhe einer Geldstrafe für Sie am Ende erhöht, verringert oder gleich bleibt, hängt von den genauen Umständen der Einzelfälle und der vom Gericht gebildeten neuen Gesamtstrafe ab. Ziel ist es, eine gerechte und verhältnismäßige Bestrafung für alle Taten zu finden, die vor der ersten Verurteilung bereits begangen wurden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Berufung
Die Berufung ist ein Rechtsmittel, mit dem ein Urteil einer unteren Gerichtsstufe von einer höheren Instanz vollständig überprüft werden kann. Dabei werden sowohl die tatsächlichen Feststellungen (also was passiert ist) als auch die rechtliche Bewertung (wie das Recht angewendet wurde) neu geprüft. Das Ziel ist, Fehler im erstinstanzlichen Urteil zu korrigieren und eine gerechte Entscheidung zu ermöglichen. Im beschriebenen Fall wandte Herr K. das Rechtsmittel der Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts an.
Einziehung
Die Einziehung ist eine strafrechtliche Maßnahme, bei der das Gericht anordnet, dass der Täter den durch die Straftat erlangten Vermögensvorteil an den Staat abgeben muss. Sie dient dazu, den Täter finanziell „leichter zu stellen“ und den unrechtmäßigen Gewinn zu entziehen. Im Unterschied zur Rückforderung durch die Behörde erfolgt die Einziehung im Rahmen eines Strafverfahrens und ist Teil des Strafurteils. Im Fall von Herrn K. ordnete das Gericht die Einziehung des durch Betrug erlangten Geldes an.
Revision und Sachrüge
Die Revision ist ein Rechtsmittel, das gegen Urteile einer Berufungsinstanz eingelegt werden kann, um diese nur auf Fehler in der Rechtsanwendung (nicht aber auf Tatsachenfehler) überprüfen zu lassen. Bei der Revision wird also nicht erneut verhandelt, sondern geprüft, ob rechtliche Vorschriften korrekt angewandt wurden. Die Sachrüge ist ein Teil der Revision, mit der geltend gemacht wird, dass das materielle Recht vom angefochtenen Gericht falsch ausgelegt oder angewandt wurde. Herr K. begründete seine Revision mit einer Sachrüge gegenüber dem Urteil des Landgerichts.
Nettoeinkommen (im Sinne des SGB II)
Beim Bezug von Sozialleistungen wird nicht das Bruttoeinkommen, also der gesamte Geldbetrag vor Ausgaben, als relevantes Einkommen berücksichtigt, sondern das Nettoeinkommen. Das bedeutet, vom Bruttoerlös werden notwendige und unmittelbar mit der Einnahmeerzielung verbundene Ausgaben abgezogen, um den tatsächlichen Gewinn zu ermitteln. Dadurch wird der finanzielle Vorteil, der tatsächlich zur Verfügung steht, realistisch erfasst. Im Fall von Herrn K. hätte das Landgericht bei der Berechnung der Sozialleistungen auch die Ausgaben für den Drogeneinkauf abziehen müssen.
Beispiel: Wer Marmelade verkauft, muss erst die Kosten für Zutaten und Gläser abziehen, bevor er den Gewinn als Einkommen ansetzen kann.
Nachträgliche Gesamtstrafe (§ 55 StGB)
Die nachträgliche Gesamtstrafe ist ein strafrechtlicher Mechanismus, der angewendet wird, wenn jemand mehrfach verurteilt wird, wobei die neuen Verurteilungen Taten betreffen, die vor einer früheren bereits rechtskräftigen Strafe begangen wurden. Ziel ist es, eine einheitliche, angemessene Gesamtstrafe zu bilden, die alle Taten berücksichtigt, ohne dass die Strafen einfach nur addiert werden. Dabei ersetzt die Gesamtstrafe die früheren Einzelstrafen und sorgt für eine gerechte Gesamtwürdigung der Schuld. Im Fall von Herrn K. musste das neue Gericht prüfen, ob und wie die aktuelle Strafe mit der früheren Vorverurteilung zu verrechnen ist.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 11b Absatz 1 Nummer 5 SGB II: Regelt, dass notwendige Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit stehen, vom Einkommen abzuziehen sind, bevor die Berechnung der Sozialleistungen erfolgt. Diese Vorschrift sorgt für eine realistische Bestimmung des tatsächlich verfügbaren Einkommens. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht Aurich hatte bei der Berechnung des Einkommens von Herrn K. aus den Drogenverkäufen nur die Bruttoeinnahmen angesetzt, ohne die Ausgaben für den Einkauf der Betäubungsmittel abzuziehen – ein zentraler Fehler, der zur Aufhebung des Urteils führte.
- § 263 StGB (Betrug): Strafrechtliche Norm, die Täuschungshandlungen unter Strafe stellt, mit dem Ziel, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Gewerbsmäßiger Betrug wird besonders schwer gewertet, da hier eine dauerhafte Einnahmequelle aus der Täuschung besteht. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Herr K. wurde wegen Betrugs in zwei Fällen verurteilt, weil er seine Einnahmen aus Drogengeschäften dem Jobcenter nicht angezeigt hatte und dadurch unrechtmäßig Sozialleistungen bezog.
- § 73 StGB (Einziehung): Ermächtigt zur Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt wurden, um rechtswidrige Bereicherung rückgängig zu machen. Dabei ist der Einziehungsumfang von der Höhe des tatsächlich zufließenden Vermögens abhängig. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Einziehungsentscheidung basierte auf einer fehlerhaften Berechnung der Einnahmen, da das Landgericht die Ausgaben von Herrn K. außer Acht ließ; somit war nicht klar, welcher Betrag tatsächlich eingezogen werden durfte.
- § 55 StGB (Bildung der Gesamtstrafe): Regelt, dass aus mehreren Strafen eine Gesamtstrafe gebildet wird, wenn sie für mehrere Taten oder in unterschiedlichen Verfahren verhängt wurden, um eine angemessene und einheitliche Strafhöhe sicherzustellen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht Aurich musste prüfen, ob eine Gesamtstrafe aus der früheren noch nicht vollstreckten Verurteilung und der neuen Verurteilung zu bilden ist, was es zuerst versäumte und das Oberlandesgericht als erheblichen Verfahrensmangel ansah.
- SGB II (Sozialgesetzbuch Zweites Buch): Regelt die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV) und definiert, welche Einnahmen als Einkommen anzurechnen sind, unabhängig von deren Herkunft, auch wenn diese aus illegalen Tätigkeiten stammen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Einnahmen aus dem illegalen Drogenhandel sind grundsätzlich als Einkommen im Sinne des SGB II anzurechnen, weshalb deren korrekte Ermittlung und Berücksichtigung für die Berechnung der Sozialleistungen ausschlaggebend ist.
- Rechtsmittelrecht – Berufung und Revision (§§ 312 ff. StPO): Die Berufung erlaubt eine umfassende Tatsachen- und Rechtsprüfung durch ein höheres Gericht, die Revision überprüft nur die Rechtsanwendung auf Fehler im Urteil der Vorinstanz. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Herr K. nutzte die Berufung und später die Revision, um gegen das Urteil und insbesondere die fehlerhafte rechtliche Bewertung der Einkommensberechnung vorzugehen; das Oberlandesgericht erkannte Rechtsfehler und hob das Urteil auf.
Das vorliegende Urteil
Oberlandesgericht Oldenburg – Az.: 1 ORs 51/25 – Beschluss vom 25.03.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.








