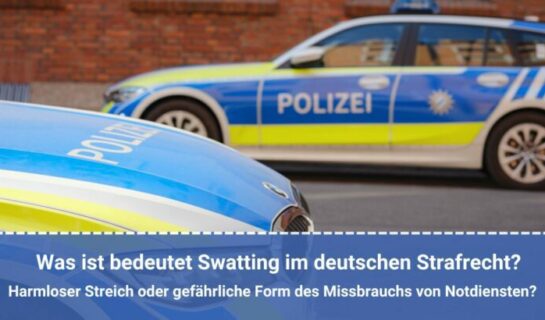Ein Protestierender klebte sich mit Sekundenkleber an eine Fahrbahn, um den Verkehr zu blockieren und eine Räumung durch die Polizei zu verhindern. Ein Amtsgericht sprach ihn frei, doch das Kammergericht bewertet die Festklebe-Aktion nun als Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte.
Übersicht
- Das Urteil in 30 Sekunden
- Die Fakten im Blick
- Der Fall vor Gericht
- Was geschah, als ein Protestierender sich mit Sekundenkleber an die Fahrbahn klebte und den Verkehr aufhielt?
- Warum wurde der Protestierende wegen Widerstand und Nötigung angeklagt?
- Wie entschied das Amtsgericht im Fall des festgeklebten Protestierenden?
- Warum legte die Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch Revision ein?
- Wie beurteilte das Kammergericht die „Gewaltanwendung durch Kleben auf Fahrbahn“?
- Welche Rechtsgrundsätze waren für die Entscheidung des Kammergerichts maßgeblich?
- Warum spielt die Art des Hilfsmittels – Kleber oder fester Gegenstand – keine Rolle?
- Welche weiteren Schritte sind im Verfahren des festgeklebten Protestierenden geplant?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 3 ORs 22/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Urteil in 30 Sekunden
- Das Problem: Ein Protestierender klebte sich mit Sekundenkleber an die Fahrbahn. Er blockierte den Verkehr und konnte nicht einfach von der Polizei entfernt werden.
- Die Rechtsfrage: War das Festkleben am Boden Widerstand gegen die Polizei und damit eine Straftat?
- Die Antwort: Ja, ein höheres Gericht befand das Festkleben als Gewalt gegen die Polizei. Es hob einen Freispruch auf und verwies den Fall zur Neuverhandlung zurück.
- Die Bedeutung: Sich mit Kleber an einer Fahrbahn festzuhalten, kann als gewaltsamer Widerstand gegen Polizeibeamte gelten. Entscheidend ist dabei, dass ihre Arbeit dadurch erheblich erschwert wird.
Die Fakten im Blick
- Gericht: Kammergericht Berlin
- Datum: 02.062025
- Aktenzeichen: 3 ORs 22/25 – 161 SRs 2/25
- Verfahren: Sprungrevision
- Rechtsbereiche: Strafrecht, Strafprozessrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Die Staatsanwaltschaft Berlin. Sie legte Revision gegen den Freispruch des Angeklagten ein.
- Beklagte: Ein Protestierender. Er wurde vom Amtsgericht vom Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte freigesprochen.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Der Angeklagte klebte sich bei Protesten mit Sekundenkleber auf vielbefahrene Straßen fest. Dies erschwerte es Polizeibeamten, ihn wegzutragen.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Gilt das Festkleben an einer Straße als „Gewalt“ gegen Polizeibeamte, wenn es Polizisten daran hindert, jemanden wegzutragen?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Das Kammergericht hob das Urteil des Amtsgerichts auf.
- Zentrale Begründung: Das Gericht entschied, dass das Festkleben mit Sekundenkleber als Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte zu werten ist, weil es Polizisten erheblich am Wegtragen hindert und eine nicht unerhebliche Kraft zur Lösung erfordert.
- Konsequenzen für die Parteien: Der Fall wird nun zur erneuten Verhandlung an eine andere Abteilung des Amtsgerichts zurückverwiesen.
Der Fall vor Gericht
Was geschah, als ein Protestierender sich mit Sekundenkleber an die Fahrbahn klebte und den Verkehr aufhielt?
In einer großen Stadt in Deutschland kam es im April 2023 zu zwei bemerkenswerten Vorfällen, die die juristische Welt beschäftigten. Ein Protestierender setzte sich an zwei verschiedenen Tagen mitten auf stark befahrene Straßenkreuzungen. Sein Ziel war es, den Verkehr zum Stillstand zu bringen, um auf sein Anliegen aufmerksam zu machen.

Um sicherzustellen, dass er nicht einfach weggetragen werden konnte, trug er Sekundenkleber auf seine Handflächen auf und drückte diese fest auf den Fahrbahnbelag. Die Verbindung zwischen seiner Haut und dem Asphalt war so stark, dass ein einfaches Wegtragen durch die herbeieilenden Polizeibeamten unmöglich wurde. Diese unkonventionelle Methode erschwerte die Durchsetzung der polizeilichen Anweisungen, die Kreuzung zu räumen, erheblich.
Warum wurde der Protestierende wegen Widerstand und Nötigung angeklagt?
Aufgrund seines Verhaltens sah sich der Protestierende mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft warf ihm zwei Vergehen vor, die im Gesetz als sogenannte tateinheitlich begangene Delikte angesehen werden. Das bedeutet, dass eine Handlung oder mehrere Handlungen in engem Zusammenhang mehrere Straftatbestände zugleich erfüllen. Im konkreten Fall ging es um Nötigung nach § 240 des Strafgesetzbuches (StGB) und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach § 113 StGB.
Nötigung bedeutet, dass jemand einen anderen Menschen mit Gewalt oder durch Drohung zu einem Verhalten zwingt, das dieser nicht will. Im Straßenverkehr kann das zum Beispiel das Blockieren einer Fahrbahn sein, um Autofahrer zum Anhalten zu zwingen. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte liegt vor, wenn jemand eine Amtshandlung, wie zum Beispiel das Wegtragen durch Polizisten, mit Gewalt verhindert oder erheblich erschwert. Der Einsatz des Sekundenklebers auf der Fahrbahn sollte genau diese Erschwernis bewirken.
Wie entschied das Amtsgericht im Fall des festgeklebten Protestierenden?
Das Verfahren begann vor dem Amtsgericht Tiergarten. Dort wurde der Protestierende wegen der angeklagten Vergehen der Nötigung durch Festkleben und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Das Gericht hatte zu prüfen, ob sein Verhalten tatsächlich die gesetzlichen Anforderungen dieser Straftatbestände erfüllte.
In seinem Urteil vom 5. September 2024 sprach das Amtsgericht Tiergarten den Protestierenden jedoch frei. Das bedeutet, das Gericht sah die Vorwürfe nicht als erwiesen an und der Angeklagte wurde nicht verurteilt. Bei dieser Entscheidung spielten auch Überlegungen zur sogenannten Verwerflichkeit der Nötigung eine Rolle. Die Verwerflichkeit ist ein wichtiger Bestandteil des Nötigungs-Paragraphen (§ 240 Abs. 2 StGB). Sie besagt, dass eine Nötigung nur dann strafbar ist, wenn die Art und Weise, wie jemand zu einem Verhalten gezwungen wird, als sozialethisch verwerflich, also moralisch anstößig, angesehen wird. Das Amtsgericht schien hier eine solche Verwerflichkeit nicht erkannt zu haben oder den Einsatz von Sekundenkleber nicht als ausreichende Gewalt anzusehen.
Warum legte die Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch Revision ein?
Die Staatsanwaltschaft Berlin war mit dem Freispruch des Amtsgerichts nicht einverstanden. Sie war der Ansicht, dass das Verhalten des Protestierenden sehr wohl eine Straftat darstelle, insbesondere im Hinblick auf den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit Sekundenkleber. Daher legte sie ein Rechtsmittel ein, das in diesem Fall als Sprungrevision bezeichnet wird. Eine Sprungrevision ist ein besonderer Fall der Revision. Normalerweise würde nach einem Urteil des Amtsgerichts zunächst das Landgericht als sogenannte Berufungsinstanz angerufen. Bei einer Sprungrevision überspringt man diese Zwischenstufe und geht direkt vom Amtsgericht zum nächsthöheren Gericht, das für Revisionen zuständig ist – hier das Kammergericht in Berlin.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass das Auftragen von Sekundenkleber auf die Hand und das feste Andrücken auf die Fahrbahn als eine Form von Gewalt zu werten sei. Sie sahen darin ein „materielles Zwangsmittel“, das die Arbeit der Polizei – das Wegtragen des Protestierenden – erheblich erschwert habe.
Wie beurteilte das Kammergericht die „Gewaltanwendung durch Kleben auf Fahrbahn“?
Das Kammergericht in Berlin, das für diese Sprungrevision zuständig war, prüfte den Fall. Es erklärte die Revision der Staatsanwaltschaft für zulässig und sah deren Argumente als stichhaltig an. Mit Beschluss vom 2. Juni 2025 hob das Kammergericht das Urteil des Amtsgerichts Tiergarten auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an eine andere Abteilung des Amtsgerichts zurück.
Das Kammergericht kam zu einer anderen Einschätzung als das Amtsgericht. Es urteilte, dass das Festkleben der Hand an die Fahrbahn mittels Sekundenkleber sehr wohl eine Widerstandshandlung im Sinne von § 113 Abs. 1 StGB darstellt. Der Senat, also der zuständige Spruchkörper des Kammergerichts, begründete dies mit den sogenannten Adhäsionskräften, die durch den Kleber entstanden. Adhäsionskräfte sind die Anziehungskräfte zwischen verschiedenen Materialien, die dazu führen, dass sie aneinanderhaften – im Fall von Sekundenkleber eben extrem stark.
Das Gericht erklärte, dass diese mittelbare Kraftentfaltung dazu führte, dass die Polizeibeamten ihre Aufgabe nicht ohne Weiteres erfüllen konnten. Sie hätten entweder „nicht ganz unerhebliche“ körperliche Kraft aufwenden müssen oder spezielle physikalisch-chemische Hilfsmittel (wie Lösungsmittel) einsetzen müssen, um die Person von der Fahrbahn zu lösen. Ein einfaches Wegtragen war durch die Verklebung nicht möglich.
Das Kammergericht stellte klar, dass auch Handlungen, die nicht direkt gegen den Beamten gerichtet sind, aber seine Arbeit behindern, als Gewalt gewertet werden können. Ein Beispiel hierfür ist das Abschließen einer Wohnungstür, um einem Gerichtsvollzieher den Zutritt zu verwehren – auch dies wird als „vorweggenommene tätige Handlung“ und damit als Gewalt betrachtet.
Welche Rechtsgrundsätze waren für die Entscheidung des Kammergerichts maßgeblich?
Für seine Entscheidung zog das Kammergericht mehrere wichtige Rechtsgrundsätze heran. Diese bilden das Fundament der juristischen Beurteilung und zeigen, auf welcher Basis das Gericht seine Überlegungen anstellte:
- § 113 Abs. 1 Alt. 1 StGB (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte): Dieser Paragraph regelt, wann der Widerstand gegen Amtsträger strafbar ist, insbesondere durch die Anwendung von Gewalt.
- § 240 Abs. 2 StGB (Nötigung; Verwerflichkeitsprüfung): Hier wird definiert, wann eine Nötigung strafbar ist und dass die Verwerflichkeit der Mittel oder des Zwecks gegeben sein muss.
- § 335 Abs. 1 StPO (Sprungrevision): Dieser Paragraph der Strafprozessordnung regelt die Möglichkeit, eine Instanz im Rechtsmittelweg zu überspringen.
- § 354 Abs. 1 StPO (Änderung des Schuldspruchs bei Freispruch durch das Revisionsgericht): Beschreibt, unter welchen Umständen ein Revisionsgericht bei einem Freispruch selbst eine Verurteilung aussprechen kann.
- § 358 Abs. 1 StPO (Bindungswirkung von Aufhebungsansichten): Erläutert, inwieweit das Gericht bei einer erneuten Verhandlung an die rechtliche Beurteilung des Revisionsgerichts gebunden ist.
- § 121 GVG (Vorlage an den Bundesgerichtshof bei grundsätzlicher Bedeutung): Regelt, wann ein Gericht eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dem Bundesgerichtshof zur Klärung vorlegen muss, wenn es von der Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts abweichen will.
Das Kammergericht stützte sich zudem auf die bestehende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) und eigene frühere Entscheidungen, die den Begriff der Gewalt bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit Sekundenkleber bereits behandelt hatten. Es setzte sich auch kritisch mit einer abweichenden Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden auseinander und bezog Positionen aus der juristischen Literatur in seine Überlegungen ein.
Warum spielt die Art des Hilfsmittels – Kleber oder fester Gegenstand – keine Rolle?
Das Kammergericht wendete diese Grundsätze auf den Fall an und bejahte, dass im vorliegenden Fall tatsächlich Gewalt im Sinne von § 113 Abs. 1 StGB vorlag. Entscheidend war für das Gericht, dass durch das Festkleben der Hand an der Fahrbahn Adhäsionskräfte entstanden, die das Wegtragen des Protestierenden massiv erschwerten und zum Zeitpunkt des polizeilichen Eingreifens noch voll wirksam waren. Dadurch war der Polizeibeamte gezwungen, entweder erhebliche Kraft aufzuwenden oder chemische Hilfsmittel zu nutzen, um die Blockade zu lösen.
Das Gericht betonte, dass es keinen rechtlich relevanten Unterschied mache, ob die Polizeibeamten zur Überwindung dieses Widerstands robuste körperliche Gewalt oder ein flüssiges Lösungsmittel hätten einsetzen müssen. Das entscheidende Kriterium sei die vom Protestierenden selbst geschaffene Zwangslage und die daraus resultierende Erschwernis für die Amtshandlung der Polizei.
Eine Unterscheidung danach, ob ein „festes, kraftverstärkendes“ Hilfsmittel oder ein „flüssiges, chemisch wirkendes“ Mittel verwendet wird, würde nach Ansicht des Kammergerichts zu willkürlichen Ergebnissen führen. Die Strafbarkeit dürfe nicht davon abhängen, welche konkrete Reaktion der Polizei der Täter möglicherweise erwartet oder wie die Polizei im Einzelfall vorgeht. Die Bewertung muss objektiv auf die Wirkung der geschaffenen Behinderung abstellen, nicht auf die subjektive Erwartung des Protestierenden oder die tatsächlich aufgewandte Kraft der Beamten.
Welche weiteren Schritte sind im Verfahren des festgeklebten Protestierenden geplant?
Aufgrund seiner anderslautenden Rechtsauffassung hob das Kammergericht das Freispruchsurteil des Amtsgerichts Tiergarten auf. Der Fall muss nun von einer anderen Abteilung des Amtsgerichts neu verhandelt und entschieden werden.
Das Kammergericht konnte nicht selbst eine Verurteilung aussprechen, da das Amtsgericht in seinem ursprünglichen Urteil nicht alle notwendigen Feststellungen zur sogenannten inneren Tatseite des Protestierenden getroffen hatte. Die „innere Tatseite“ bezieht sich auf die Absichten und den Vorsatz des Angeklagten. Da ein Revisionsgericht, wie das Kammergericht, keine eigenen Beweise erheben oder die Beweiswürdigung eines Gerichts unterer Instanz ersetzen kann, musste es den Fall an das Amtsgericht zurückverweisen.
In der neuen Verhandlung wird das Amtsgericht nun prüfen müssen, welche Absicht der Protestierende beim Kleben seiner Hand hatte und ob er den Widerstand gegen die Polizeibeamten tatsächlich bewusst in Kauf nahm. Auch die Anklage wegen Nötigung muss erneut geprüft werden, insbesondere die bereits erwähnte Verwerflichkeitsprüfung des Verhaltens. Das Amtsgericht muss dabei die vom Kammergericht aufgezeigten rechtlichen Grundsätze berücksichtigen.
Obwohl das Kammergericht von einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden abwich, sah es davon ab, den Fall dem Bundesgerichtshof zur endgültigen Klärung vorzulegen. Dies geschah, weil die abweichende Ansicht des OLG Dresden nicht die tragende Säule von dessen Entscheidung war und für eine verbindliche Klärung der Rechtsfrage noch gesicherte Feststellungen zur inneren Tatseite des Angeklagten fehlten. Somit liegt die Verantwortung für die weitere Aufklärung und Entscheidung dieses juristisch komplexen Falls nun wieder beim Amtsgericht Tiergarten.
Die Urteilslogik
Gerichte definieren Gewalt im Widerstandsdelikt weit und umfassen dabei auch mittelbare physische Hindernisse.
- Gewalt durch Hindernis: Eine Handlung stellt Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte dar, wenn sie eine Amtshandlung der Polizei durch das Schaffen erheblicher physischer Widerstände maßgeblich erschwert, selbst wenn diese Kräfte nicht direkt gegen die Beamten gerichtet sind.
- Objektive Behinderung zählt: Für die Strafbarkeit des Widerstands ist maßgeblich, welche Zwangslage der Täter objektiv schafft und wie sehr er dadurch eine Amtshandlung behindert, unabhängig von den konkret verwendeten Hilfsmitteln oder der erforderlichen Reaktion der Beamten.
- Grenzen der Revision: Ein Revisionsgericht überprüft rechtliche Fehler, darf aber keine eigenen Beweise erheben oder die Absicht des Täters beurteilen; es verweist den Fall bei fehlenden Tatsachenfeststellungen an die Vorinstanz zurück.
Diese Grundsätze betonen die differenzierte Auslegung des Gewaltbegriffs im Strafrecht und die strikten Kompetenzgrenzen der Gerichtsinstanzen.
Benötigen Sie Hilfe?
Wird Ihnen Widerstand durch Blockade oder Ankleben vorgeworfen? Erhalten Sie eine professionelle Ersteinschätzung Ihres Falles.
Das Urteil in der Praxis
Wie viel Risiko ist ein Protestierender bereit zu tragen? Dieses Urteil des Kammergerichts zerschlägt die Illusion der „passiven“ Blockade mittels Sekundenkleber eindrucksvoll. Es stellt klar, dass Adhäsionskräfte, die Beamte zu erheblichem Mehraufwand zwingen, sehr wohl als Gewalt im Sinne des Widerstandsparagraphen gelten. Für Aktivisten bedeutet das eine drastische Neubewertung ihrer Taktiken, denn der juristische Freibrief ist hiermit passé. Wer sich festklebt, muss künftig mit einem strafrechtlichen Festhalten rechnen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Warum gilt mein Festkleben auf der Fahrbahn als Gewalt?
Ihr Festkleben auf der Fahrbahn wird juristisch als Gewalt im Sinne des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gewertet. Die durch Sekundenkleber erzeugten Adhäsionskräfte bilden ein physisches Hindernis, das nur unter erheblichem Kraftaufwand oder speziellen Hilfsmitteln überwunden werden kann. Gerichte sehen darin eine mittelbare Kraftentfaltung gegen Amtshandlungen.
Das Strafrecht versteht unter dem Begriff „Gewalt“ mehr als einen direkten Stoß oder Schlag. Hier geht es um jeden physischen Zwang, der eine Amtshandlung verhindert oder erheblich erschwert. Juristen nennen dies eine „mittelbare Kraftentfaltung“. Die Adhäsionskräfte, die beim Festkleben entstehen, sind so stark, dass Polizeibeamte eine Person nicht einfach wegtragen können. Sie müssen entweder massive körperliche Kraft aufwenden oder chemische Lösungsmittel einsetzen. Genau diese Zwangslage, die Sie erzeugen, wird als Gewalt ausgelegt.
Stellen Sie sich vor, jemand verschließt eine Tür, um einem Gerichtsvollzieher den Zutritt zu verwehren. Auch das wird als „vorweggenommene tätige Handlung“ und somit als Gewalt interpretiert. Das Kammergericht Berlin bestätigte diese Rechtsauffassung kürzlich im Fall festgeklebter Protestierender: Für die Richter war entscheidend, dass die Polizei einen unverhältnismäßigen Aufwand betreiben musste, um die Blockade zu lösen. Die Art des verwendeten Hilfsmittels – Kleber statt eines festen Gegenstands – spielt dabei keine Rolle.
Dieser erweiterte Gewaltbegriff bedeutet: Unterschätzen Sie niemals die weitreichenden rechtlichen Konsequenzen scheinbar passiver Protestformen.
Kann ich wegen meines Festklebens auf der Fahrbahn angeklagt werden?
Ja, das Festkleben auf der Fahrbahn kann Sie direkt in ernsthafte rechtliche Schwierigkeiten bringen. Sie riskieren eine Anklage wegen Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, selbst wenn Ihre Absichten friedlich erscheinen. Gerichte bewerten das Blockieren des Verkehrs als Zwang und das Ankleben als Gewalt gegen polizeiliche Maßnahmen.
Der Grund? Das Kammergericht Berlin machte klare Vorgaben: Sekundenkleber auf Asphalt erzeugt enorme Adhäsionskräfte. Polizeibeamte können eine so fixierte Person nicht einfach wegtragen. Dieses erhebliche Hindernis, ob durch rohe Kraft oder den Einsatz chemischer Lösungsmittel überwindbar, gilt als Gewalt im Sinne des § 113 StGB. Eine Anklage wegen Nötigung (§ 240 StGB) kommt ebenso in Betracht, weil Sie andere Verkehrsteilnehmer zu einem ungewollten Verhalten zwingen.
Stellen Sie sich vor, der Verkehr steht still. Rettungsfahrzeuge kommen nicht durch. Das Amtsgericht mag im Einzelfall Freisprüche erteilen, doch die Staatsanwaltschaft scheut keine Sprungrevision, um eine Verurteilung zu erreichen. Diese juristischen Hürden sind hoch.
Wer sich festklebt, riskiert eine empfindliche Strafe.
Gilt mein Festkleben auf der Fahrbahn als Nötigung?
Ja, das Festkleben auf der Fahrbahn kann als Nötigung gelten, wenn Sie dadurch gezielt andere Verkehrsteilnehmer mit Gewalt oder Drohung zu einem unerwünschten Verhalten zwingen, etwa zum Anhalten oder zur Umleitung. Gerichte prüfen hierbei genau die Verwerflichkeit der angewandten Mittel und des beabsichtigten Zwecks. Eine pauschale Antwort ist dabei selten.
Juristen nennen das „Nötigung“ nach § 240 des Strafgesetzbuches. Es verlangt, dass jemand mit „Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel“ zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung gezwungen wird. Das Berliner Kammergericht beurteilte in einem viel beachteten Fall das Festkleben mit Sekundenkleber als eine Form der „Gewalt“ im Sinne des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die entstandenen Adhäsionskräfte verhinderten ein einfaches Wegtragen und zwangen die Polizei zu erheblichem Kraftaufwand oder dem Einsatz chemischer Mittel.
Doch die zentrale Frage bei der Nötigung bleibt die Verwerflichkeit: War die Behinderung des Verkehrs in Anbetracht des Protests zweckwidrig oder überzogen? Das Amtsgericht Tiergarten sprach den Angeklagten zunächst frei, sah diese Verwerflichkeit nicht gegeben. Die Staatsanwaltschaft legte Sprungrevision ein. Das Kammergericht hob den Freispruch auf und verwies den Fall zurück, um genau diese „innere Tatseite“ und die Verwerflichkeit des Verkehr blockierens erneut zu prüfen. Es ist ein Balanceakt zwischen Grundrechten und der Rechtmäßigkeit der Mittel.
Dokumentieren Sie stets die Umstände, aber wissen Sie: Gerichte bewerten jeden Fall einzeln.
Wie geht mein Fall nach einem Freispruch im Gericht weiter?
Ein Freispruch erster Instanz bedeutet keineswegs das Ende Ihres Verfahrens. In Deutschland kann die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel einlegen, wie eine Sprungrevision, wenn sie mit dem Urteil nicht einverstanden ist. Das übergeordnete Gericht prüft dann die rechtliche Bewertung und kann den Fall zur erneuten Verhandlung an eine andere Abteilung des ursprünglichen Gerichts zurückverweisen.
Warum diese zweite Runde? Das Revisionsgericht, etwa das Kammergericht in Berlin, prüft nicht, ob neue Fakten hinzukommen, sondern ob das Amtsgericht die Rechtslage korrekt angewendet und alle notwendigen Feststellungen getroffen hat. Gerade wenn wichtige Informationen zur „inneren Tatseite“ – also Absichten und Vorsatz des Angeklagten – fehlen, greift es ein.
Im Fall des mit Sekundenkleber festgeklebten Protestierenden geschah genau das. Das Amtsgericht Tiergarten sprach ihn frei. Doch die Staatsanwaltschaft legte Sprungrevision ein. Das Kammergericht hob diesen Freispruch auf und schickte den Fall zurück an das Amtsgericht. Der Grund: Es fehlte an Feststellungen zu seinem Vorsatz beim Blockieren der Straße.
Die Konsequenz für den Angeklagten? Er muss sich erneut vor Gericht verantworten, diesmal mit klaren Vorgaben des höheren Gerichts. Ein erstinstanzlicher Freispruch bedeutet also keine endgültige Entwarnung; eine Überprüfung durch höhere Instanzen ist immer möglich.
Was bedeutet meine Absicht im Festkleben für mein Urteil?
Ihre Absicht beim Festkleben, von Juristen auch als „innere Tatseite“ oder „Vorsatz“ bezeichnet, ist das Herzstück der strafrechtlichen Bewertung und für Ihr Urteil absolut entscheidend. Ohne diese Feststellungen kann kein Richter Sie verurteilen, selbst wenn der Akt des Festklebens als Gewalt gewertet wird. Das Gericht muss genau prüfen, ob Sie den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder eine Nötigung bewusst in Kauf nahmen.
Der Grund: Kein Gericht verurteilt blind. Für eine Straftat brauchen wir nicht nur die äußere Handlung, sondern auch den inneren Willen dazu. Ein Richter will wissen, ob Sie wirklich wollten, dass Polizisten an Ihnen scheitern, oder ob Sie das Blockieren des Verkehrs bewusst verursachen wollten.
Das Kammergericht Berlin machte genau das im Fall eines festgeklebten Protestierenden klar: Es kippte einen Freispruch, weil das Amtsgericht die Absicht des Angeklagten schlicht ignoriert hatte. Die bloße physische Behinderung reichte nicht aus. Das oberste Berliner Gericht verlangt eine tiefergehende Untersuchung des „Kopfes“ hinter der Klebeaktion. Diese „innere Tatseite“ wird in einer erneuten Verhandlung nun penibel untersucht. Nur so lässt sich beurteilen, wie schuldfähig Sie wirklich waren und ob die Vorwürfe von Widerstand oder Nötigung Bestand haben. Es geht um die Kernfrage Ihres Handelns.
Ihre bewusste Absicht beim Festkleben entscheidet maßgeblich über die Rechtsfolgen und die Frage der Strafbarkeit.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Gewalt (im Strafrecht)
Juristen verstehen unter Gewalt im Strafrecht jeden physischen Zwang, der dazu führt, dass sich jemand nicht wie gewollt verhalten kann oder eine Amtshandlung verhindert wird. Dieses erweiterte Verständnis schützt die Freiheit von Personen und die Handlungsfähigkeit staatlicher Organe vor subtileren Formen der Beeinträchtigung. Es sichert, dass nicht nur direkte Angriffe, sondern auch passive oder indirekte Behinderungen strafrechtlich erfasst werden.
Beispiel: Im vorliegenden Fall sah das Kammergericht das Festkleben des Protestierenden auf der Fahrbahn als Gewalt an, da die entstandenen Adhäsionskräfte die Arbeit der Polizeibeamten erheblich erschwerten.
Innere Tatseite
Die innere Tatseite beschreibt im Strafrecht die subjektiven Merkmale einer Straftat, also die Absichten, den Vorsatz oder die Fahrlässigkeit des Täters zum Zeitpunkt der Handlung. Dieses juristische Prinzip stellt sicher, dass nur jemand bestraft wird, der eine Tat bewusst oder fahrlässig begeht, nicht bloß zufällig oder unwissentlich. Das Gesetz legt großen Wert auf die Schuld des Einzelnen, um gerechte Urteile zu gewährleisten.
Beispiel: Da das Amtsgericht im Freispruchurteil keine ausreichenden Feststellungen zur inneren Tatseite des Protestierenden getroffen hatte, verwies das Kammergericht den Fall zur erneuten Verhandlung zurück.
Nötigung
Nötigung bezeichnet im Strafrecht das Erzwingen einer Handlung, Duldung oder Unterlassung bei einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel. Dieses Gesetz schützt die individuelle Willensfreiheit und Entscheidungsautonomie vor unrechtmäßigem Zwang. Es soll verhindern, dass Menschen gegen ihren Willen zu etwas gezwungen werden.
Beispiel: Der Protestierende wurde unter anderem wegen Nötigung angeklagt, da er durch das Festkleben auf der Fahrbahn andere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten zwang.
Sprungrevision
Eine Sprungrevision ist ein seltener Rechtsbehelf im Strafprozess, bei dem die eigentlich vorgesehene Berufungsinstanz übersprungen und ein Urteil des Amtsgerichts direkt durch das Revisionsgericht überprüft wird. Dieser besondere Rechtsweg dient dazu, Verfahren zu beschleunigen und Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung schneller einer höheren gerichtlichen Klärung zuzuführen. Es ist ein effizientes Instrument, wenn keine neuen Tatsachenfeststellungen, sondern nur Rechtsfragen zu klären sind.
Beispiel: Die Staatsanwaltschaft legte nach dem Freispruch des Amtsgerichts Tiergarten eine Sprungrevision ein, um das Urteil direkt durch das Kammergericht in Berlin überprüfen zu lassen.
Tateinheitlich
Wenn Juristen von tateinheitlich begangenen Delikten sprechen, meinen sie, dass eine einzelne Handlung oder mehrere Handlungen in einem engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang gleichzeitig mehrere Straftatbestände erfüllen. Dieses strafrechtliche Prinzip ermöglicht es, die volle Bandbreite der Rechtsverletzungen einer Tat abzubilden, ohne den Täter für jeden einzelnen Verstoß gesondert zu bestrafen, was zu einer unverhältnismäßigen Häufung von Strafen führen könnte. Es sorgt für eine angemessene Gesamtstrafe.
Beispiel: Die Staatsanwaltschaft sah die Nötigung und den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte als tateinheitlich begangen an, da beide Vorwürfe aus dem Akt des Festklebens des Protestierenden resultierten.
Verwerflichkeit
Die Verwerflichkeit ist ein zentrales Kriterium im Straftatbestand der Nötigung, das besagt, dass die angewandten Mittel oder der verfolgte Zweck moralisch anstößig oder sozialethisch missbilligenswert sein müssen, damit die Tat strafbar ist. Dieses Element dient als Filter, um Handlungen, die zwar objektiv eine Nötigung darstellen, aber in einem gesellschaftlich akzeptierten Rahmen liegen, von der Strafbarkeit auszunehmen. Es schützt Bagatellen und sozialadäquates Verhalten vor überzogener strafrechtlicher Verfolgung.
Beispiel: Das Amtsgericht Tiergarten sprach den Protestierenden zunächst frei, da es die Verwerflichkeit seines Handelns – das Blockieren des Verkehrs durch Festkleben – nicht als ausreichend für eine Nötigung ansah.
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
Juristen bezeichnen mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte die Straftat, wenn jemand eine rechtmäßige Amtshandlung, etwa die Festnahme oder Wegtragen durch Polizisten, mit Gewalt oder durch Drohung verhindert oder erheblich erschwert. Dieses Gesetz schützt die Funktionsfähigkeit des Staates und die Sicherheit seiner Bediensteten bei der Ausübung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Es soll sicherstellen, dass rechtmäßige Anweisungen und Maßnahmen der Polizei und anderer Beamter durchgesetzt werden können.
Beispiel: Der Protestierende wurde unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt, weil er sich mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn festklebte und so sein Wegtragen durch die Polizei massiv erschwerte.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 Abs. 1 StGB)
Dieser Paragraph stellt das Verhindern oder Erschweren einer Amtshandlung durch Gewalt oder Drohung unter Strafe.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Kammergericht beurteilte das Festkleben des Protestierenden an die Fahrbahn als Gewalt im Sinne dieses Paragraphen, da durch die entstandenen Adhäsionskräfte die polizeiliche Amtshandlung erheblich erschwert wurde.
- Nötigung und Verwerflichkeitsprüfung (§ 240 Abs. 1 und 2 StGB)
Nötigung ist das Erzwingen eines Verhaltens durch Gewalt oder Drohung, wobei die Art und Weise der Nötigung sozialethisch verwerflich sein muss.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Dieklage wegen Nötigung hing von der Verwerflichkeit des Klebens ab; das Amtsgericht sah diese zunächst nicht, muss dies aber nach der Zurückverweisung durch das Kammergericht erneut prüfen.
- Sprungrevision (§ 335 Abs. 1 StPO)
Eine Sprungrevision ermöglicht es der Staatsanwaltschaft, ein Urteil eines Amtsgerichts direkt vor dem Revisionsgericht anzufechten, ohne den Weg über die Berufungsinstanz zu nehmen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Dieses Verfahren ermöglichte es der Staatsanwaltschaft, den Freispruch des Amtsgerichts unmittelbar vom Kammergericht als Revisionsinstanz überprüfen zu lassen.
- Revisionsgerichtliche Prüfung und Zurückverweisung (Allgemeiner Rechtsgrundsatz)
Ein Revisionsgericht überprüft nur Rechtsfehler und kann keine eigenen neuen Tatsachenfeststellungen treffen, weshalb es einen Fall zur erneuten Tatsachenprüfung an ein Gericht der Vorinstanz zurückverweisen muss, wenn Feststellungen zur Absicht des Angeklagten fehlen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Da das Kammergericht als Revisionsgericht keine eigenen Feststellungen zur inneren Tatseite des Protestierenden treffen konnte, musste es den Fall zur erneuten Verhandlung an das Amtsgericht zurückverweisen.
Das vorliegende Urteil
KG Berlin – Az.: 3 ORs 22/25 – 161 SRs 2/25 – Urteil vom 02.06.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.