Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Gerichtsurteil: Kein Recht auf Akteneinsicht für Anzeigeerstatter bei Abrechnungsbetrug ohne unmittelbare Schädigung – § 406e StPO und der Verletztenbegriff
- Ausgangslage des Rechtsstreits: Ermittlungen wegen Abrechnungsbetrugs im Rehabilitationssport und verweigerte Akteneinsicht
- Der Kern des Konflikts: Ist der anzeigende Verein ein „Verletzter“ im Sinne der Strafprozessordnung?
- Die Entscheidung des Amtsgerichts Stade: Antrag auf Akteneinsicht zurückgewiesen
- Juristische Begründung: Die enge Auslegung des Verletztenbegriffs nach § 373b StPO
- Konsequenzen und Bedeutung der Gerichtsentscheidung: Klare Grenzen für Akteneinsichtsrechte von Anzeigeerstattern
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet „Verletzter“ im juristischen Sinne der Strafprozessordnung (StPO) und warum ist diese Definition entscheidend für das Recht auf Akteneinsicht?
- Unter welchen Voraussetzungen kann ein Verein, der eine Strafanzeige erstattet, Akteneinsicht in die Ermittlungsakte erhalten?
- Was bedeutet „Unmittelbare Schädigung“ im Kontext von Abrechnungsbetrug und warum ist dieser Aspekt für das Akteneinsichtsrecht relevant?
- Welche Rolle spielt das berechtigte Interesse bei der Beantragung von Akteneinsicht und wie wird dieses im Falle eines vermuteten Abrechnungsbetrugs bewertet?
- Welche Rechtsmittel stehen einem Anzeigeerstatter zur Verfügung, wenn ihm die Akteneinsicht verweigert wird und welche Erfolgsaussichten haben diese Rechtsmittel?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 34 Gs 143 Js 24725/24 (1039/25) | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Amtsgericht Stade
- Verfahrensart: Antrag auf gerichtliche Entscheidung
- Rechtsbereiche: Strafprozessrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Der Anzeigeerstatter B. e. V., vertreten durch seine erste Vorsitzende C. H., der Akteneinsicht in ein eingestelltes Ermittlungsverfahren begehrte und argumentierte, selbst durch die mutmaßliche Tat geschädigt worden zu sein.
- Beklagte: Die Staatsanwaltschaft S., deren Ablehnung eines Akteneinsichtsgesuchs Gegenstand des Antrags war.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges gegen eine GmbH, da diese angeblich nicht lizenzierte Übungsleiter eingesetzt und gegenüber Krankenkassen abgerechnet hatte. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt und ein Akteneinsichtsgesuch des Anzeigeerstatters abgelehnt.
- Kern des Rechtsstreits: Die zentrale juristische Frage war, ob der Anzeigeerstatter als „Verletzter“ im Sinne der Strafprozessordnung gilt und somit ein Recht auf Akteneinsicht in das eingestellte Ermittlungsverfahren hat.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Amtsgericht Stade wies den Antrag des Anzeigeerstatters auf gerichtliche Entscheidung zurück. Damit bestätigte es, dass die Staatsanwaltschaft das Akteneinsichtsgesuch des Anzeigeerstatters zu Recht abgelehnt hatte.
- Begründung: Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass nur Personen, die durch eine Tat unmittelbar in ihren Rechtsgütern beeinträchtigt sind oder einen unmittelbaren Schaden erlitten haben, als „Verletzte“ gelten. Die angezeigte Tat (Abrechnungsbetrug) würde die Krankenkassen als direkte Geschädigte betreffen. Die vom Anzeigeerstatter geltend gemachten Schäden wurden als mittelbar eingestuft und begründen daher keine Eigenschaft als „Verletzter“ im Sinne der Strafprozessordnung.
- Folgen: Für den Anzeigeerstatter bedeutet dies, dass ihm die Akteneinsicht in das eingestellte Ermittlungsverfahren verwehrt bleibt, da er nicht als unmittelbar Betroffener des mutmaßlichen Betruges anerkannt wurde.
Der Fall vor Gericht
Gerichtsurteil: Kein Recht auf Akteneinsicht für Anzeigeerstatter bei Abrechnungsbetrug ohne unmittelbare Schädigung – § 406e StPO und der Verletztenbegriff
Ein aktuelles Urteil des Amtsgerichts Stade hat wichtige Klarstellungen zur Frage des Akteneinsichtsrechts für Anzeigeerstatter in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren getroffen. Im Kern ging es darum, ob ein Verein, der eine Strafanzeige wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs im Bereich Rehabilitationssport erstattet und eigene wirtschaftliche Nachteile geltend macht, als „Verletzter“ im Sinne der Strafprozessordnung (StPO) gilt und somit Einsicht in die Ermittlungsakten verlangen kann, nachdem das Verfahren eingestellt wurde. Das Gericht verneinte dies und betonte die Notwendigkeit einer unmittelbaren Schädigung durch die Straftat.
Ausgangslage des Rechtsstreits: Ermittlungen wegen Abrechnungsbetrugs im Rehabilitationssport und verweigerte Akteneinsicht
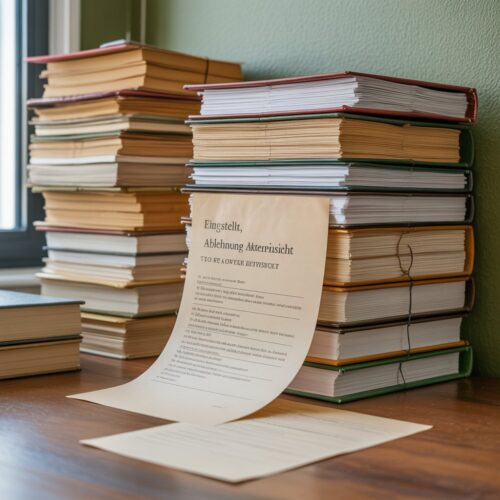
Den Anlass für das gerichtliche Verfahren bildete eine Strafanzeige eines eingetragenen Vereins, vertreten durch seine erste Vorsitzende. Dieser Verein, im Folgenden als der anzeigende Verein bezeichnet, hatte bei der Staatsanwaltschaft S. Anzeige gegen die Verantwortlichen einer GmbH erstattet, die eine Sport- und Freizeiteinrichtung betreibt (nachfolgend die Betreibergesellschaft). Der Vorwurf lautete auf Abrechnungsbetrug zum Nachteil von Krankenkassen. Konkret beschuldigte der anzeigende Verein die Betreibergesellschaft, eine bestimmte Zeugin als Übungsleiterin für Rehabilitationssportgruppen und Funktionstraining eingesetzt und diese Leistungen gegenüber den Krankenkassen abgerechnet zu haben, obwohl die Übungsleiterin hierfür angeblich nicht die notwendige Lizenz besaß. Diese Lizenz, so der Vorwurf, sei erst deutlich später beantragt worden. Nach Darstellung des anzeigenden Vereins dürfe eine Abrechnung mit den Krankenkassen jedoch nur erfolgen, wenn der Rehabilitationssport von lizenzierten Übungsleitern durchgeführt werde.
Die Staatsanwaltschaft S. leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren unter dem Aktenzeichen 34 Gs 143 Js 24725/24 ein. Im Zuge dieser Ermittlungen holte sie Auskünfte bei verschiedenen Stellen, darunter einer Krankenkasse (A.) und einer weiteren Institution (D.), ein und vernahm die beschuldigte Übungsleiterin als Zeugin. Am 22. August 2024 stellte der anzeigende Verein einen Antrag auf Akteneinsicht. Diesem Antrag widersprach ein Vertreter der Betreibergesellschaft am 26. November 2024.
Nach Anhörung der Krankenkasse A. gemäß Nr. 90 der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) teilte die Staatsanwaltschaft am 28. November 2024 ihre Absicht mit, das Ermittlungsverfahren gemäß § 170 Abs. 2 StPO einzustellen. Als Begründung wurde angeführt, dass sich jedenfalls kein Vorsatz bezüglich einer Täuschung und einer unrechtmäßigen Bereicherung nachweisen lasse. Nachdem die Krankenkasse A. dieser Vorgehensweise bis zum 8. Januar 2025 nicht widersprochen hatte, verfügte die Staatsanwaltschaft S. am 10. Januar 2025 tatsächlich die Einstellung des Verfahrens. Gleichzeitig wies sie den Antrag auf Akteneinsicht des anzeigenden Vereins zurück. Die Begründung hierfür war, dass der Verein nicht als „Verletzter“ im Sinne des § 373b StPO bzw. § 172 StPO anzusehen sei.
Der Kern des Konflikts: Ist der anzeigende Verein ein „Verletzter“ im Sinne der Strafprozessordnung?
Gegen diese Ablehnung seines Akteneinsichtsgesuchs legte der anzeigende Verein mit Schreiben vom 21. März 2025 einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung beim Amtsgericht Stade ein. In seiner Begründung führte der Verein aus, warum er ein Berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht habe und als Verletzter anzusehen sei. Er sei selbst ein anerkannter Leistungserbringer für Rehabilitationssport und Funktionstraining gemäß § 64 SGB IX und biete seit 2010 entsprechende Kurse in den Räumlichkeiten an, die von der Betreibergesellschaft unterhalten werden.
Der Verein trug vor, dass ihm durch die Betreibergesellschaft zahlreiche Nutzungszeiten für seine Kurse entzogen und der Zugang zu einem wichtigen Aktivbecken vollständig verwehrt worden seien. Hierdurch sei ihm ein existenzbedrohender wirtschaftlicher Schaden entstanden. Darüber hinaus argumentierte der Verein, dass die Betreibergesellschaft durch den mutmaßlichen Einsatz einer nicht lizenzierten Übungsleiterin eine unlautere wirtschaftliche Konkurrenzsituation geschaffen habe. Durch dieses Vorgehen sei er, der anzeigende Verein, zumindest mittelbar geschädigt worden. Aus dieser mittelbaren Schädigung leitete der Verein seine Verletzteneigenschaft und somit sein Recht auf Akteneinsicht ab, um die genauen Umstände der Verfahrenseinstellung nachvollziehen zu können.
Die Entscheidung des Amtsgerichts Stade: Antrag auf Akteneinsicht zurückgewiesen
Das Amtsgericht Stade wies den Antrag des anzeigenden Vereins auf gerichtliche Entscheidung vom 21. März 2025 mit seiner aktuellen Entscheidung zurück. Das Gericht stellte fest, dass die Staatsanwaltschaft S. mit ihrer Verfügung vom 10. Januar 2025 das Akteneinsichtsgesuch des Vereins zu Recht abgelehnt hatte. Der anzeigende Verein hat somit keinen Anspruch auf Einsicht in die Ermittlungsakten.
Juristische Begründung: Die enge Auslegung des Verletztenbegriffs nach § 373b StPO
Das Amtsgericht Stade stützte seine Entscheidung auf eine detaillierte juristische Prüfung der Voraussetzungen für ein Akteneinsichtsrecht.
Zunächst stellte das Gericht fest, dass der Antrag auf gerichtliche Entscheidung formal zulässig war, wie es § 406e Abs. 5 Satz 2 StPO vorsieht. Inhaltlich drehte sich jedoch alles um die Auslegung des § 406e Abs. 1 StPO. Diese Vorschrift regelt, dass ein Rechtsanwalt für den Verletzten einer Straftat Einsicht in die Akten nehmen kann, sofern der Verletzte hierfür ein berechtigtes Interesse darlegt. Die entscheidende Frage war demnach, ob der anzeigende Verein im konkreten Fall als „Verletzter“ im Sinne dieser Norm zu qualifizieren ist.
Das Gericht verwies hierzu auf die Legaldefinition des Verletztenbegriffs in § 373b Abs. 1 StPO. Gemäß dieser Vorschrift sind Verletzte diejenigen Personen oder Institutionen, „die durch die Tat, ihre Begehung unterstellt oder rechtskräftig festgestellt, in ihren Rechtsgütern unmittelbar beeinträchtigt sind oder unmittelbar einen Schaden erlitten haben.“
Die entscheidende Rolle der „Unmittelbarkeit“ der Schädigung für den Verletztenstatus
Das Amtsgericht Stade hob hervor, dass das Gesetz zwingend eine unmittelbare Beeinträchtigung oder einen unmittelbaren Schaden fordert. Eine solche Unmittelbarkeit liegt nach gefestigter juristischer Auffassung dann vor, wenn sich der eingetretene Schaden oder die Beeinträchtigung eines Rechtsguts als direkte Folge der untersuchten Straftat darstellt. Der Schaden muss mit der Tat einhergehen, und es muss sich gerade der tatbestandsspezifische Zusammenhang realisiert haben. Das bedeutet, die Gefahr, die dem jeweiligen Straftatbestand innewohnt (beispielsweise beim Betrug die Gefahr eines Vermögensschadens durch Täuschung), muss sich gerade im Eintritt des Schadens oder der Beeinträchtigung des Rechtsguts niedergeschlagen haben.
Anwendung auf den vorliegenden Fall des mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs
Bei der Anwendung dieser Grundsätze auf den konkreten Sachverhalt kam das Gericht zu dem Schluss, dass der anzeigende Verein unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt als unmittelbar Geschädigter des mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs angesehen werden kann.
Direkter Schaden durch mutmaßlichen Abrechnungsbetrug ausschließlich bei Krankenkassen
Das Gericht führte aus, dass die dem Grunde nach vorgeworfene Tat – also der Einsatz und die Abrechnung von Rehabilitationssport durch eine nicht lizenzierte Übungsleiterin gegenüber den Krankenkassen – ausschließlich die Krankenkassen als Geschädigte betreffen würde, sofern sich der Betrugsvorwurf hätte bestätigen lassen. Die Krankenkassen wären diejenigen, die einen direkten Vermögensschaden erlitten hätten, indem sie Kosten für Leistungen erstattet hätten, die möglicherweise nicht den vertraglich vereinbarten und gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsstandards (hier: erforderliche Lizenz der Übungsleiterin) entsprachen. Der finanzielle Schaden wäre in einem solchen Betrugsfall ausschließlich bei der jeweils die Erstattung übernehmenden Krankenkasse eingetreten.
Vom Verein geltend gemachte Schäden als lediglich mittelbare Folgen des mutmaßlichen Betrugs
Die vom anzeigenden Verein vorgetragenen eigenen Schäden – wie der Entzug von Hallenzeiten, die Verwehrung des Zugangs zum Aktivbecken, der daraus resultierende existenzbedrohende Schaden und die Verhinderung fairer wirtschaftlicher Konkurrenz durch das Vorgehen der Betreibergesellschaft – wurden vom Gericht als mittelbare Schäden qualifiziert. Das Gericht merkte zudem an, dass nicht einmal ersichtlich sei, ob diese Schäden tatsächlich in der behaupteten Form eingetreten seien. Selbst wenn man dies jedoch unterstellen würde, handelte es sich dabei nicht um direkte Folgen des angezeigten Abrechnungsbetrugs gegenüber den Krankenkassen, sondern allenfalls um Reflexwirkungen oder Folgeschäden aus einem möglicherweise unlauteren Wettbewerbsverhalten oder vertraglichen Auseinandersetzungen zwischen dem Verein und der Betreibergesellschaft.
Ein solcher mittelbarer Schaden, so betonte das Gericht, begründet jedoch nach dem klaren und eindeutigen Wortlaut des § 373b Abs. 1 StPO gerade keine Verletzteneigenschaft. Die Norm erfordert explizit eine unmittelbare Betroffenheit.
Konsequenzen und Bedeutung der Gerichtsentscheidung: Klare Grenzen für Akteneinsichtsrechte von Anzeigeerstattern
Da der anzeigende Verein nach der überzeugenden Darlegung des Amtsgerichts Stade nicht als Verletzter im Sinne des § 406e Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 373b Abs. 1 StPO anzusehen ist, hatte die Staatsanwaltschaft S. das Akteneinsichtsgesuch zu Recht abgelehnt. Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung war somit unbegründet und musste zurückgewiesen werden.
Dieses Urteil unterstreicht die strenge Auslegung des Verletztenbegriffs im deutschen Strafprozessrecht, insbesondere im Kontext des Akteneinsichtsrechts. Es macht deutlich, dass nicht jeder, der durch eine Straftat möglicherweise wirtschaftliche Nachteile erleidet oder sich in seinen Interessen beeinträchtigt fühlt, automatisch als „Verletzter“ mit den damit verbundenen prozessualen Rechten, wie dem Recht auf Akteneinsicht, gilt. Die Unmittelbarkeit der Schädigung ist ein entscheidendes Kriterium. Anzeigeerstatter, die selbst nicht direkt durch die angezeigte Tat, sondern allenfalls mittelbar – beispielsweise durch Wettbewerbsverzerrungen oder vertragliche Schwierigkeiten, die im Umfeld der Tat entstehen – betroffen sind, haben demnach in der Regel keinen Anspruch auf Einsicht in die Ermittlungsakten. Diese Differenzierung dient auch dem Schutz der Rechte der Beschuldigten und der Wahrung der Effizienz des Ermittlungsverfahrens, indem der Kreis der Akteneinsichtsberechtigten klar definiert und begrenzt wird.
Die Schlüsselerkenntnisse
Der Kernpunkt des Urteils ist, dass nur unmittelbar Geschädigte als „Verletzte“ im Sinne der Strafprozessordnung gelten und somit Akteneinsicht beantragen können. In diesem Fall wurde dem anzeigenden Verein die Akteneinsicht verweigert, da er durch den mutmaßlichen Abrechnungsbetrug gegenüber Krankenkassen nur mittelbar geschädigt war. Die wirtschaftlichen Nachteile des Vereins (verlorene Hallenzeiten, verschlechterte Wettbewerbsposition) reichen nicht aus, um als unmittelbar Geschädigter zu gelten. Das Urteil schafft Klarheit über die Grenzen des Akteneinsichtsrechts und verdeutlicht, dass nicht jeder Anzeigeerstatter automatisch Zugang zu Ermittlungsakten erhält.
Befinden Sie sich in einer ähnlichen Situation? Fragen Sie unsere Ersteinschätzung an.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet „Verletzter“ im juristischen Sinne der Strafprozessordnung (StPO) und warum ist diese Definition entscheidend für das Recht auf Akteneinsicht?
Im juristischen Sinne der Strafprozessordnung (StPO) ist ein „Verletzter“ eine Person, deren eigene, rechtlich geschützte Interessen durch eine Straftat unmittelbar beeinträchtigt wurden. Dies bedeutet, dass die Straftat direkt gegen sie oder ihr Eigentum gerichtet war und sie dadurch einen Schaden erlitten hat. Rechtlich geschützte Interessen, auch „Rechtsgüter“ genannt, können vielfältig sein, wie zum Beispiel die körperliche Unversehrtheit, die Gesundheit, das Eigentum, die Ehre oder die Freiheit.
Wer gilt als „Verletzter“?
Als „Verletzter“ gilt man, wenn man direktes Opfer einer Straftat ist. Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Sie sind der direkte Eigentümer des Fahrrades und Ihr Eigentum wurde durch den Diebstahl unmittelbar beeinträchtigt. Oder Sie werden körperlich angegriffen; dann wurde Ihre körperliche Unversehrtheit direkt verletzt. In diesen Fällen sind Sie „Verletzter“ im Sinne der StPO. Es geht darum, dass die Straftat unmittelbar Ihre eigenen Rechte oder Güter betrifft.
Der entscheidende Unterschied: Direkt vs. Indirekt betroffen
Die Definition des „Verletzten“ hängt entscheidend davon ab, ob Sie direkt oder nur indirekt von einer Straftat betroffen sind.
- Direkt betroffen ist man, wenn die Straftat die eigenen Rechtsgüter unmittelbar schädigt. Der Geschädigte ist hier das unmittelbare Ziel der Tat oder die Person, deren Rechtsgüter die Tat direkt trifft.
- Indirekt betroffen sind Personen, die zwar unter den Folgen einer Straftat leiden, aber nicht selbst das direkte Opfer der Tat sind und deren eigene Rechtsgüter nicht unmittelbar durch die Straftat verletzt wurden. Wenn zum Beispiel Ihr Nachbar Opfer eines Betruges wird und dadurch finanzielle Schwierigkeiten bekommt, die sich auch auf Ihre gemeinsame Unternehmung auswirken, sind Sie zwar indirekt betroffen, aber nicht der „Verletzte“ des Betruges an Ihrem Nachbarn.
Warum ist diese Definition für die Akteneinsicht so wichtig?
Die Definition des „Verletzten“ ist ausschlaggebend für das Recht auf Akteneinsicht in Strafverfahren. Die Strafprozessordnung gewährt dem „Verletzten“ ein besonderes Recht, die Ermittlungsakten einzusehen. Dieses Recht ist extrem wichtig, weil es dem Verletzten ermöglicht:
- Verständnis des Verfahrens: Einblick in die gesammelten Beweismittel, Zeugenaussagen und Ermittlungsergebnisse zu erhalten. Man versteht, was in dem Fall ermittelt wurde.
- Vorbereitung zivilrechtlicher Ansprüche: Informationen zu sammeln, die für mögliche zivilrechtliche Forderungen (z.B. auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld) gegen den Täter wichtig sein könnten.
- Stärkung der eigenen Position: Fundierte Entscheidungen über eine mögliche Beteiligung am Strafverfahren, etwa als Nebenkläger, zu treffen.
Nur wer als „Verletzter“ im Sinne der StPO anerkannt ist, hat in der Regel dieses wichtige Recht auf Akteneinsicht. Personen, die lediglich indirekt von einer Straftat betroffen sind, haben dieses Akteneinsichtsrecht üblicherweise nicht.
Unter welchen Voraussetzungen kann ein Verein, der eine Strafanzeige erstattet, Akteneinsicht in die Ermittlungsakte erhalten?
Wenn ein Verein eine Strafanzeige erstattet, agiert er zunächst als Anzeigeerstatter. Dies ist jeder, der eine Straftat zur Kenntnis der Ermittlungsbehörden bringt. Die Erstattung einer Strafanzeige allein begründet kein automatisches Recht auf Akteneinsicht in die Ermittlungsakte. Die Akteneinsicht ist an bestimmte, gesetzlich festgelegte Voraussetzungen gebunden.
Die entscheidende Rolle des „Verletzten“
Für einen Verein, der Akteneinsicht in eine Ermittlungsakte erhalten möchte, ist entscheidend, ob er im strafrechtlichen Sinne als „Verletzter“ der Straftat gilt. Ein Verein ist dann ein „Verletzter“, wenn er durch die Straftat unmittelbar und rechtswidrig in eigenen Rechten oder Interessen verletzt wurde.
- Beispiele, wann ein Verein „Verletzter“ sein kann:
- Der Verein wurde selbst Opfer einer Betrugsmasche und hat dadurch finanzielle Schäden erlitten.
- Eigentum des Vereins wurde beschädigt oder gestohlen (z.B. Einbruch in Vereinsräume).
- Der Verein wurde durch üble Nachrede oder Verleumdung direkt in seiner Ehre oder seinem Ruf geschädigt.
- Beispiele, wann ein Verein in der Regel nicht als „Verletzter“ gilt:
- Der Verein erstattet Anzeige wegen einer Umweltstraftat, die allgemein die Natur betrifft, aber nicht direkt das Eigentum oder konkrete Rechte des Vereins verletzt hat.
- Der Verein zeigt eine allgemeine Ordnungswidrigkeit an, die keine direkten Auswirkungen auf ihn hat.
Der Weg zur Akteneinsicht als „Verletzter“
Ist der Verein als „Verletzter“ anzusehen, kann er grundsätzlich Akteneinsicht beantragen. Die Entscheidung über die Akteneinsicht trifft die Staatsanwaltschaft oder das Gericht. Bei ihrer Entscheidung wägen die Behörden das Informationsinteresse des Vereins gegen andere wichtige Interessen ab.
Die Akteneinsicht kann zum Beispiel abgelehnt werden, wenn sie:
- Die laufenden Ermittlungen gefährden würde.
- Das Leben oder die Gesundheit einer Person in Gefahr bringen könnte.
- Andere wichtige und schutzwürdige Interessen beeinträchtigen würde.
Für einen Verein bedeutet dies, dass die Erstattung einer Strafanzeige allein noch keinen Anspruch auf Akteneinsicht begründet. Der Verein muss vielmehr aufzeigen können, dass er durch die angezeigte Straftat selbst direkt geschädigt wurde und somit den Status eines „Verletzten“ im strafrechtlichen Sinne hat. Nur dann können die Behörden eine Akteneinsicht in Betracht ziehen.
Was bedeutet „Unmittelbare Schädigung“ im Kontext von Abrechnungsbetrug und warum ist dieser Aspekt für das Akteneinsichtsrecht relevant?
Im Zusammenhang mit Abrechnungsbetrug bedeutet „unmittelbare Schädigung“, dass der Schaden direkt und als sofortige Folge des betrügerischen Handelns bei einer Person oder Einrichtung eintritt. Es besteht eine geradlinige Verbindung zwischen der falschen Abrechnung und dem finanziellen Verlust. Der Geschädigte ist derjenige, der direkt von der Täuschung betroffen ist und dem dadurch unmittelbar ein Nachteil entsteht.
Unmittelbare versus mittelbare/indirekte Schädigung
Um den Unterschied zu verdeutlichen:
- Eine unmittelbare Schädigung liegt vor, wenn das Geld oder der Wert direkt aufgrund der betrügerischen Abrechnung von der betrogenen Person oder Einrichtung abfließt. Stellen Sie sich vor, jemand reicht eine falsche Rechnung ein, und eine Versicherung zahlt daraufhin diesen falschen Betrag direkt an den Betrüger aus. Die Versicherung ist hier unmittelbar geschädigt.
- Eine mittelbare oder indirekte Schädigung entsteht hingegen nicht als direkte Folge der Betrugshandlung selbst, sondern erst durch weitere Zwischenschritte oder als allgemeine, schwer zu beziffernde Auswirkung. Wenn beispielsweise der Betrug einer Krankenkasse letztlich zu höheren Beiträgen für alle Versicherten führt, wäre die Schädigung der einzelnen Versicherten als mittelbar anzusehen. Sie sind nicht direkt die Adressaten der betrügerischen Rechnung, sondern ihr Schaden entsteht indirekt über das System der Beitragszahlungen.
Beispiele für unmittelbare Schädigung bei Abrechnungsbetrug:
- Eine Krankenversicherung zahlt aufgrund einer nicht erbrachten oder überteuerten Leistung, die ihr gegenüber abgerechnet wurde, zu Unrecht Gelder aus. Die Versicherung ist der unmittelbar Geschädigte.
- Ein Patient, der eine Behandlung direkt aus eigener Tasche bezahlt hat und feststellt, dass die abgerechnete Leistung entweder gar nicht oder nur teilweise erbracht wurde, ist ebenfalls unmittelbar geschädigt, da sein Geld direkt durch die betrügerische Abrechnung verloren ging.
- Eine Behörde, die Fördermittel auf Basis falscher Angaben bewilligt und auszahlt, ist unmittelbar geschädigt.
Relevanz für das Akteneinsichtsrecht
Die Feststellung einer „unmittelbaren Schädigung“ ist entscheidend für das Akteneinsichtsrecht in Strafverfahren, insbesondere im Kontext von Abrechnungsbetrug.
Wer durch eine Straftat unmittelbar geschädigt wurde, gilt im Strafrecht als „Verletzter“ der Straftat. Dieser Status gewährt dem Verletzten bestimmte Rechte im Strafverfahren. Eines der wichtigsten Rechte ist das Akteneinsichtsrecht.
Für Sie als potenziell Betroffenen bedeutet das: Wenn Sie unmittelbar durch den Abrechnungsbetrug geschädigt wurden – also direkt Geld verloren haben, das Ihnen von den Betrügern aufgrund einer falschen Abrechnung entzogen wurde – haben Sie in der Regel das Recht, die Ermittlungsakten einzusehen. Dieses Recht ermöglicht es Ihnen, sich über den Stand der Ermittlungen zu informieren, die Beweislage zu verstehen und zu erkennen, welche Informationen über den Fall vorliegen. Dies kann für Sie von großer Bedeutung sein, um gegebenenfalls zivilrechtliche Ansprüche auf Schadensersatz gegen die Täter vorzubereiten und durchzusetzen.
Ohne die unmittelbare Schädigung, also wenn Sie nur indirekt oder als Teil einer größeren Gruppe betroffen wären, stünden Ihnen diese speziellen Rechte, wie das Akteneinsichtsrecht als Verletzter, in der Regel nicht zu.
Welche Rolle spielt das berechtigte Interesse bei der Beantragung von Akteneinsicht und wie wird dieses im Falle eines vermuteten Abrechnungsbetrugs bewertet?
Bei der Akteneinsicht in ein Strafverfahren ist das berechtigte Interesse ein wichtiger Begriff, der es Personen ermöglicht, Einblick in die Ermittlungsakten zu erhalten, obwohl sie nicht direkt als „Verletzte“ oder Beschuldigte in dem Fall auftreten. Es unterscheidet sich grundlegend von der Stellung eines „Verletzten“.
Berechtigtes Interesse im Vergleich zum Verletzten
Ein „Verletzter“ ist jemand, der durch eine Straftat unmittelbar in seinen Rechten beeinträchtigt wurde – zum Beispiel als Opfer eines Diebstahls, Körperverletzung oder eben als direkt geschädigtes Unternehmen oder Person bei einem Betrug. Verletzte haben in der Regel einen umfassenden Anspruch auf Akteneinsicht, um ihre eigenen Ansprüche (z.B. zivilrechtliche Schadensersatzforderungen) vorbereiten zu können.
Das „berechtigte Interesse“ hingegen betrifft Personen, die nicht direkt durch die Straftat geschädigt wurden, aber dennoch einen nachvollziehbaren, rechtlich schutzwürdigen Grund für die Akteneinsicht haben. Hier geht es darum, die eigenen Rechte und Interessen in einem anderen Zusammenhang zu schützen, zu verteidigen oder zu verfolgen, die mit dem Strafverfahren in Verbindung stehen. Es darf sich dabei nicht um bloße Neugier handeln.
Kriterien für die Bewertung eines berechtigten Interesses
Ob ein berechtigtes Interesse vorliegt, wird von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht im Einzelfall geprüft. Dabei werden verschiedene Kriterien berücksichtigt:
- Der Zweck der Akteneinsicht: Wofür wird die Akteneinsicht benötigt? Muss die Person eigene rechtliche Schritte vorbereiten, sich gegen Vorwürfe verteidigen oder eine eigene rechtliche Position klären, die durch das Strafverfahren beeinflusst wird?
- Die Art der Verbindung zum Verfahren: Gibt es eine unmittelbare oder mittelbare Beziehung der Person zum Gegenstand des Strafverfahrens? Zum Beispiel als Zeuge, als jemand, dessen Geschäftsbeziehungen betroffen sind, oder dessen Ruf durch das Verfahren beeinträchtigt werden könnte.
- Das Schutzbedürfnis der Person: Wie stark ist das Bedürfnis der Person, durch die Akteneinsicht ihre eigenen Rechte zu wahren oder Schaden abzuwenden?
- Die Abwägung mit entgegenstehenden Interessen: Das Interesse der Person an Akteneinsicht wird immer gegen andere wichtige Interessen abgewogen. Dazu gehören zum Beispiel das Geheimhaltungsinteresse Dritter (Datenschutz, Privatsphäre), das Interesse der Ermittlungsbehörden an einem ungestörten Verfahrensablauf oder das Interesse des Beschuldigten an der Vertraulichkeit der Ermittlungen.
Bewertung bei vermutetem Abrechnungsbetrug
Im Falle eines vermuteten Abrechnungsbetrugs kann ein berechtigtes Interesse an Akteneinsicht vorliegen, wenn die Person in irgendeiner Weise von den Auswirkungen des Betrugs betroffen ist oder sein könnte, auch wenn sie nicht die direkte geschädigte Partei (Verletzter) ist.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil einer Gemeinschaftspraxis, in der einem Kollegen Abrechnungsbetrug vorgeworfen wird. Auch wenn die Krankenkasse der direkte „Verletzte“ ist, könnten Sie als Partner in der Praxis ein berechtigtes Interesse an Akteneinsicht haben, weil:
- Ihr eigener Ruf oder der Ruf der Praxis beeinträchtigt ist.
- Sie zivilrechtliche Ansprüche gegen den Beschuldigten prüfen müssen, die sich aus dem Betrug ergeben.
- Sie Ihre eigene Rolle oder Haftung innerhalb der Praxis klären müssen.
- Sie sich gegen indirekte Vorwürfe oder Konsequenzen verteidigen müssen, die sich aus der Ermittlung gegen den Kollegen ergeben.
Ein bloßes Interesse daran, wie der Fall ausgeht, oder eine allgemeine Neugier auf die Details des Betruges reicht jedoch nicht aus. Es muss immer ein konkreter, rechtlich relevanter Grund bestehen, der über das allgemeine Informationsinteresse hinausgeht. Die Entscheidung liegt letztlich im Ermessen der zuständigen Behörde, die eine sorgfältige Abwägung aller beteiligten Interessen vornimmt.
Welche Rechtsmittel stehen einem Anzeigeerstatter zur Verfügung, wenn ihm die Akteneinsicht verweigert wird und welche Erfolgsaussichten haben diese Rechtsmittel?
Akteneinsicht: Wann und für wen?
Wenn Sie als Bürgerin oder Bürger eine Straftat zur Anzeige bringen, werden Sie zum sogenannten Anzeigeerstatter. Dies ist die Person, die die Ermittlungen angestoßen hat. Sie haben möglicherweise ein Interesse daran, zu erfahren, was mit Ihrer Anzeige geschieht, oder möchten später die Akten einsehen. Es ist wichtig zu wissen, dass das Recht auf Akteneinsicht nicht für jeden Beteiligten gleich ist. Es ist primär für den Beschuldigten und dessen Rechtsbeistand vorgesehen.
Für Anzeigeerstatter besteht ein Recht auf Akteneinsicht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Oftmals sind Sie als Anzeigeerstatter gleichzeitig der Verletzte einer Straftat, also die Person, die direkt durch die Tat betroffen wurde. In diesem Fall haben Sie erweiterte Rechte. Aber selbst dann ist Akteneinsicht nur möglich, wenn Sie ein berechtigtes Interesse an der Einsicht haben und diese die laufenden Ermittlungen nicht gefährdet oder die schutzwürdigen Interessen anderer Personen (wie etwa Zeugen oder anderer Betroffener) verletzt. Die Staatsanwaltschaft ist die Behörde, die über Ihren Antrag auf Akteneinsicht entscheidet. Wird Ihr Antrag abgelehnt, stehen Ihnen bestimmte Wege offen, dies überprüfen zu lassen.
Das erste Rechtsmittel: Die Beschwerde
Wird Ihr Antrag auf Akteneinsicht von der Staatsanwaltschaft abgelehnt, ist der erste Schritt, den Sie unternehmen können, eine Beschwerde gegen diese Entscheidung einzulegen.
- Was ist eine Beschwerde? Eine Beschwerde ist ein formeller Einspruch gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Sie sollten die Beschwerde in der Regel schriftlich bei der Staatsanwaltschaft einreichen, die Ihren Antrag auf Akteneinsicht abgelehnt hat. Diese Staatsanwaltschaft wird dann die Beschwerde prüfen und, falls sie ihre Meinung nicht ändert, an die nächsthöhere Instanz weiterleiten.
- Wer entscheidet über die Beschwerde? Die Beschwerde wird von der Generalstaatsanwaltschaft überprüft. Diese höhere Behörde prüft erneut, ob die Ablehnung der Akteneinsicht gerechtfertigt war. Sie bewertet, ob Ihr berechtigtes Interesse ausreichend berücksichtigt wurde und ob die Gründe für die Ablehnung, wie beispielsweise eine mögliche Gefährdung der Ermittlungen oder der Schutz der Privatsphäre Dritter, tatsächlich gegeben sind.
- Fristen und Formalitäten: Für die Einlegung dieser Art von Beschwerde gibt es keine strikte gesetzliche Frist, wie man sie beispielsweise von anderen Gerichtsverfahren kennt. Es ist jedoch dringend zu empfehlen, die Beschwerde unverzüglich – also ohne unnötige Verzögerung – einzulegen, sobald Sie die Ablehnung erhalten haben. Die Beschwerde sollte schriftlich erfolgen und klar darlegen, warum Sie die Entscheidung der Staatsanwaltschaft für nicht korrekt halten und welche Gründe Ihrer Meinung nach für die Akteneinsicht sprechen.
Wenn die Beschwerde scheitert: Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung
Sollte Ihre Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft keinen Erfolg haben, kann in bestimmten Fällen der Weg zu einem Gericht führen. Dies geschieht durch einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung.
- Wann ist dieser Antrag relevant? Dieser Antrag ist vor allem dann von Bedeutung, wenn die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten eingestellt hat. Das bedeutet, die Staatsanwaltschaft hat entschieden, dass keine Anklage erhoben wird. Wenn Sie als Anzeigeerstatter oder Verletzter diese Einstellung nicht akzeptieren möchten, benötigen Sie oft die Akteneinsicht, um die Gründe für diese Entscheidung genau nachzuvollziehen. Dies ist entscheidend, um zu prüfen, ob Sie selbst ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren einleiten wollen. Ein Klageerzwingungsverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, mit dem Sie versuchen, das Gericht dazu zu bewegen, die Staatsanwaltschaft anzuweisen, doch Anklage zu erheben. Die Akteneinsicht ist für die Vorbereitung eines solchen Verfahrens in der Regel unerlässlich und wird oft auch im Rahmen dieses gerichtlichen Prüfverfahrens ermöglicht.
- Wer entscheidet? Über einen solchen Antrag auf gerichtliche Entscheidung, der sich auf die Einstellung des Verfahrens und damit oft auch auf die Notwendigkeit der Akteneinsicht bezieht, entscheidet das Oberlandesgericht. Das Gericht prüft dann umfassend, ob die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, das Verfahren einzustellen und Ihnen die Akteneinsicht zu verweigern, aus rechtlicher Sicht haltbar ist.
Erfolgsaussichten der Rechtsmittel
Die Erfolgsaussichten sowohl einer Beschwerde als auch eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung sind stark vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Es gibt keine pauschale Garantie für einen Erfolg.
- Ihr berechtigtes Interesse: Ein entscheidender Faktor ist die Stärke und Begründung Ihres berechtigten Interesses an der Akteneinsicht. Wenn Sie zum Beispiel als Geschädigter einer Straftat zivilrechtliche Ansprüche prüfen möchten (wie Schadenersatz) oder wenn Sie nachvollziehbare Gründe darlegen können, warum die Einstellung des Verfahrens Ihrer Meinung nach falsch war und Sie ein Klageerzwingungsverfahren ernsthaft in Betracht ziehen, erhöhen sich Ihre Chancen.
- Gründe für die Ablehnung: Die Begründung der Staatsanwaltschaft für die Verweigerung der Akteneinsicht spielt ebenfalls eine große Rolle. Wenn die Akteneinsicht nachvollziehbar die laufenden Ermittlungen massiv behindern oder die Privatsphäre und den Schutz anderer Personen stark beeinträchtigen würde, sind die Erfolgsaussichten für eine Akteneinsicht geringer. Gerichte und Staatsanwaltschaften wägen diese Interessen sorgfältig ab.
- Beweislage im Verfahren: Im Rahmen eines Klageerzwingungsverfahrens wird das Gericht auch die gesamte Beweislage prüfen und beurteilen, ob tatsächlich genügend Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen, die eine Anklage rechtfertigen würden. Wenn das Gericht die Gründe der Staatsanwaltschaft für die Einstellung des Verfahrens als schlüssig und ausreichend begründet ansieht, wird es in der Regel auch Ihren Antrag auf gerichtliche Entscheidung ablehnen.
Diese Rechtsmittel bieten Ihnen die Möglichkeit, Entscheidungen der Staatsanwaltschaft überprüfen zu lassen. Sie bedeuten jedoch nicht, dass die Akteneinsicht oder die gewünschte Fortsetzung des Verfahrens automatisch durchgesetzt werden kann.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Verletzter im Sinne der Strafprozessordnung (§ 373b Abs. 1 StPO)
Ein „Verletzter“ im strafprozessualen Sinn ist eine Person oder Institution, die durch eine Straftat unmittelbar und rechtswidrig in eigenen Rechtsgütern beeinträchtigt oder geschädigt wurde. Die Strafprozessordnung (StPO) definiert Verletzte als diejenigen, deren eigene rechtlich geschützten Interessen, etwa Eigentum oder Gesundheit, direkt durch die Tat betroffen sind. Nur wer als Verletzter gilt, hat unter anderem das sogenannte Recht auf Akteneinsicht in das Ermittlungsverfahren (§ 406e StPO). Dabei ist entscheidend, dass der Schaden direkt durch die Tat selbst verursacht wurde, nicht nur als Folge eines späteren Kausalzusammenhangs.
Beispiel: Bei einem Diebstahlist der Eigentümer des gestohlenen Gegenstands der Verletzte, weil sein Eigentum unmittelbar verletzt wurde.
Unmittelbare Schädigung
Eine unmittelbare Schädigung liegt vor, wenn der Schaden direkt und als unmittelbare Folge einer Straftat entsteht, das heißt ohne Zwischenschritte oder vermittelnde Ursachen. Im Zusammenhang mit Abrechnungsbetrug bedeutet dies, dass die Person oder Institution, die die betrügerisch erlangten Gelder tatsächlich verliert, unmittelbar geschädigt ist. Nur wer einen solchen direkten Schaden erlitten hat, kann im Strafverfahren meist als Verletzter anerkannt werden. Von mittelbaren oder indirekten Schäden spricht man, wenn die Folgen erst über Zwischenschritte oder Folgeereignisse eintreten und kein direkter kausaler Schaden durch die Tat selbst nachweisbar ist.
Beispiel: Eine Krankenkasse zahlt aufgrund einer gefälschten Abrechnung zu viel Geld – sie ist unmittelbar geschädigt. Der Verein, der Wettbewerbsnachteile dadurch erfährt, ist hingegen nur mittelbar betroffen.
Akteneinsicht (§ 406e StPO)
Das Recht auf Akteneinsicht erlaubt einem Verletzten oder seinem Rechtsanwalt den Einblick in die Ermittlungsakten eines Strafverfahrens, um sich über den Verfahrensstand, Beweise und Zeugenaussagen zu informieren. Dieses Recht ist im § 406e Strafprozessordnung geregelt und gilt insbesondere nach Abschluss der Ermittlungen oder bei Verfahrenseinstellung. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller als Verletzter gilt und ein berechtigtes Interesse an der Einsicht darlegt. Nicht alle Beteiligte oder Anzeigeerstatter haben automatisch dieses Recht.
Beispiel: Wer Opfer eines Betrugs ist und seine zivilrechtlichen Ansprüche vorbereiten will, kann Einsicht in die Ermittlungsakte nehmen, um die Beweislage zu prüfen.
Berechtigtes Interesse
Das berechtigte Interesse ist ein rechtlich relevanter Grund, der es einer Person ermöglicht, trotz fehlender Verletzteneigenschaft Akteneinsicht zu beantragen. Es muss ein konkretes, nachvollziehbares Bedürfnis vorliegen, die Ermittlungsakte einzusehen – zum Beispiel zur Wahrung eigener rechtlicher Interessen oder zum Schutz der eigenen Position in Zusammenhang mit dem Strafverfahren. Ein bloßes Informationsinteresse oder allgemeine Neugier reicht nicht aus. Die Behörde oder das Gericht wägen das berechtigte Interesse gegen andere Schutzgüter, wie den Schutz der Ermittlungen oder der Beteiligten, ab.
Beispiel: Ein Vereinsmitglied will Akteneinsicht, weil es durch das Verfahren in seiner wirtschaftlichen Stellung betroffen sein könnte, hat aber keinen unmittelbaren Schaden durch die Tat selbst erlitten.
Antrag auf gerichtliche Entscheidung (§ 406e Abs. 5 StPO)
Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist ein Rechtsmittel, mit dem ein Anzeigeerstatter oder Verletzter bei Ablehnung einer Akteneinsicht durch die Staatsanwaltschaft eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung verlangen kann. Nach § 406e Abs. 5 StPO kann der Antrag beim zuständigen Gericht eingereicht werden, wenn die Staatsanwaltschaft die Akteneinsicht verweigert. Das Gericht entscheidet dann unabhängig über die Zulässigkeit und Berechtigung der Akteneinsicht, insbesondere ob der Antragsteller als Verletzter anzusehen ist und ein berechtigtes Interesse besteht. Dieser Weg ist ein wichtiges Instrument, um die Rechte im Strafverfahren zu wahren.
Beispiel: Ein Verein legt gegen die Ablehnung der Akteneinsicht seiner Strafanzeige durch die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein und beantragt beim Amtsgericht die Entscheidung über sein Recht auf Einsicht.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 406e Abs. 1 StPO: Regelt das Recht des Verletzten auf Akteneinsicht im Strafverfahren, wobei ein berechtigtes Interesse darzulegen ist. Das Akteneinsichtsrecht ist an die Verletzteneigenschaft gekoppelt und dient der Wahrung prozessualer Rechte. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht prüfte, ob der anzeigende Verein als Verletzter anzusehen ist, um ihm Akteneinsicht zu gewähren, was es verneinte.
- § 373b Abs. 1 StPO: Definiert den Begriff des Verletzten im Strafverfahren als Personen, die durch die Straftat unmittelbar in ihren Rechtsgütern beeinträchtigt oder geschädigt sind. Die Vorschrift verlangt eine unmittelbare Betroffenheit, keine bloß mittelbare Schädigung. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Verein wurde nicht als unmittelbarer Geschädigter des Abrechnungsbetrugs anerkannt, sondern als nur mittelbar betroffen, daher fehlt die Verletzteneigenschaft.
- § 170 Abs. 2 StPO: Regelt die Einstellung des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft, wenn kein hinreichender Tatverdacht vorliegt oder kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen die Betreibergesellschaft ein, da kein Nachweis von Vorsatz und unrechtmäßiger Bereicherung bestand, was die Grundlage für den Streit um Akteneinsicht bildete.
- Nr. 90 RiStBV: Vorgabe für die Staatsanwaltschaft, vor einer Verfahrenseinstellung wichtige Beteiligte (z.B. Geschädigte) anzuhören, um deren Stellungnahme einzuholen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Staatsanwaltschaft hörte die Krankenkasse als mutmaßlichen unmittelbaren Geschädigten an und berücksichtigte deren Stellungnahme bei der Entscheidung zur Verfahrenseinstellung und Ablehnung der Akteneinsicht.
- § 64 SGB IX: Regelt Anforderungen an Leistungserbringer im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe, darunter Qualifikationsvoraussetzungen für Übungsleiter im Rehabilitationssport. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Verein berief sich auf seine Anerkennung als Leistungserbringer nach § 64 SGB IX, argumentierte mit mittelbaren wirtschaftlichen Schäden durch unlizenzierte Konkurrenz und versuchte hierüber seine Verletztenstellung zu begründen.
- Betrugstatbestand (zivil- und strafrechtliche Grundzüge): Betrug setzt eine Täuschungshandlung mit Vermögensschaden beim Geschädigten voraus. Die direkte Schädigung muss kausal auf die Täuschung zurückzuführen sein. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Nur die Krankenkassen gelten als unmittelbar Vermögensgeschädigte durch eine mögliche Abrechnung einer unlizenzierte Übungsleiterin, nicht hingegen der anzeigende Verein mit seinen konkurrierenden wirtschaftlichen Interessen.
Das vorliegende Urteil
Amtsgericht Stade – Az.: 34 Gs 143 Js 24725/24 (1039/25) – Beschluss vom 01.04.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.
→ Lesen Sie hier den vollständigen Urteilstext…
Hinweis: Informationen in unserem Internetangebot dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen keine Rechtsberatung dar und können eine individuelle rechtliche Beratung auch nicht ersetzen, welche die Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalles berücksichtigt. Ebenso kann sich die aktuelle Rechtslage durch aktuelle Urteile und Gesetze zwischenzeitlich geändert haben. Benötigen Sie eine rechtssichere Auskunft oder eine persönliche Rechtsberatung, kontaktieren Sie uns bitte.









