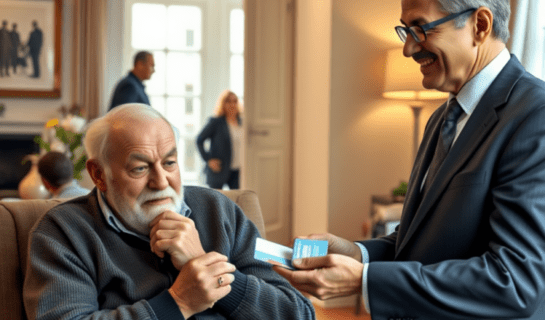Die Verwertung von Beweisanträgen im Strafprozess führte zum Eklat, als ein Landgericht die Erklärung des Verteidigers als persönliche Einlassung des angeklagten Richters wertete. Juristen streiten, wann diese Abgrenzung zwischen Anwalt und Mandant endet, zumal das Gericht die Motive des Hauptzeugen völlig ausblendete.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Wann wird das Wort des Anwalts zur Einlassung des Angeklagten?
- Was genau war passiert?
- Welche Spielregeln gelten für die richterliche Wahrheitssuche?
- Warum hob das OLG das Urteil auf – und nicht anders?
- Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Experten Kommentar
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wann gilt die Aussage meines Verteidigers als meine persönliche Einlassung vor Gericht?
- Darf ein Richter meine prozessuale Verteidigungsstrategie als Schuldeingeständnis interpretieren?
- Was genau darf das Gericht aus einem Beweisantrag nicht gegen mich verwenden?
- Wann ist die richterliche Beweiswürdigung wegen ignorierter Zeugen-Motive rechtsfehlerhaft?
- Welche Verfahrensfehler des Landgerichts führen zur Aufhebung des Urteils durch das OLG oder den BGH?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 3 ORs 29/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht Hamm
- Datum: 26.08.2025
- Aktenzeichen: 3 ORs 29/25
- Verfahren: Revision in einer Strafsache
- Rechtsbereiche: Strafrecht, Strafprozessrecht
- Das Problem: Ein früherer Richter wurde in zweiter Instanz wegen 15-facher Urkundenfälschung verurteilt, weil er Schriftsätze unter dem Namen eines anderen Anwalts erstellt hatte. Das Landgericht hatte seine Berufung verworfen.
- Die Rechtsfrage: Durfte das Gericht die Aussagen des Verteidigers, die dieser in einem Beweisantrag gemacht hatte, einfach als persönliches Schuldeingeständnis des Angeklagten werten?
- Die Antwort: Nein. Das angefochtene Urteil ist rechtsfehlerhaft und muss neu verhandelt werden. Das Gericht hat eine reine Beweisforderung des Verteidigers unzulässigerweise als Einlassung des Angeklagten in die Beweiswürdigung einbezogen.
- Die Bedeutung: Gerichte müssen strikt unterscheiden, ob es sich um eine Verfahrenserklärung des Verteidigers oder um eine persönliche Aussage des Angeklagten handelt. Außerdem muss die Glaubwürdigkeit eines wichtigen Zeugen stets unter Berücksichtigung aller denkbaren Falschaussagemotive geprüft werden.
Wann wird das Wort des Anwalts zur Einlassung des Angeklagten?
Ein Richter steht selbst vor Gericht, angeklagt der Urkundenfälschung in 15 Fällen. Doch der eigentliche juristische Kern dieses Falles liegt nicht in den gefälschten Dokumenten, sondern in der heiklen Frage, wie das Gericht mit den Worten seines Verteidigers umgeht. Wann darf ein Richter eine Erklärung des Anwalts als persönliche Aussage des Angeklagten werten – und wann überschreitet er damit eine rote Linie des Strafprozessrechts? Das Oberlandesgericht Hamm hat in seinem Beschluss vom 26. August 2025 (Az. 3 ORs 29/25) eine präzise Antwort gegeben und damit die Grenzen der richterlichen Überzeugungsbildung neu vermessen. Die Entscheidung ist eine Lektion in prozessualer Fairness und der Kunst, zwischen strategischer Verteidigung und persönlichem Geständnis zu unterscheiden.
Was genau war passiert?

Im Zentrum des Verfahrens stand ein Richter, der zwischen Februar und Dezember 2016 insgesamt fünfzehn Schriftsätze verfasst haben soll, die aussahen, als kämen sie von einem Rechtsanwalt O. Die Schriftstücke trugen den Briefkopf und eine eingescannte Unterschrift dieses Anwalts. Der Clou: Der Briefkopf war so manipuliert, dass er die private Anschrift, Kontaktdaten und sogar die Bankverbindung des angeklagten Richters enthielt. Diese Schreiben gingen unter anderem an eine Bank und das Betreuungsgericht, teilweise wurden darin auch Gebühren gefordert.
Der Angeklagte, der zuvor bereits vom Amts- und Landgericht Bielefeld zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, bestritt die Vorwürfe nicht gänzlich. Er gab zu, den Inhalt der Schreiben verfasst zu haben. Seine Verteidigungslinie war jedoch eine andere: Die ehemalige Sekretärin des Rechtsanwalts O., eine Zeugin namens Q., habe die Schreiben auf dem Kanzleipapier ausgefertigt und versendet. Er selbst sei fest davon ausgegangen, dass die Sekretärin dazu eine Generalvollmacht von ihrem früheren Chef besessen habe.
Im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Bielefeld äußerte sich der Angeklagte mehrfach. Teils mündlich, teils durch schriftliche Erklärungen, die sein Verteidiger verlas und die er selbst unterschrieben hatte. Um seine Version der Geschichte zu untermauern, stellte sein Verteidiger zudem einen förmlichen Beweisantrag. Darin wurden weitere Beweismittel benannt, die belegen sollten, dass die Sekretärin Q. tatsächlich weitreichende Befugnisse in der Kanzlei hatte.
Das Landgericht schenkte dieser Darstellung keinen Glauben. Es stützte seine Überzeugung maßgeblich auf die Aussage des Rechtsanwalts O., der bestritt, jemals eine solche Ermächtigung erteilt zu haben. Bei der Begründung seines Urteils griff das Gericht aber nicht nur auf die direkten Aussagen des Angeklagten zurück, sondern wertete auch Teile des von seinem Verteidiger formulierten Beweisantrags als dessen persönliche Einlassung. Gegen dieses Urteil legte der Angeklagte Revision ein, mit dem zentralen Vorwurf: Das Gericht habe die Worte seines Verteidigers unzulässig zu seinen eigenen gemacht.
Welche Spielregeln gelten für die richterliche Wahrheitssuche?
Das Herzstück eines jeden Strafprozesses ist die Freie richterliche Beweiswürdigung, verankert in § 261 der Strafprozessordnung (StPO). Dieses Prinzip besagt, dass das Gericht seine Überzeugung von der Schuld oder Unschuld des Angeklagten aus dem „Inbegriff der Hauptverhandlung“ schöpfen muss. Das bedeutet, es darf nur das berücksichtigen, was im Gerichtssaal zur Sprache kam – Zeugenaussagen, Urkunden, Sachverständigengutachten und eben auch die Einlassung des Angeklagten.
Doch genau hier liegt die entscheidende Weiche: Was genau ist die „Einlassung des Angeklagten“? Unproblematisch sind Äußerungen, die der Angeklagte selbst mündlich tätigt. Komplexer wird es, wenn der Verteidiger spricht. Grundsätzlich sind die Erklärungen eines Verteidigers dessen eigene prozessuale Handlungen und nicht automatisch die des Angeklagten. Sie können strategische Manöver sein, rechtliche Argumente oder eben Beweisbehauptungen, die erst noch bewiesen werden sollen.
Ein Gericht darf eine Erklärung des Verteidigers nur dann als persönliche Aussage des Angeklagten werten, wenn dieser sie sich unmissverständlich zu eigen macht. Dies kann durch eine ausdrückliche Bestätigung geschehen oder, wie die Rechtsprechung es formuliert, durch Konkludentes Verhalten – also durch Umstände, die keinen anderen Schluss zulassen. Besonders heikel ist die Lage bei einem Beweisantrag nach § 244 StPO. Ein solcher Antrag muss per Definition eine konkrete Tatsache behaupten, die bewiesen werden soll. Ihn vorschnell als persönliche Einlassung umzudeuten, birgt die Gefahr, die strategische Verteidigung mit einem Geständnis zu verwechseln und damit die prozessualen Rechte des Angeklagten zu untergraben.
Warum hob das OLG das Urteil auf – und nicht anders?
Der 3. Strafsenat des Oberlandesgerichts Hamm folgte der Argumentation der Revision und hob das Urteil des Landgerichts auf. Seine Begründung ist eine präzise juristische Sezierung, die zeigt, wo die Vorinstanz die Grenzen des § 261 StPO verletzt hatte. Die Richter arbeiteten dabei drei zentrale Fehlerpunkte heraus.
Die feine Linie: Wann der Angeklagte eine Erklärung zu seiner eigenen macht
Zunächst prüfte das OLG, ob das Landgericht die vom Verteidiger verlesene, aber vom Angeklagten unterschriebene schriftliche Erklärung vom 26. November 2024 als dessen Einlassung werten durfte. Hier gaben die Richter dem Landgericht recht. Die Umstände sprachen eine klare Sprache: Die Erklärung bezog sich direkt auf frühere mündliche Äußerungen des Angeklagten und beantwortete konkrete Fragen der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hatte das Original unterschrieben, es dem Gericht übergeben und sich nach der Verlesung sogar noch ergänzend geäußert. In dieser Konstellation, so das OLG, war eindeutig erkennbar, dass er sich den Inhalt vollständig zu eigen machen wollte. Eine ausdrückliche Bestätigung war hier überflüssig.
Ein fataler Fehler: Die Umdeutung eines Beweisantrags in eine persönliche Aussage
Ganz anders bewertete der Senat jedoch den Umgang des Landgerichts mit dem Beweisantrag vom 12. Dezember 2024. Das Landgericht hatte Passagen aus der Begründung dieses Antrags wortgleich in seine Urteilsgründe übernommen und als Beleg dafür gewertet, dass der Angeklagte von der fehlenden Vollmacht gewusst haben muss. Diesen Schritt stufte das OLG als schweren Rechtsfehler ein.
Ein Beweisantrag, so die Richter, ist seinem Wesen nach eine reine Beweisbehauptung. Der Verteidiger legt dar, welche Tatsache er durch welches Beweismittel beweisen möchte. Die darin enthaltenen Behauptungen sind Mittel zum Zweck und nicht zwangsläufig die persönliche Überzeugung des Angeklagten. Die Rechtsprechung, insbesondere des Bundesgerichtshofs, mahnt hier seit Langem zur Zurückhaltung. Nur unter ganz besonderen Umständen darf ein solcher Antrag als Einlassung gewertet werden. Diese Umstände lagen hier nicht vor. Der Antrag war strategisch formuliert und enthielt keine direkten Bezüge zu Fragen, die dem Angeklagten gestellt worden waren. Ihn dennoch als persönliche Aussage zu verwerten, verstößt gegen das Gebot der freien Beweiswürdigung aus § 261 StPO. Da das Landgericht seine Überzeugung von der inneren Tatseite des Angeklagten maßgeblich auf diese unzulässige Quelle gestützt hatte, konnte das Urteil keinen Bestand haben.
Die Lücke in der Beweiskette: Warum die Aussage des Hauptzeugen nicht ausreichte
Doch der Senat fand noch einen zweiten, unabhängigen Grund für die Aufhebung des Urteils. Er betraf die Würdigung der Aussage des zentralen Belastungszeugen, des Rechtsanwalts O. Das Landgericht hatte dessen Aussage als glaubhaft eingestuft und explizit in seinem Urteil vermerkt: „Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, warum der Zeuge O. das tatsächliche Vorhandensein einer Vollmacht hätte leugnen sollen.“
Diese Feststellung kritisierte das OLG als lückenhaft und damit rechtsfehlerhaft. Für die Richter lag ein mögliches Motiv für eine Falschaussage geradezu auf der Hand: Ein Rechtsanwalt, der seine Kanzlei faktisch unkontrolliert einer ehemaligen Sekretärin überlässt, setzt sich erheblichen berufsrechtlichen Risiken aus. Ein Geständnis, er habe eine weitreichende Generalvollmacht erteilt, hätte für ihn selbst unangenehme Konsequenzen haben können. Dieses naheliegende Eigeninteresse des Zeugen, eine solche Vollmacht zu leugnen, hätte das Landgericht zwingend in seine Überlegungen einbeziehen und abwägen müssen. Indem es dieses Motiv nicht nur ignorierte, sondern seine Existenz sogar ausdrücklich verneinte, hat es seine Pflicht zur umfassenden und lückenlosen Beweiswürdigung verletzt.
Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm verdeutlicht zwei grundlegende Prinzipien des rechtsstaatlichen Strafverfahrens, die weit über den konkreten Fall hinausweisen.
Erstens zementiert das Urteil die strikte Trennung zwischen der prozessualen Rolle des Verteidigers und der persönlichen Aussage des Angeklagten. Ein Angeklagter hat das Recht zu schweigen. Dieses Recht darf nicht dadurch ausgehöhlt werden, dass Gerichte die strategischen Erklärungen seines Anwalts ohne Weiteres in eine persönliche Einlassung umdeuten. Insbesondere bei Beweisanträgen ist höchste Vorsicht geboten. Sie sind Werkzeuge der Verteidigung, um die Version des Angeklagten zu untermauern, aber sie sind nicht die Version selbst. Für Sie als Beobachter eines Prozesses bedeutet das: Nicht alles, was ein Anwalt sagt, spiegelt wider, was sein Mandant denkt oder zugeben würde. Es ist Teil einer prozessualen Strategie, deren Grenzen das Gericht respektieren muss.
Zweitens schärft der Beschluss das Verständnis von dem, was eine sorgfältige richterliche Beweiswürdigung ausmacht. Es genügt nicht, eine Zeugenaussage für glaubhaft zu halten, weil sie auf den ersten Blick schlüssig erscheint. Ein Gericht muss aktiv nach Widersprüchen, Ungereimtheiten und vor allem nach möglichen Motiven für eine Falschaussage suchen. Die Frage darf nicht nur lauten: „Warum sollte der Zeuge lügen?“, sondern muss auch lauten: „Welche denkbaren Gründe könnte es geben, dass der Zeuge nicht die Wahrheit sagt?“. Das Versäumnis, naheliegende Eigeninteressen eines Zeugen zu prüfen, ist keine Nebensächlichkeit, sondern kann, wie dieser Fall zeigt, ein ganzes Urteil zu Fall bringen. Es ist eine Erinnerung daran, dass richterliche Überzeugung nicht auf passivem Glauben, sondern auf aktiver, kritischer Prüfung beruhen muss.
Die Urteilslogik
Die Verurteilung im Strafprozess erfordert eine kompromisslose Trennung zwischen strategischer Verteidigung und persönlichem Geständnis.
- Prozessuale Strategie ist kein Geständnis: Strategische Erklärungen des Verteidigers, insbesondere die Begründung eines förmlichen Beweisantrags, gelten niemals automatisch als persönliche Einlassung des Angeklagten. Gerichte müssen strikt prüfen, ob der Angeklagte den vorgetragenen Inhalt unmissverständlich zu seinem eigenen macht.
- Richterliche Überzeugung verlangt aktive Risikoprüfung: Die freie richterliche Beweiswürdigung verpflichtet das Gericht, alle denkbaren Motive des Zeugen für eine Falschaussage, einschließlich eigener beruflicher oder rechtlicher Risiken, aktiv zu suchen und lückenlos abzuwägen.
- Unterschriebene Erklärungen sind direkte Einlassungen: Gibt der Angeklagte eine schriftliche, von ihm selbst unterschriebene Erklärung in der Hauptverhandlung ab und äußert sich ergänzend dazu, macht er sich den Inhalt dieser Aussage eindeutig zu eigen.
Eine sorgfältige Rechtsprechung respektiert die prozessualen Rechte des Angeklagten und gründet ihre Überzeugung stets auf kritischer, umfassender Prüfung aller Beweismittel.
Benötigen Sie Hilfe?
Wurden Beweisanträge Ihres Verteidigers unzulässig als Ihre persönliche Einlassung gewertet? Kontaktieren Sie uns für eine professionelle Ersteinschätzung Ihres strafrechtlichen Verfahrens.
Experten Kommentar
Wie weit reicht das Recht zu schweigen wirklich, wenn der Anwalt taktisch kämpft? Das OLG Hamm stellt klar: Ein Beweisantrag ist ein strategisches Verteidigungswerkzeug und keine unfreiwillige Einlassung des Angeklagten, die man ihm einfach als Geständnis anlasten kann. Diese Entscheidung schützt die Rechte der Verteidigung massiv, denn sie verhindert, dass Gerichte die notwendigen prozessualen Manöver vorschnell zur Grundlage einer Verurteilung machen. Hinzu kommt der konsequente Hinweis: Richter müssen das naheliegende Eigeninteresse eines Zeugen an einer Falschaussage aktiv prüfen, anstatt einfach zu glauben, weil es bequem ist.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wann gilt die Aussage meines Verteidigers als meine persönliche Einlassung vor Gericht?
Die Äußerungen Ihres Verteidigers sind zunächst dessen eigene prozessuale Handlungen und nicht automatisch Ihre persönliche Einlassung. Das Gericht darf Erklärungen Ihres Anwalts nur dann gegen Sie verwenden, wenn Sie sich diese unmissverständlich zu eigen machen. Dies erfordert eine klare Bestätigung oder ein entsprechendes Verhalten, das keinen Zweifel zulässt. Wichtig ist die strikte Trennung, um Ihr fundamentales Schweigerecht im Strafverfahren zu schützen.
Die Regel: Jeder Angeklagte besitzt das Recht zu schweigen. Dieses fundamentale Recht darf nicht dadurch ausgehöhlt werden, dass strategische Argumente der Verteidigung als Geständnis fehlinterpretiert werden. Gerichte prüfen streng, ob eine ausdrückliche Bestätigung vorliegt. Eine stillschweigende Übernahme der Erklärung ist nur durch konkludentes Verhalten möglich. Dies bedeutet, dass die Umstände zwingend darauf hinweisen müssen, dass Sie den Inhalt als Ihre persönliche Einlassung bestätigen.
Nehmen wir an: Wenn Sie eine vorbereitete schriftliche Erklärung eigenhändig unterschreiben und diese dem Gericht übergeben, kann dies als Einlassung gewertet werden. Das Oberlandesgericht Hamm bestätigte diese Sichtweise, besonders wenn der Angeklagte nach der Verlesung noch mündliche Ergänzungen macht. Eine höhere Schutzgrenze gilt jedoch bei einem förmlichen Beweisantrag der Verteidigung, da dieser primär ein strategisches Werkzeug zur Untermauerung von Tatsachenbehauptungen ist.
Fordern Sie Ihren Verteidiger stets auf, Schriftsätze kritisch daraufhin zu prüfen, ob sie als Ihre Aussage und nicht nur als strategische Behauptung interpretiert werden könnten.
Darf ein Richter meine prozessuale Verteidigungsstrategie als Schuldeingeständnis interpretieren?
Nein, das Gericht darf Ihre prozessuale Verteidigungsstrategie nicht vorschnell als persönliches Schuldeingeständnis werten. Insbesondere ein förmlicher Beweisantrag nach § 244 StPO ist ein strategisches Verteidigungsinstrument. Interpretiert ein Richter die Begründung dieses Antrags als Beleg für Ihre innere Tatseite (Wissen um die Schuld), verletzt er die freie richterliche Beweiswürdigung nach § 261 StPO. Dies stellt einen schwerwiegenden Rechtsfehler dar, da dadurch die prozessualen Rechte des Angeklagten beschnitten werden.
Beweisanträge sind ihrem Wesen nach reine Beweisbehauptungen der Verteidigung. Sie dienen dazu, bestimmte Tatsachen durch Zeugen oder Dokumente zu belegen, die Ihre Version der Geschehnisse untermauern sollen. Die darin enthaltenen Argumente sind Mittel zum Zweck und spiegeln nicht zwangsläufig die persönliche Überzeugung des Angeklagten wider. Die unzulässige Umdeutung eines solchen strategischen Schriftsatzes birgt die Gefahr, die Verteidigung mit einem Geständnis zu verwechseln.
Gerichte begehen einen schweren Fehler, wenn sie diese klare Trennung missachten. Ein Beispiel: Das Landgericht hatte Passagen aus der Begründung eines Beweisantrags wortgleich in seine Urteilsgründe übernommen und als Beleg für das Wissen des Angeklagten gewertet. Das Oberlandesgericht Hamm sah darin einen Verstoß gegen die Verfahrensregeln. Die Beweiswürdigung muss stets auf dem Inbegriff der Hauptverhandlung basieren und nicht auf strategischen Behauptungen des Verteidigers.
Ihr Verteidiger muss strategische Schriftsätze immer explizit als Beweisbehauptung der Verteidigung kennzeichnen, um eine Verwechslung mit Ihrer persönlichen Einlassung zu verhindern.
Was genau darf das Gericht aus einem Beweisantrag nicht gegen mich verwenden?
Gerichte dürfen die Begründungspassagen Ihres förmlichen Beweisantrags nicht als Beleg Ihrer persönlichen Überzeugung oder Ihres Wissens verwenden. Ein Beweisantrag ist ein strategisches Werkzeug der Verteidigung, kein Geständnis. Die unzulässige Umdeutung solcher Texte verletzt die freie richterliche Beweiswürdigung nach § 261 StPO.
Der wesentliche Unterschied liegt im Zweck des Dokuments. Ein Beweisantrag stellt eine Beweisbehauptung auf, um eine bestimmte Tatsache zu klären, die zu Ihren Gunsten spricht. Dieser strategische Schriftsatz spiegelt nicht zwangsläufig die innere Einstellung oder die persönliche Überzeugung des Angeklagten wider. Richter müssen die prozessuale Funktion des Beweisantrags respektieren. Die Verteidigung muss die Möglichkeit haben, ihre Version darzulegen, ohne dass ihre Argumentation sofort gegen den Mandanten ausgelegt wird.
Konkret: Das Gericht darf die Passagen aus Ihrem Beweisantrag nicht wortgleich in die Urteilsgründe übernehmen, um daraus auf Ihre innere Tatseite zu schließen. Verlangt die Verteidigung beispielsweise den Beweis einer Vollmacht, darf das Gericht diesen Text nicht als Beleg dafür werten, dass der Angeklagte wusste, die Vollmacht habe gefehlt. Eine solche unzulässige Verwertung greift die Verteidigungsstrategie an und begründet einen schweren Rechtsfehler.
Überprüfen Sie mit Ihrem Verteidiger das erstinstanzliche Urteil auf konkrete, wortgleiche Zitate aus Ihren Verteidigungsschriftsätzen.
Diese allgemeinen Informationen ersetzen keine individuelle Rechtsberatung.
Wann ist die richterliche Beweiswürdigung wegen ignorierter Zeugen-Motive rechtsfehlerhaft?
Die richterliche Beweiswürdigung wird rechtsfehlerhaft und lückenhaft, wenn das Gericht die Glaubwürdigkeit eines Zeugen unkritisch bewertet. Entscheidend ist dabei, ob das Gericht naheliegende Motive für eine Falschaussage aktiv prüft. Ignoriert das Gericht solche offenkundigen Eigeninteressen oder verneint deren Existenz sogar explizit, liegt ein Verstoß gegen die Pflicht zur umfassenden Überzeugungsbildung nach § 261 StPO vor.
Ein Gericht muss aktiv nach Gründen suchen, die den Zeugen zu einer unwahren Aussage bewegen könnten. Die juristische Prüfung beschränkt sich dabei nicht auf leichte Widersprüche, sondern fragt, welche denkbaren strafrechtlichen oder berufsrechtlichen Konsequenzen eine ehrliche Aussage für den Zeugen hätte. Wenn die Beweiskette maßgeblich von einer einzelnen Zeugenaussage abhängt, muss das Gericht besonders sorgfältig die persönlichen Risiken abwägen. Nur so kann die richterliche Überzeugung auf einer soliden Grundlage stehen.
Der Fehler tritt besonders klar zutage, wenn ein Gericht ein offenkundiges Motiv für eine Lüge negiert, wie im Fall des OLG Hamm. Dort war das naheliegende Eigeninteresse des Anwalts O., der Hauptbelastungszeuge war, die Abwendung eines berufsrechtlichen Risikos wegen Missachtung der Aufsichtspflicht. Das Landgericht beging einen Rechtsfehler, als es urteilte, es sei „nicht ersichtlich“, warum der Zeuge die Wahrheit leugnen sollte, da das Motiv offensichtlich war.
Erstellen Sie bei einem Hauptbelastungszeugen eine Risiko-Matrix aller drohenden rechtlichen Nachteile, die er bei einer Wahrheitsaussage zu befürchten hätte.
Welche Verfahrensfehler des Landgerichts führen zur Aufhebung des Urteils durch das OLG oder den BGH?
Die Aufhebung eines erstinstanzlichen Urteils in der Revision erfordert schwerwiegende Verfahrensfehler, die die Urteilsfindung entscheidend beeinflussten. Diese Mängel betreffen meist die richterliche Beweiswürdigung und verletzen das Gebot der freien richterlichen Überzeugungsbildung nach § 261 StPO. Im OLG-Hamm-Fall führten zwei unabhängige Verstöße zur zwingenden Aufhebung: die unzulässige Verwertung strategischer Schriftsätze und eine lückenhafte Analyse der Zeugenmotive.
Das Landgericht beging einen ersten schweren Rechtsfehler, indem es Passagen aus der Begründung eines Beweisantrags wortgleich in seine Urteilsgründe übernahm. Ein Beweisantrag ist ein strategisches Mittel der Verteidigung, um eine Tatsache zu beweisen, und darf nicht vorschnell als persönliche Einlassung des Angeklagten gewertet werden. Die Richter verletzten damit die prozessuale Fairness, da sie die strategische Behauptung mit dem tatsächlichen Wissen des Angeklagten gleichsetzten und so das Recht zu Schweigen aushöhlten.
Der zweite gravierende Mangel betraf die unvollständige Würdigung des Hauptbelastungszeugen. Das Gericht ignorierte dessen naheliegendes Eigeninteresse, eine Falschaussage zu tätigen, um drohenden berufsrechtlichen Konsequenzen zu entgehen. Die Beweiswürdigung wird lückenhaft, wenn offenkundige Motive des Zeugen für eine Lüge nicht aktiv geprüft werden. Da die richterliche Überzeugung auf diesen beiden Rechtsfehlern basierte, war die Grundlage des Urteils fehlerhaft.
Planen Sie eine Revision, muss Ihr Verteidiger die Urteilsbegründung akribisch mit den eigenen Verteidigungsschriftsätzen abgleichen, um solche prozessualen Verstöße zu rügen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Beweisantrag (Förmlicher)
Ein Beweisantrag ist ein prozessuales Werkzeug, das die Verteidigung nutzt, um dem Gericht die Verpflichtung aufzuerlegen, eine konkret benannte Tatsache durch ein im Antrag benanntes Beweismittel festzustellen. Dieses Instrument nach § 244 StPO sichert die prozessuale Fairness, indem es die aktive Wahrheitssuche unterstützt und verhindert, dass das Gericht entlastende Beweise einfach ignoriert.
Beispiel: Im Revisionsverfahren kritisierte der Angeklagte, dass das Landgericht die Begründung seines förmlichen Beweisantrags, der die weitreichenden Befugnisse der Sekretärin belegen sollte, fälschlicherweise als persönliches Geständnis verwertete.
Einlassung des Angeklagten
Die Einlassung des Angeklagten ist die formelle Stellungnahme des Beschuldigten im Strafprozess, die entweder ein Geständnis, eine Erklärung zur Sache oder auch die Verweigerung einer Aussage umfassen kann. Sie dient als wichtiges Beweismittel und zugleich als zentrales Instrument der Verteidigung, wobei das fundamentale Schweigerecht durch eine strategische Einlassung nicht ausgehöhlt werden darf.
Beispiel: Das OLG Hamm musste entscheiden, ob das Landgericht die strategischen Worte des Verteidigers unzulässig als persönliche Einlassung des angeklagten Richters wertete, da dieser sie sich nicht ausdrücklich zu eigen gemacht hatte.
Freie richterliche Beweiswürdigung
Die Freie richterliche Beweiswürdigung, verankert in § 261 StPO, legt fest, dass der Richter seine Überzeugung von der Wahrheit eines Sachverhalts ohne starre Regeln allein aus dem Gesamtergebnis der Hauptverhandlung schöpfen muss. Dieses Prinzip garantiert die richterliche Unabhängigkeit und verlangt gleichzeitig eine lückenlose und kritische Prüfung aller Beweismittel, einschließlich möglicher Motive für eine Falschaussage von Zeugen.
Beispiel: Das OLG stellte fest, dass die Beweiswürdigung des Landgerichts fehlerhaft war, weil es naheliegende berufsrechtliche Eigeninteressen des Hauptbelastungszeugen ignorierte.
Innere Tatseite
Als Innere Tatseite bezeichnen Juristen die subjektive Ebene eines Straftatbestandes, die das Wissen und den Willen (Vorsatz) des Täters hinsichtlich der Verwirklichung des objektiven Sachverhalts umfasst. Nur wenn das Gericht die innere Tatseite – also die vorsätzliche Handlungsweise – zweifelsfrei feststellt, kann eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Delikte wie der Urkundenfälschung erfolgen.
Beispiel: Das Landgericht stützte seine Überzeugung von der inneren Tatseite des Richters darauf, dass dieser von der fehlenden Generalvollmacht gewusst haben musste, was das OLG als unzulässige Schlussfolgerung verwarf.
Konkludentes Verhalten
Konkludentes Verhalten beschreibt im Prozessrecht eine stillschweigende Willenserklärung, die durch eindeutige Handlungen erfolgt, welche keinen Raum für eine andere Auslegung lassen. Juristen benötigen diese Kategorie, um festzustellen, wann sich jemand den Inhalt einer fremden Erklärung zu eigen macht, ohne diesen ausdrücklich mündlich zu bestätigen.
Beispiel: Der Angeklagte machte sich die vom Verteidiger verlesene schriftliche Erklärung konkludent zu eigen, weil er das Dokument nicht nur eigenhändig unterschrieb, sondern es auch dem Gericht übergab.
Das vorliegende Urteil
Oberlandesgericht Hamm – Az.: 3 ORs 29/25 – Beschluss vom 26.08.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.