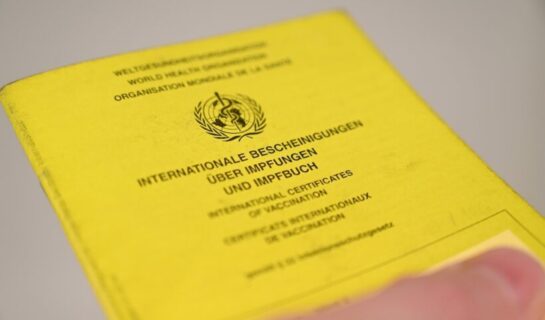Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Oberlandesgericht hebt Bewährungswiderruf auf: Positive Lebensentwicklung wiegt schwerer als neue Straftaten und Auflagenverstöße
- Der Fall im Überblick: Von der Verurteilung zur Bewährung und neuen Problemen
- Der Gang durch die Instanzen: Landgericht widerruft die Bewährung
- Die Beschwerde vor dem Oberlandesgericht und die zentralen Streitpunkte
- Die Entscheidung des Oberlandesgerichts: Bewährungswiderruf aufgehoben, Bewährungszeit verlängert
- Die wesentlichen Entscheidungsgründe des Oberlandesgerichts im Detail
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet Strafaussetzung zur Bewährung genau?
- Welche Faktoren können dazu führen, dass eine Bewährung widerrufen wird?
- Was ist der Unterschied zwischen Auflagen und Weisungen während der Bewährungszeit?
- Welche Rolle spielt die positive Lebensentwicklung des Verurteilten bei der Entscheidung über den Bewährungswiderruf?
- Was bedeutet es, wenn ein Gericht eine nachträgliche Gesamtstrafe ablehnt?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 3 Ws 479/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht
- Verfahrensart: Sofortige Beschwerde
- Rechtsbereiche: Strafrecht (Bewährungswiderruf)
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Der Betroffene legte Beschwerde gegen den Widerruf seiner Bewährung ein.
- Beklagte: Die Staatsanwaltschaft vertrat die Auffassung, dass die Bewährung zu Recht widerrufen wurde.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Der Betroffene wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und erhielt Auflagen und Weisungen. Später beging er neue Straftaten und erfüllte Auflagen/Weisungen nicht rechtzeitig. Das Landgericht widerrief daraufhin die Bewährung.
- Kern des Rechtsstreits: Es ging darum, ob das Landgericht die Bewährung des Betroffenen wegen neuer Straftaten und Verstößen gegen Auflagen und Weisungen zu Recht widerrufen hat. Das Oberlandesgericht musste prüfen, ob stattdessen mildere Maßnahmen wie eine Verlängerung der Bewährungszeit ausreichten.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Oberlandesgericht hob den Beschluss des Landgerichts auf, der die Bewährung widerrufen hatte. Stattdessen wurde die Bewährungszeit um ein halbes Jahr verlängert.
- Begründung: Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass die neuen Straftaten und Verstöße trotz ihrer Relevanz durch die positive Entwicklung und die veränderten Lebensumstände des Betroffenen überlagert wurden. Insbesondere die Drogenabstinenz, die Aufnahme einer Suchtberatung und die spätere Erfüllung der Arbeitsauflage sprachen für eine günstige Zukunftsprognose. Eine Verlängerung der Bewährungszeit wurde als ausreichende Reaktion auf die Verfehlungen angesehen.
- Folgen: Die Bewährung des Betroffenen bleibt bestehen, er muss die Freiheitsstrafe nicht verbüßen. Die Bewährungszeit verlängert sich jedoch um sechs Monate. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens wurden zwischen dem Betroffenen und der Staatskasse geteilt.
Der Fall vor Gericht
Oberlandesgericht hebt Bewährungswiderruf auf: Positive Lebensentwicklung wiegt schwerer als neue Straftaten und Auflagenverstöße
Ein Mann, der während seiner Bewährungszeit erneut straffällig wurde und gegen Bewährungsauflagen verstieß, muss nun doch nicht die ursprünglich verhängte Freiheitsstrafe antreten. Das Oberlandesgericht hob einen entsprechenden Widerrufsbeschluss des Landgerichts Gera auf. Entscheidend für diese Kehrtwende war die nach den neuen Verfehlungen eingetretene positive Entwicklung im Leben des Betroffenen, die dem Gericht Anlass zu einer günstigeren Zukunftsprognose gab. Statt des Widerrufs wurde die Bewährungszeit verlängert.

Der Fall beleuchtet die komplexen Abwägungen, die Gerichte treffen müssen, wenn es um den Widerruf einer Strafaussetzung zur Bewährung geht. Strafaussetzung zur Bewährung bedeutet, dass eine verhängte Freiheitsstrafe zunächst nicht im Gefängnis verbüßt werden muss. Stattdessen erhält der Verurteilte eine festgelegte Bewährungszeit – eine Art Bewährungsprobe –, in der er die Chance hat, durch Wohlverhalten und die Erfüllung bestimmter Bedingungen zu zeigen, dass er auch ohne Strafvollzug keine weiteren Straftaten begehen wird. Gelingt dies, wird die Strafe nach Ablauf der Bewährungszeit endgültig erlassen. Im Zentrum stand die Frage, ob neue Straftaten und Verstöße unweigerlich zum Widerruf führen oder ob eine positive Lebensveränderung eine zweite Chance rechtfertigen kann.
Der Fall im Überblick: Von der Verurteilung zur Bewährung und neuen Problemen
Ursprüngliche Verurteilung und Bewährungsbedingungen
Mit Urteil des Landgerichts Gera vom 2. Oktober 2023 war der Betroffene wegen Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Erwerb von Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Diese Straftat hatte er am 14. März 2023 begangen. Die Vollstreckung dieser Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.
Gleichzeitig legte das Landgericht in einem Bewährungsbeschluss die Bewährungszeit auf drei Jahre fest. Der Mann wurde einem Bewährungshelfer unterstellt, der ihn während dieser Zeit unterstützen und beaufsichtigen sollte. Zudem erteilte das Gericht ihm verschiedene Weisungen und Auflagen. Weisungen sind Verhaltensregeln, die dem Verurteilten auferlegt werden, um ihn zu einem straffreien Leben anzuhalten und seine Lebensführung zu überwachen (z.B. sich bei der Bewährungshilfe zu melden, eine Therapie zu machen). Auflagen sind konkrete Leistungen, die dem Verurteilten abverlangt werden, oft um einen Ausgleich für die Tat zu schaffen (z.B. Zahlungen, gemeinnützige Arbeit).
Konkret umfassten die Weisungen unter anderem die Pflicht, sich um eine Schuldenregulierung zu bemühen (Weisung Nr. 3 b)), eine Suchtberatung aufzusuchen (Weisung Nr. 3 e)), gegebenenfalls eine Entwöhnungsbehandlung anzutreten (Weisung Nr. 3 f)) und sich einer eventuellen Spielsucht-Therapie zu stellen (Weisung Nr. 3 h)). Als Auflage musste der Betroffene bis zum 3. Mai 2024 insgesamt 120 Stunden unentgeltlicher gemeinnütziger Arbeit leisten.
Zusätzliche Verurteilungen für frühere und neue Delikte
Noch bevor das Landgericht Gera über die Aussetzung der Strafe zur Bewährung entschieden hatte, war der Betroffene bereits erneut straffällig geworden, was aber erst später geahndet wurde.
Am 4. März 2023 – also vor dem Haupturteil – hatte er das Fahren ohne Fahrerlaubnis angeordnet oder zugelassen. Dies wurde mit einem rechtskräftigen Strafbefehl des Amtsgerichts Greiz vom 14. Juni 2023 geahndet. Ein Strafbefehl ist eine Art schriftliches Urteil in einfacheren Strafsachen, das ohne mündliche Hauptverhandlung ergehen kann.
Ebenfalls am 4. März 2023 hatte er fahrlässig ein Fahrzeug ohne den vorgeschriebenen Haftpflichtversicherungsschutz benutzt. Hierfür erging ein rechtskräftiger Strafbefehl des Amtsgerichts Greiz vom 4. Oktober 2023.
Eine nachträgliche Bildung einer Gesamtstrafe – das bedeutet, dass bei mehreren Verurteilungen eine neue, gemeinsame Strafe gebildet wird, die in der Regel milder ist als die Summe der Einzelstrafen – aus diesen Verurteilungen und dem Urteil des Landgerichts Gera lehnte das Landgericht mit Beschluss vom 6. Mai 2024 ab.
Auch nach der Gewährung der Bewährung durch das Landgericht Gera kam es zu weiteren Straftaten:
Am 12. September 2023 benutzte der Betroffene erneut fahrlässig ein Fahrzeug ohne Haftpflichtversicherung. Dies führte zu einem rechtskräftigen Strafbefehl des Amtsgerichts Greiz vom 2. Januar 2024, der eine Geldstrafe festsetzte.
Am 26. März 2024 beging der Mann eine Tat des Besitzes von Betäubungsmitteln. Hierzu erging am 6. September 2024 ein rechtskräftiger Strafbefehl des Amtsgerichts Greiz.
Schließlich fuhr er am 2. April 2024 vorsätzlich ohne Fahrerlaubnis, was durch einen rechtskräftigen Strafbefehl des Amtsgerichts Greiz vom 5. August 2024 geahndet wurde.
Entwicklungen während der Bewährungszeit laut Bewährungshilfe
Die Bewährungshilfe berichtete dem Gericht mehrfach über den Verlauf der Bewährungszeit:
Ein erster Bericht vom 18. März 2024 schilderte, dass der Betroffene Kontakt zur Schuldenberatung aufgenommen hatte. Ein Drogentest sei jedoch positiv auf Amphetamine ausgefallen. Der Kontakt zur Bewährungshilfe wurde als zuverlässig beschrieben, und es erfolgten Vermittlungen in gemeinnützige Arbeit sowie in eine Suchtberatung. Trotz persönlicher Defizite des Mannes sah die Bewährungshilfe den Verlauf als positiv an und hielt zunächst keine gerichtlichen Maßnahmen für notwendig.
Ein weiterer Bericht vom 14. Oktober 2024 zeichnete ein kritischeres Bild: Der Betroffene hatte aufgrund von Mietrückständen seine Wohnung verloren und hielt sich abwechselnd bei seiner neuen Lebensgefährtin und seinen Eltern auf. Er hatte keine Arbeitsstelle und seine Bemühungen, eine zu finden, wurden als sehr begrenzt eingeschätzt. Er bezog Bürgergeld, und seine Schulden waren weiterhin ungelöst. Erschwerend kam hinzu, dass ein gemeinsames Kind mit der neuen Lebensgefährtin behindert war und intensive Pflege benötigte, einer Aufgabe, der der Betroffene laut Bericht nicht gewachsen schien. Er konsumierte weiterhin Drogen, obwohl der Kontakt zur Bewährungshilfe gut war. Die Suchtberatung besuchte er nur unregelmäßig, und die gemeinnützige Arbeit hatte er noch nicht geleistet. Der Bewährungsverlauf wurde insgesamt als mangelhaft bewertet, da die Einhaltung von Weisungen und Auflagen an seiner Drogensucht scheitere. Die Bewährungshilfe regte an, das Ergebnis weiterer Termine abzuwarten, bevor über gerichtliche Maßnahmen entschieden werde.
Ein dritter Bericht vom 23. Dezember 2024 signalisierte dann eine positive Wendung: Der Betroffene habe mit seinem bisherigen Umfeld abgeschlossen. Der Kontakt zu seinem älteren Sohn bestehe, der zur Tochter ruhe derzeit. Er sei seit drei Monaten abstinent von Drogen. Er suche nun eine Suchtberatung in T. auf, und ein Antrag auf eine Therapie sei in Vorbereitung. Die Arbeitsauflage habe er mittlerweile vollständig erfüllt.
Nichterfüllung von Auflagen und Weisungen
Die Auflage, 120 Stunden gemeinnützige Arbeit bis zum 3. Mai 2024 zu leisten, erfüllte der Betroffene nicht fristgerecht. Erst am 23. September 2024 begann er mit der Ableistung und beendete sie vollständig am 2. Dezember 2024.
Auch den Weisungen, insbesondere der Schuldenberatung (Nr. 3 b)), der Suchtberatung (Nr. 3 e)), der möglichen Entwöhnungsbehandlung (Nr. 3 f)) und der Spielsucht-Therapie (Nr. 3 h)), kam er laut den Berichten der Bewährungshilfe nicht unverzüglich nach. Zum Zeitpunkt des letzten Berichts im Dezember 2024 liefen jedoch die Suchtberatung und die Vorbereitung des Therapieantrags.
Der Gang durch die Instanzen: Landgericht widerruft die Bewährung
Antrag der Staatsanwaltschaft auf Widerruf
Aufgrund der neuen Straftaten und der Verstöße gegen Weisungen und Auflagen beantragte die Staatsanwaltschaft Gera am 24. Oktober 2024 den Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung. Konkret warf sie dem Betroffenen vor, gegen die Weisung zur Schuldenregulierung (Nr. 3 b)) und die Auflage zur Leistung gemeinnütziger Arbeit gröblich und beharrlich verstoßen zu haben. Ein gröblicher Verstoß ist ein objektiv und subjektiv schwerwiegender Verstoß, während ein beharrlicher Verstoß eine wiederholte Missachtung von Pflichten darstellt, die eine besondere Hartnäckigkeit zeigt.
Die Entscheidung des Landgerichts Gera: Widerruf
Der Betroffene wurde am 18. November 2024 vom Landgericht mündlich angehört. Sein Pflichtverteidiger und die Bewährungshilfe regten an, die Entscheidung über den Widerruf um zwei Monate zurückzustellen. Dies sollte dem Betroffenen die Chance geben, den Therapieantrag zu stellen und die Arbeitsstunden vollständig abzuleisten.
Das Landgericht Gera folgte diesem Vorschlag jedoch nicht und widerrief mit Beschluss vom selben Tag (18. November 2024) die Strafaussetzung. Es rechnete die bis dahin erbrachten Arbeitsstunden an. Das Gericht stützte seinen Widerruf auf § 56f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuches (StGB) – wegen der Begehung neuer Straftaten – und Nummer 2 StGB – wegen des Verstoßes gegen Weisungen. Nach Auffassung des Landgerichts hatten die neuen Straftaten gezeigt, dass die ursprüngliche positive Erwartung, der Mann werde sich auch ohne Strafvollzug bewähren, nicht erfüllt worden sei. Auch sah das Gericht keine Möglichkeit für eine alternative, mildere Maßnahme gemäß § 56f Absatz 2 StGB, wie etwa eine Verlängerung der Bewährungszeit oder die Erteilung neuer Auflagen und Weisungen.
Die Beschwerde vor dem Oberlandesgericht und die zentralen Streitpunkte
Die Argumente der Verteidigung
Gegen den Widerrufsbeschluss des Landgerichts legte der Verteidiger des Betroffenen am 25. November 2024 sofortige Beschwerde ein. Eine sofortige Beschwerde ist ein Rechtsmittel gegen bestimmte gerichtliche Entscheidungen, das eine zügige Überprüfung durch die nächsthöhere Instanz ermöglichen soll.
Zur Begründung führte er im Wesentlichen an, dass nach dem Umzug des Betroffenen ins Elternhaus eine Stabilisierung eingetreten sei. Der Drogenkonsum sei eingestellt worden, und Termine bei Beratungsstellen seien organisiert. Es müsse ihm Zeit gegeben werden, diese Stabilisierung nachzuweisen.
In späteren Schriftsätzen betonten der neu beauftragte Wahlverteidiger, der Betroffene selbst und seine Eltern ebenfalls die positiven Veränderungen in den Lebensumständen und die Bemühungen des Mannes.
Die Haltung der Generalstaatsanwaltschaft
Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft, die im Beschwerdeverfahren für die Anklagebehörde Stellung nahm, teilte die Auffassung des Landgerichts. Sie sah die neuen Bemühungen des Betroffenen als nicht ausreichend an und lehnte alternative Maßnahmen ab, da keine günstige Kriminalprognose gestellt werden könne. Die Kriminalprognose ist die auf Tatsachen gestützte Einschätzung, ob von einem Verurteilten zukünftig weitere Straftaten zu erwarten sind.
Die Erwiderung der Verteidigung und neue Entwicklungen
Die Verteidigung hielt dem entgegen, dass die neuen Straftaten geringfügig seien und die Verstöße gegen Auflagen und Weisungen nicht als gröblich oder beharrlich einzustufen seien. Durch die neuen Lebensumstände sei nunmehr eine positive Sozialprognose gegeben. Das Landgericht habe die aktuellen Sachverhalte im Anhörungstermin nicht vollständig berücksichtigt.
Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens bestätigte der Bewährungshelferbericht vom 23. Dezember 2024 die vollständige Erfüllung der Arbeitsauflage, eine dreimonatige Drogenabstinenz, die fortlaufende Inanspruchnahme der Suchtberatung und einen vorbereiteten Therapieantrag.
Damit lag dem Oberlandesgericht die zentrale Frage zur Entscheidung vor, ob die vom Landgericht angenommene negative Prognose und die Schwere der Verstöße den Widerruf der Bewährung rechtfertigten oder ob die jüngsten positiven Entwicklungen im Leben des Betroffenen ausreichten, um von einem Widerruf abzusehen und stattdessen mildere Mittel anzuwenden.
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts: Bewährungswiderruf aufgehoben, Bewährungszeit verlängert
Das Oberlandesgericht gab der sofortigen Beschwerde des Betroffenen statt und hob den Beschluss des Landgerichts Gera vom 18. November 2024 auf.
Anstelle des Widerrufs verlängerte das Oberlandesgericht die ursprünglich auf drei Jahre festgesetzte Bewährungszeit um ein halbes Jahr.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens wurden neu verteilt: Die Gerichtsgebühr wurde halbiert. Die Kosten der Staatskasse sowie die notwendigen Auslagen des Betroffenen (z.B. Anwaltskosten) wurden jeweils zur Hälfte von der Staatskasse und vom Betroffenen getragen.
Die wesentlichen Entscheidungsgründe des Oberlandesgerichts im Detail
Das Oberlandesgericht prüfte eingehend, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf der Strafaussetzung gemäß § 56f Absatz 1 StGB vorlagen und ob nicht mildere Maßnahmen nach § 56f Absatz 2 StGB ausreichend gewesen wären.
Grundsätzliche Erwägungen zum Widerruf der Strafaussetzung
Das Gericht stellte zunächst klar, dass ein Widerruf der Bewährung geboten ist, wenn sich entgegen der ursprünglichen positiven Prognose herausstellt, dass der Verurteilte ohne den Vollzug der Freiheitsstrafe voraussichtlich nicht straffrei bleiben kann. Ein Widerruf kann auch erfolgen, wenn der Verurteilte durch Verstöße gegen Auflagen zeigt, dass er den Sinn der Bewährung nicht verstanden hat und die mit den Auflagen verfolgte Genugtuungsfunktion – also ein gewisser Ausgleich für das begangene Unrecht – nicht realisiert werden kann. Entscheidend sind dabei Gründe, die nach der ursprünglichen Entscheidung über die Strafaussetzung und vor dem Ablauf der Bewährungszeit eingetreten sind.
Bewertung der neuen Straftaten: Reichen sie für eine ungünstige Prognose?
Gemäß § 56f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StGB kann die Bewährung widerrufen werden, wenn der Verurteilte in der Bewährungszeit eine Straftat begeht und dadurch zeigt, dass sich die Erwartung, die der Strafaussetzung zugrunde lag, nicht erfüllt hat.
Indizwirkung neuer Taten und Gesamtwürdigung
Das Oberlandesgericht betonte, dass neue Straftaten allein nicht automatisch zum Widerruf führen. Vielmehr muss der Verurteilte durch diese Taten gezeigt haben, dass die ursprüngliche positive Erwartung fehlgeschlagen ist und nun eine ungünstige Kriminalprognose vorliegt. Neue Taten sind dafür ein wichtiges Indiz, aber nicht zwingend ausschlaggebend. Der Widerruf ist keine zusätzliche Strafe für die neuen Taten, sondern eine Konsequenz aus der nunmehr negativ bewerteten Prognose.
Auch geringfügige Taten stehen einer günstigen Prognose nicht immer entgegen. Entscheidend ist der Zusammenhang zwischen der früheren Tat und den neuen Taten sowie die Frage, ob die neuen Taten auf eine von Anfang an falsche Prognose schließen lassen. Wichtig ist auch: Verbesserungen in den Lebensverhältnissen, die nach der Begehung der neuen Tat eintreten, können einem Widerruf entgegenstehen.
Die konkreten neuen Delikte und ihre Bewertung durch das Gericht
Das Gericht bezog sich auf die neuen Straftaten vom 26. März 2024 (Besitz von Betäubungsmitteln) und vom 2. April 2024 (vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis). Diese Taten seien zwar grundsätzlich geeignet, eine ungünstige Prognose zu indizieren.
Allerdings bewertete das Oberlandesgericht die neuen Taten als „eher geringfügig“. Sie wurden mit Geldstrafen von 40 bzw. 60 Tagessätzen geahndet. Die Anzahl der Tagessätze spiegelt die Schwere der Tat wider, während die Höhe eines einzelnen Tagessatzes von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters abhängt. Das Gericht sah diese Strafen „am unteren Rand der Kriminalität“.
Der entscheidende Faktor: Positive Veränderungen im Leben des Betroffenen nach den Taten
Trotz der neuen Verfehlungen hielt das Oberlandesgericht die Erwartung zukünftiger Straffreiheit des Betroffenen für gerechtfertigt. Ausschlaggebend hierfür waren die positiven Veränderungen seiner Lebensverhältnisse, die nach diesen letzten Straftaten eingetreten waren.
Der Betroffene hatte dem Gericht nachvollziehbar erklärt, dass ihm die Bewährungszeit bis März 2024 schwergefallen sei. Für die Taten selbst lieferte er eine Erklärung, die das Gericht seiner Entscheidung zugrunde legte: Das Fahren ohne Fahrerlaubnis sei aus Eile wegen der Geburt seiner Tochter geschehen, der Drogenbesitz im Zusammenhang mit dem Versuch, sein stillgelegtes Fahrzeug zu verkaufen.
Das Gericht ging von einer Drogenabstinenz des Betroffenen seit Ende September/Anfang Oktober 2024 aus. Dies wurde durch einen negativen Drogentest vom 9. Dezember 2024 untermauert, nachdem ein Test vom 25. Juli 2024 noch positiv auf Amphetamine ausgefallen war.
Weiterhin habe sich der Betroffene von der Mutter seiner Tochter getrennt und sich von dem ihn negativ beeinflussenden sozialen Umfeld in G. distanziert. Durch den Umzug zu seinen Eltern nach T. und deren Unterstützung habe er eine „Wende“ vollzogen und sei seither straffrei geblieben.
Er sei arbeitssuchend gemeldet, suche die Suchtberatung auf und bereite einen Therapieantrag vor.
Abwägung: Günstige Prognose trotz neuer Straftaten
Das Oberlandesgericht räumte ein, dass diese positiven Entwicklungen maßgeblich auch dem Druck des laufenden Widerrufsverfahrens geschuldet sein könnten. Dennoch überwogen für das Gericht die Aspekte, die für eine günstige Prognose sprachen.
Die neuen Straftaten wurden als „Ausrutscher“ in einer Phase bewertet, in der er sich noch nicht seinem negativen Umfeld entzogen hatte. Angesichts der vom Betroffenen dargelegten Motivation (insbesondere die Geburt des Kindes) und des geringen Gewichts der Taten zeugten sie nach Ansicht des Gerichts nicht von einer grundsätzlich rechtsfeindlichen Einstellung.
Daher sah das Gericht die Voraussetzungen für einen Widerruf allein aufgrund der neuen Straftaten nach § 56f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StGB als nicht erfüllt an.
Bewertung der Verstöße gegen Weisungen: Gefahr weiterer Straftaten?
Nach § 56f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StGB kann die Bewährung auch widerrufen werden, wenn der Verurteilte gröblich oder beharrlich gegen Weisungen verstößt und dadurch Anlass zu der Besorgnis gibt, dass er erneut Straftaten begehen wird.
Anforderungen an einen Widerruf wegen Weisungsverstoßes
Das Gericht stellte klar, dass ein Widerruf hier nicht als Strafe für bloße Disziplinlosigkeit dient. Es muss ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Weisungsverstoß und der konkreten Gefahr bestehen, dass der Verurteilte deswegen erneut Straftaten begehen wird. Das Gericht verwies hierbei auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 22. Juni 2007 – 2 BvR 1046/07).
Einschätzung der aktuellen Situation des Betroffenen
Nach dem aktuellen Sachstand, so das Oberlandesgericht, seien keine konkreten Umstände ersichtlich, die die Besorgnis weiterer Straftaten rechtfertigten. Die neuen Straftaten allein reichten dafür nicht aus.
Die Bewährungshilfe hatte die Zeit um die Geburt der Tochter des Betroffenen als „menschlich, emotional sehr angespannt“ und von „Zwangskontexten“ geprägt beschrieben. Sein Leben sei durch das erwartete Kind und „Drogen im Umfeld“ verkompliziert worden. Der Umzug zur damaligen Lebensgefährtin habe einen „Knacks“ verursacht, die spätere Trennung von ihr sei grundsätzlich positiv bewertet worden (Stichwort „Co-Abhängigkeit“). Nach dem Umzug zu seinen Eltern laufe er nun unter „knallharten Auflagen“ seiner Eltern „stabil“. Die Suchtproblematik anzugehen sei schwierig gewesen, auch wegen eines Zuständigkeitswechsels der Beratungsstellen, laufe aber nun an (Suchtberatung in T., Therapieantrag in Vorbereitung).
Ergebnis: Keine ausreichende Besorgnis künftiger Straftaten durch Weisungsverstöße
Das Oberlandesgericht gelangte zu der Einschätzung, der Betroffene erscheine derzeit als jemand, der „aufgewacht“ ist und seine Lebensverhältnisse aktiv ordnet. Es sah keine konkreten negativen Umstände, die aus seiner Persönlichkeit (kein aktueller Drogenkonsum erkennbar, Bezug von Bürgergeld reduziert das Risiko von Beschaffungskriminalität), seinem sozialen Umfeld (Loslösung vom negativen Umfeld, Unterstützung durch Eltern, Kontakt zum älteren Sohn, Pläne für weiteres ehrenamtliches Engagement und Umschulung) oder der Art und Schwere der Weisungsverstöße herrührten und die eine Gefahr weiterer Straftaten begründen würden.
Zwar habe der Betroffene den Weisungen zur Schuldenregulierung, Suchtberatung und Therapie (Nr. 3 e), f), h)) nicht „unverzüglich“ Folge geleistet, was eine „nachhaltig zu kritisierende Distanz“ zu seinen Pflichten gezeigt habe und wohl drogeninduziert sowie durch sein damaliges Umfeld erschwert worden sei. Weisungen seien jedoch – anders als manche Auflagen – in der Regel nicht zeitlich befristet, sondern bis zum Ablauf der Bewährungszeit zu erfüllen. Derzeit, so das Gericht, leiste er den Weisungen Folge. Die Verstöße allein ließen keine kriminelle Neigung zur gewohnheitsmäßigen Begehung von Straftaten erkennen.
Das Gericht fügte jedoch eine Warnung hinzu: Zukünftige positive Drogentests oder ein mangelnder Fortschritt bei der Therapie oder Schuldenregulierung würden jedoch ein gewichtiges Anzeichen für eine dann negative Prognose darstellen.
Somit waren auch die Voraussetzungen für einen Widerruf nach § 56f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StGB nicht gegeben.
Bewertung des Verstoßes gegen die Arbeitsauflage: Ein „gröblicher Verstoß“
Anders beurteilte das Gericht den Verstoß gegen die Auflage, gemeinnützige Arbeit zu leisten. Gemäß § 56f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StGB kann die Bewährung widerrufen werden, wenn der Verurteilte gröblich oder beharrlich gegen Auflagen verstößt.
Die Bedeutung der Arbeitsauflage im Ursprungsurteil
Das Landgericht Gera hatte in seinem Ursprungsurteil (dort Seite 53) dargelegt, dass die Auflage zur Leistung gemeinnütziger Arbeit entscheidend für die Gewährung der Strafaussetzung zur Bewährung war. Sie sollte der Wiedergutmachung dienen und dem Betroffenen einen Anreiz für eine geregelte Arbeitstätigkeit geben.
Die Nichterfüllung als schwerwiegender Verstoß
Die Nichterfüllung dieser Auflage (120 Stunden bis zum 3. Mai 2024) stellte nach Ansicht des Oberlandesgerichts einen Widerrufsgrund dar. Es handelte sich um einen gröblichen Verstoß. Ein solcher liegt vor, wenn der Verstoß sowohl objektiv (nach seinem äußeren Gewicht) als auch subjektiv (hinsichtlich der Vorwerfbarkeit) schwerwiegend ist.
Die Nichterfüllung innerhalb der gesetzten Frist wog objektiv und subjektiv schwer. Für die subjektive Vorwerfbarkeit genügt bereits Fahrlässigkeit. Der Betroffene war frühzeitig an eine Einsatzstelle vermittelt worden. Seine Erklärung, er habe keine Stunden leisten können, wenn er Arbeit gehabt hätte, überzeugte das Gericht nicht. Die Auflage war zu erbringen, solange keine stabile, geregelte Arbeit von mindestens 30 Stunden pro Woche vorlag. Er habe die Auflage vielmehr „schleifen“ lassen. Bis zum Ablauf der Frist am 3. Mai 2024 war keine einzige Stunde erbracht worden. Krankheitszeiten lagen überwiegend nach Fristablauf und konnten ihn insoweit nicht entlasten.
Damit lag ein Widerrufsgrund nach § 56f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StGB vor.
Die Rolle milderer Mittel: Vorrang vor dem Widerruf (§ 56f Abs. 2 StGB)
Wenn ein Widerrufsgrund – wie hier der gröbliche Verstoß gegen die Arbeitsauflage – vorliegt, muss das Gericht gemäß § 56f Absatz 2 StGB prüfen, ob nicht mildere Maßnahmen ausreichen, um den Zweck der Bewährung doch noch zu erreichen. Solche milderen Mittel können die Erteilung weiterer Auflagen oder Weisungen oder die Verlängerung der Bewährungszeit sein. Nur wenn solche Maßnahmen nicht ausreichen, darf die Bewährung widerrufen werden. Dies entspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Nachträgliche Erfüllung der Arbeitsauflage und ihre Wirkung
Das Oberlandesgericht entschied, dass hier mildere Mittel ausreichten. Weitere Auflagen sah es nicht als ersichtlich oder angemessen an. Entscheidend war, dass der mit der Arbeitsauflage verfolgte Zweck – ein Ausgleich für das begangene Unrecht (Genugtuungszweck) – durch die nachträgliche vollständige Erfüllung der 120 Arbeitsstunden eingetreten war.
Eine Ausweitung der Arbeitsstunden wegen der neuen Straftaten wäre nur zulässig gewesen, wenn diese neuen Taten mit der ursprünglichen Tat vergleichbar wären und die Genugtuung speziell für die ursprüngliche Tat beeinträchtigen würden. Das war hier nicht der Fall, da die neuen Taten geringfügig waren. Eine verschärfte Auflagenerteilung dürfe nicht dazu dienen, bewährungsbrüchiges Verhalten disziplinarisch zu sanktionieren. Eine nachträgliche Änderung von Auflagen nach § 56e StGB kam im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nach § 309 Absatz 2 der Strafprozessordnung (StPO) – wonach das Beschwerdegericht in der Sache selbst entscheidet – nicht in Betracht.
Warum eine Verlängerung der Bewährungszeit ausreicht
Als angemessene Maßnahme sah das Gericht die Verlängerung der Bewährungszeit an. Es verwies auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg (Beschluss vom 30. August 2004), wonach eine Verlängerung der Bewährungszeit in Betracht kommt, wenn die Auflage – wie hier – unter dem Eindruck des Widerrufsverfahrens doch noch erfüllt wird.
Da der Betroffene die Arbeitsauflage mittlerweile vollständig erbracht hatte, reichte nach Ansicht des Oberlandesgerichts eine Verlängerung der Bewährungszeit um sechs Monate aus. Es gebe keine weiteren Umstände, die für den Genugtuungsaspekt von Bedeutung wären und eine längere Verlängerung oder gar den Widerruf erforderten.
Kostenentscheidung im Beschwerdeverfahren
Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens stützte das Gericht auf § 473 Absatz 4 StPO. Diese Vorschrift regelt die Kostenverteilung, wenn ein Rechtsmittel teilweise Erfolg hat. Die Aufhebung des Widerrufsbeschlusses und die stattdessen erfolgte Verlängerung der Bewährungszeit wertete das Gericht als einen solchen Teilerfolg für den Betroffenen.
Da das Rechtsmittel vermutlich nicht eingelegt worden wäre, wenn das Landgericht bereits die nun vom Oberlandesgericht getroffene Entscheidung (Verlängerung statt Widerruf) gefällt hätte, sei eine Ermäßigung der Gerichtsgebühr um die Hälfte und eine hälftige Teilung der Auslagen zwischen der Staatskasse und dem Betroffenen angemessen und entspreche der Billigkeit.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil zeigt, dass ein Bewährungswiderruf trotz neuer Straftaten und Verstößen gegen Bewährungsauflagen nicht zwingend erfolgen muss, wenn eine positive Lebensentwicklung beim Betroffenen erkennbar ist. Entscheidend für die Beurteilung sind nicht nur die Verfehlungen selbst, sondern vor allem die aktuelle Lebenssituation und Zukunftsprognose – in diesem Fall wurden die Distanzierung vom negativen Umfeld, die nachgeholte Erfüllung von Auflagen und die begonnene Drogenabstinenz höher bewertet als die begangenen Verstöße. Wir lernen, dass Gerichte einen Ermessensspielraum haben und mildere Maßnahmen wie eine Bewährungszeitverlängerung dem Widerruf vorzuziehen sind, wenn dadurch der Zweck der Bewährung noch erreicht werden kann.
Befinden Sie sich in einer ähnlichen Situation? Fragen Sie unsere Ersteinschätzung an.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet Strafaussetzung zur Bewährung genau?
Wenn ein Gericht eine Strafe ausspricht, insbesondere eine Freiheitsstrafe (Gefängnisstrafe), kann es unter bestimmten Voraussetzungen entscheiden, dass die verurteilte Person die Strafe nicht sofort antreten muss. Diesen Aufschub nennt man Strafaussetzung zur Bewährung.
Wie funktioniert die Bewährung?
Im Grunde ist es eine Chance, sich außerhalb des Gefängnisses zu bewähren, also zu zeigen, dass man in Zukunft keine Straftaten mehr begehen wird. Das Gericht legt dafür eine bestimmte Zeit fest, die sogenannte Bewährungszeit. Diese kann zwischen zwei und fünf Jahren liegen. Während dieser Zeit steht die verurteilte Person „unter Bewährung“.
Was passiert während der Bewährungszeit?
Während der Bewährungszeit muss sich die verurteilte Person bewähren. Das bedeutet vor allem: Sie darf keine neuen Straftaten begehen. Zusätzlich kann das Gericht weitere Bedingungen festlegen, um die Resozialisierung zu unterstützen und künftige Straftaten zu verhindern. Solche Bedingungen können Auflagen und Weisungen sein.
- Auflagen sind meist Pflichten, die einmalig oder in einem bestimmten Zeitraum erfüllt werden müssen, zum Beispiel:
- Zahlung eines Geldbetrages an eine gemeinnützige Einrichtung.
- Wiedergutmachung des verursachten Schadens (Schadenswiedergutmachung).
- Weisungen sind Verhaltensregeln für die gesamte Bewährungszeit, zum Beispiel:
- Sich regelmäßig bei einer bestimmten Stelle melden.
- Keinen Kontakt zu bestimmten Personen aufnehmen.
- Sich um Arbeit bemühen.
- Sich einer Therapie oder Behandlung unterziehen.
Ein Bewährungshelfer kann zur Seite gestellt werden, um die Einhaltung der Weisungen zu überwachen und bei Problemen zu unterstützen.
Was geschieht nach der Bewährungszeit?
Wenn die Bewährungszeit erfolgreich verstreicht, das heißt, die verurteilte Person hat sich bewährt und die Auflagen und Weisungen erfüllt, dann wird die ursprünglich verhängte Strafe erlassen. Sie muss dann nicht mehr verbüßt werden. Die Person gilt aber weiterhin als vorbestraft, wenn die Strafe in das Führungszeugnis eingetragen wird (was ab bestimmten Strafhöhen der Fall ist).
Was passiert bei Verstößen?
Hält sich die verurteilte Person während der Bewährungszeit nicht an die Auflagen oder Weisungen, oder begeht sie eine neue Straftat, kann das Gericht die Strafaussetzung widerrufen. Das bedeutet, die ursprünglich ausgesprochene Freiheitsstrafe muss dann doch noch angetreten werden. Bevor es zum Widerruf kommt, kann das Gericht auch andere Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel die Bewährungszeit verlängern oder neue Auflagen/Weisungen festlegen.
Zusammenfassend ist die Strafaussetzung zur Bewährung also eine Möglichkeit, eine Freiheitsstrafe unter bestimmten Bedingungen nicht im Gefängnis verbüßen zu müssen, sondern die Chance zu erhalten, sich in Freiheit zu bewähren.
Welche Faktoren können dazu führen, dass eine Bewährung widerrufen wird?
Wenn eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, ist das eine Chance, die Strafe nicht im Gefängnis verbüßen zu müssen. Diese Chance ist aber an bestimmte Bedingungen geknüpft. Wenn diese Bedingungen nicht eingehalten werden, kann die Bewährung entzogen werden. Diesen Entzug nennt man Widerruf der Bewährung.
Zwei Hauptgründe können zu einem solchen Widerruf führen:
Das Begehen einer neuen Straftat
Der häufigste Grund für einen Widerruf ist, wenn die verurteilte Person innerhalb der Bewährungszeit eine neue Straftat begeht. Dabei ist wichtig: Nicht jede neue Straftat führt automatisch zum Widerruf. Das Gericht prüft, ob die neue Straftat zeigt, dass die Person die Warnung durch die frühere Verurteilung nicht verstanden hat und wieder straffällig wird. Das Gericht schätzt also ein, ob die ursprüngliche positive Vorhersage (Prognose), dass sich die Person bewähren wird, durch die neue Tat hinfällig geworden ist. Besonders schwerwiegende neue Taten oder solche, die ähnlich sind wie die ursprüngliche Tat, erhöhen das Risiko eines Widerrufs erheblich.
Verstöße gegen Auflagen und Weisungen
Das Gericht kann bei der Bewährungsstrafe bestimmte Auflagen oder Weisungen erteilen.
- Auflagen sind meist Leistungen, die erbracht werden müssen, wie zum Beispiel die Zahlung eines Geldbetrages an eine gemeinnützige Organisation oder an das Opfer.
- Weisungen sind Verhaltensregeln für die Zukunft. Das können zum Beispiel die Verpflichtung sein, sich regelmäßig bei Gericht zu melden, Kontakt zu bestimmten Personen zu meiden oder eine Therapie zu machen.
Ein schwerwiegender oder beharrlicher Verstoß gegen solche Auflagen oder Weisungen kann ebenfalls zum Widerruf der Bewährung führen. Es geht dabei nicht um kleinere Versäumnisse, sondern um die Weigerung oder das ständige Nichtbeachten der vom Gericht angeordneten Pflichten. Auch hier prüft das Gericht, ob der Verstoß zeigt, dass die Person nicht bereit ist, sich an die Regeln zu halten und sich zu bewähren.
Die Entscheidung des Gerichts
Wichtig ist zu wissen: Auch wenn einer der genannten Gründe vorliegt, entscheidet das Gericht immer im Einzelfall, ob die Bewährung widerrufen wird. Es gibt einen Spielraum für das Gericht. Es berücksichtigt dabei die Schwere des Verstoßes oder der neuen Straftat, wie lange die Bewährungszeit schon problemlos lief und die gesamte Entwicklung der Person während der Bewährungszeit. Manchmal kann das Gericht statt eines Widerrufs auch die Bewährungszeit verlängern oder neue Auflagen und Weisungen hinzufügen, um der Person eine weitere Chance zu geben. Ein Widerruf ist oft das letzte Mittel, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen oder nicht mehr sinnvoll erscheinen.
Was ist der Unterschied zwischen Auflagen und Weisungen während der Bewährungszeit?
Wenn eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, bedeutet das, dass die Strafe nicht sofort im Gefängnis verbüßt werden muss. Stattdessen wird der Verurteilte für einen bestimmten Zeitraum, die sogenannte Bewährungszeit, freigelassen. Das Gericht knüpft diese Chance aber oft an bestimmte Bedingungen, damit sich der Verurteilte bewährt und künftig straffrei lebt. Diese Bedingungen nennt man Auflagen und Weisungen.
Der entscheidende Unterschied liegt in ihrer Funktion und ihrem Charakter:
Auflagen haben in der Regel einen kompensatorischen oder finanziellen Zweck. Sie dienen oft dazu, den angerichteten Schaden wiedergutzumachen oder eine Leistung zu erbringen, die als Ausgleich für die Straftat gesehen wird.
- Beispiele für Auflagen:
- Zahlung eines bestimmten Geldbetrags an eine gemeinnützige Organisation.
- Zahlung einer Wiedergutmachung an das Opfer (Schmerzensgeld, Schadensersatz).
- Ableistung gemeinnütziger Arbeit (unentgeltliche Stunden für eine soziale Einrichtung).
Stellen Sie sich Auflagen wie eine Art „Wiedergutmachungsaufgabe“ vor, bei der es darum geht, etwas zu leisten, um die Folgen der Tat abzumildern oder Verantwortung zu übernehmen.
Weisungen zielen dagegen auf das zukünftige Verhalten und die Lebensführung des Verurteilten ab. Sie sollen helfen, die Ursachen der Straftat zu bekämpfen und ein straffreies Leben zu ermöglichen. Sie regeln, wie sich der Verurteilte während der Bewährungszeit verhalten soll.
- Beispiele für Weisungen:
- Regelmäßige Meldung bei Gericht oder einer Bewährungshelferin/einem Bewährungshelfer.
- Anweisung, sich um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine Ausbildung aufzunehmen.
- Teilnahme an einer Therapie (z.B. Suchttherapie, Anti-Gewalt-Training).
- Verbot des Umgangs mit bestimmten Personen oder des Aufenthalts an bestimmten Orten.
Weisungen sind eher „Verhaltensregeln“ oder „Unterstützungsangebote“, die direkt darauf abzielen, das Leben des Verurteilten in geordnete Bahnen zu lenken und neue Straftaten zu verhindern.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Auflagen fordern meist eine einmalige oder finanzielle Leistung als Wiedergutmachung, während Weisungen das Verhalten und die Lebensführung während der gesamten Bewährungszeit steuern sollen. Beides sind wichtige Bedingungen, deren Einhaltung für den erfolgreichen Abschluss der Bewährungszeit und damit das endgültige Absehen von der Strafe entscheidend ist. Werden Auflagen oder Weisungen schuldhaft nicht erfüllt, kann das Gericht die zur Bewährung ausgesetzte Strafe widerrufen, was bedeutet, dass die Freiheitsstrafe dann doch verbüßt werden muss.
Welche Rolle spielt die positive Lebensentwicklung des Verurteilten bei der Entscheidung über den Bewährungswiderruf?
Die positive persönliche Entwicklung eines Verurteilten spielt bei der Entscheidung, ob eine Bewährung widerrufen wird, tatsächlich eine sehr wichtige Rolle. Auch wenn während der Bewährungszeit eine neue Straftat begangen wurde, ist dies nicht automatisch das Ende der Bewährung.
Der Grundsatz der Bewährung ist, dass das Gericht dem Verurteilten eine Chance gibt, sich außerhalb des Gefängnisses zu bewähren und ein straffreies Leben zu führen. Dabei vertraut das Gericht darauf, dass die Person aus früheren Fehlern gelernt hat.
Wenn eine Person auf Bewährung erneut straffällig wird oder gegen Auflagen verstößt, kann das Gericht die Bewährung grundsätzlich widerrufen. Es muss dann entschieden werden, ob die ursprünglich ausgesetzte Strafe doch vollstreckt (also im Gefängnis verbüßt) werden muss.
An dieser Stelle kommt die positive Entwicklung ins Spiel. Das Gericht trifft keine automatische Entscheidung, sondern muss den Gesamteindruck bewerten. Es wird geprüft, ob trotz des Rückfalls (der neuen Straftat oder des Verstoßes) insgesamt noch zu erwarten ist, dass der Verurteilte künftig keine Straftaten mehr begehen wird. Dies nennt man auch die Prognose.
Eine positive Entwicklung kann die negative Wirkung eines Rückfalls abmildern. Sie zeigt dem Gericht, dass die Person sich bemüht, ihr Leben in den Griff zu bekommen und sich von ihrem früheren kriminellen Verhalten abwendet, auch wenn es zu einem einmaligen oder isolierten Rückfall gekommen ist.
Das Gericht führt eine Abwägung durch: Es stellt die Schwere des neuen Fehlers der positiven Entwicklung gegenüber. Je schwerer die neue Straftat ist, desto schwieriger wird es für die positive Entwicklung, die Entscheidung zu beeinflussen. Bei weniger schwerwiegenden Rückfällen oder Verstößen kann die positive Entwicklung jedoch ausschlaggebend sein, damit die Bewährung nicht widerrufen wird. Möglicherweise verhängt das Gericht dann stattdessen neue oder zusätzliche Auflagen oder Weisungen.
Welche Nachweise sind für eine positive Entwicklung relevant?
Um eine positive Entwicklung belegen zu können, sind konkrete Schritte und Verhaltensweisen wichtig, die zeigen, dass sich die Lebensumstände stabilisiert haben und die Person sich vom kriminellen Umfeld oder Verhaltensmustern distanziert. Relevante Nachweise können zum Beispiel sein:
- Stabile Arbeitsverhältnisse: Nachweis einer festen Anstellung oder selbstständigen Tätigkeit.
- Stabile Wohnsituation: Nachweis eines festen Wohnsitzes, idealerweise in einem unauffälligen Umfeld.
- Abstand zum früheren Umfeld: Beleg, dass der Kontakt zu Personen oder Orten, die mit früheren Straftaten in Verbindung stehen, abgebrochen wurde.
- Aufarbeitung von Problemen: Nachweise über die Teilnahme an Therapien (z.B. Suchttherapie, Anti-Gewalt-Training), Schuldnerberatung oder Bemühungen zur Schadenswiedergutmachung gegenüber Opfern.
- Einhalten von Auflagen und Weisungen: Zuverlässige Wahrnehmung von Terminen bei der Bewährungshelferin oder dem Bewährungshelfer.
- Soziale Integration: Aufbau positiver sozialer Kontakte, Engagement in Vereinen oder ähnlichem.
- Einsicht und Reue: Ernsthafte Auseinandersetzung mit den eigenen Taten und glaubhafte Bekundung des Willens zur Besserung.
Diese Nachweise helfen dem Gericht bei der Prognoseentscheidung und können dazu beitragen, dass trotz eines Rückfalls von einem Bewährungswiderruf abgesehen wird, weil die positive Entwicklung insgesamt überwiegt.
Was bedeutet es, wenn ein Gericht eine nachträgliche Gesamtstrafe ablehnt?
Stellen Sie sich vor, jemand wird wegen mehrerer Straftaten verurteilt. Es kann vorkommen, dass diese Verurteilungen zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen, aber die Taten schon begangen wurden, bevor die erste Strafe „rechtskräftig“ wurde – also endgültig entschieden war und nicht mehr mit normalen Rechtsmitteln angefochten werden konnte.
In solchen Fällen sieht das Gesetz (in Deutschland ist das in § 55 des Strafgesetzbuches geregelt) vor, dass die einzelnen Strafen zu einer sogenannten Gesamtstrafe zusammengefasst werden können. Das ist wie bei mehreren Rechnungen, die man zu einer einzigen, meist niedrigeren Gesamtsumme zusammenfasst, anstatt jede einzeln und voll zu bezahlen.
Der große Vorteil einer Gesamtstrafe ist in der Regel, dass die Gesamtstrafe geringer ausfällt als die Summe der einzelnen Strafen. Das Gericht geht dabei von der höchsten Einzelstrafe aus und erhöht diese angemessen, aber eben nicht bis zur vollen Summe aller Strafen. Für den Verurteilten bedeutet das oft eine kürzere Haftdauer oder eine geringere Geldbuße insgesamt. Deshalb ist eine Gesamtstrafe für den Betroffenen in der Regel vorteilhaft.
Wenn ein Gericht nun eine nachträgliche Gesamtstrafe ablehnt, bedeutet das schlichtweg, dass die Voraussetzungen für eine solche Zusammenfassung im konkreten Fall nicht erfüllt sind.
Was sind die Folgen der Ablehnung einer Gesamtstrafe?
Für den Verurteilten hat die Ablehnung einer Gesamtstrafe eine klare Konsequenz: Die bereits verhängten einzelnen Strafen bleiben bestehen und müssen separat verbüßt oder bezahlt werden.
Anstatt einer einzigen, womöglich geringeren Gesamtstrafe, müssen die einzelnen Strafen nacheinander vollstreckt werden. Dies führt im Ergebnis fast immer zu einer längeren Gesamtdauer der Bestrafung (Haft oder Zahlung) als es bei einer Gesamtstrafe der Fall gewesen wäre.
Die Ablehnung durch das Gericht zeigt also, dass die gesetzlichen Bedingungen, die eine Straffung und Minderung der Gesamtbelastung durch die Bildung einer Gesamtstrafe ermöglichen würden, im vorliegenden Sachverhalt nicht gegeben sind. Ein typischer Grund dafür kann sein, dass die Straftaten nicht in der notwendigen zeitlichen Beziehung zueinander standen, also beispielsweise eine neue Tat erst begangen wurde, nachdem die Strafe für eine frühere Tat bereits rechtskräftig geworden war. In solchen Fällen ist eine nachträgliche Gesamtstrafenbildung gesetzlich nicht vorgesehen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Strafaussetzung zur Bewährung
Die Strafaussetzung zur Bewährung bedeutet, dass eine verhängte Freiheitsstrafe nicht sofort im Gefängnis verbüßt werden muss. Stattdessen wird die Strafe für eine bestimmte Zeit – die Bewährungszeit – „ausgesetzt“, sodass der Verurteilte die Chance erhält, sich in Freiheit bewähren zu können. Voraussetzung ist, dass er während dieser Zeit keine weiteren Straftaten begeht und festgelegte Auflagen und Weisungen erfüllt. Wird die Bewährungszeit erfolgreich abgeschlossen, entfällt die Vollstreckung der Strafe (§ 56 StGB). Beispiel: Jemand wird zu 1 Jahr Haft verurteilt, kann diese Strafe aber zunächst zu Hause verbüßen, wenn er sich nichts zuschulden kommen lässt.
Widerruf der Bewährung
Ein Widerruf der Bewährung bedeutet, dass die zuvor ausgesetzte Freiheitsstrafe doch noch vollstreckt werden muss. Dies geschieht, wenn der Verurteilte während der Bewährungszeit eine neue Straftat begeht oder schwerwiegend gegen Auflagen oder Weisungen verstößt und dadurch die ursprüngliche positive Prognose als nicht mehr gegeben angesehen wird (§ 56f StGB). Der Widerruf hebt die Strafaussetzung auf und beendet die Bewährung, sodass der Verurteilte ins Gefängnis muss. Beispiel: Eine Person wird auf Bewährung verurteilt, fährt aber während der Bewährung ohne Führerschein; das Gericht entscheidet deshalb, die Haftstrafe anzuordnen.
Auflagen und Weisungen im Bewährungsverfahren
Auflagen sind konkrete Leistungen, die der Verurteilte während der Bewährungszeit erbringen muss, wie etwa gemeinnützige Arbeit oder Schadensersatz. Sie haben oft einen Ausgleichs- oder Genugtuungszweck. Weisungen hingegen sind laufende Verhaltensregeln, mit denen das Gericht das künftige Verhalten steuern will, z. B. die Pflicht, an Therapien teilzunehmen oder sich regelmäßig bei der Bewährungshilfe zu melden. Beide sind verbindliche Bedingungen der Bewährung; Verstöße können zum Widerruf führen (§ 56b StGB). Beispiel: Die Auflage, 120 Stunden unentgeltliche Arbeit zu leisten, und die Weisung, eine Suchtberatung aufzusuchen.
Gesamtstrafe
Eine Gesamtstrafe entsteht, wenn mehrere Strafen, die der Verurteilte für verschiedene Taten erhalten hat, zu einer einzigen, häufig milderen Strafe zusammengefasst werden (§ 55 StGB). Dabei wird nicht einfach die Summe aller Strafen vollstreckt, sondern es gilt ein milderes Gesamtmaß. Die Bildung einer Gesamtstrafe ist vorteilhaft, weil sie die Strafhöhe reduziert und die Vollstreckung vereinheitlicht. Wird eine nachträgliche Gesamtstrafe abgelehnt, bleiben alle Einzelstrafen einzeln bestehen. Beispiel: Jemand wurde für mehrere Straftaten getrennt verurteilt; das Gericht entscheidet, statt drei Einzelstrafen nur eine Gesamtstrafe von geringerer Dauer zu verhängen.
Kriminalprognose
Die Kriminalprognose ist die Einschätzung des Gerichts, ob von einer verurteilten Person zukünftig eine Gefahr ausgeht, weitere Straftaten zu begehen. Sie basiert auf Fakten, bisherigen Verhaltensweisen, Persönlichkeitsentwicklung und Umständen des Betroffenen. Eine günstige Kriminalprognose ist die Voraussetzung dafür, dass eine Strafaussetzung zur Bewährung überhaupt gewährt oder erhalten bleibt (§ 56 StGB). Beispiel: Ein Gericht prüft, ob jemand, der unter Bewährung steht, sich so verändert hat, dass er künftig straffrei lebt, oder ob die Rückfallgefahr zu groß ist.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 56f Absatz 1 Satz 1 StGB (Strafgesetzbuch): Regelt den Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung bei neuen Straftaten oder Verstößen gegen Weisungen und Auflagen. Widerruf ist möglich, wenn sich herausstellt, dass der Verurteilte ohne Vollzug der Freiheitsstrafe voraussichtlich nicht straffrei bleiben wird. | Bedeutung im vorliegenden Fall: War zentral für die Widerrufsentscheidung des Landgerichts und die Prüfung des Oberlandesgerichts, ob neue Straftaten und Auflagenverstöße die Prognose einer künftigen straffreien Lebensführung endgültig entkräften.
- § 56f Absatz 2 StGB: Verlangt bei Vorliegen eines Widerrufsgrundes die Prüfung milderer Mittel vor einem Widerruf, z. B. Verlängerung der Bewährungszeit oder Erteilung weiterer Auflagen. Der Widerruf ist nur zulässig, wenn mildere Maßnahmen nicht ausreichen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Grundlage für die Entscheidung des Oberlandesgerichts, den Bewährungswiderruf aufzuheben und stattdessen die Bewährungszeit zu verlängern, da die nachträgliche Erfüllung der Auflagen und positive Entwicklung mildernde Maßnahmen ermöglichen.
- § 56e StGB: Erlaubt die nachträgliche Änderung von Auflagen und Weisungen während der Bewährungszeit. Diese Anpassungen können neue Anforderungen stellen, um der Lebenssituation und dem Verhalten des Verurteilten Rechnung zu tragen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Wurde vom Oberlandesgericht geprüft, aber als nicht einschlägig beurteilt, da das Beschwerdegericht den Fall in der Sache selbst entschied und keine neue Auflage erließ.
- § 309 Absatz 2 StPO (Strafprozessordnung): Bestimmt, dass das Rechtsmittelgericht in der Sache selbst entscheidet und diese frei bewertet. Dies ermöglicht eine umfassende Überprüfung und Neuregelung der Entscheidung der Vorinstanz. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Ermöglichte dem Oberlandesgericht, den Widerruf des Landgerichts vollständig aufzuheben und stattdessen mildere Maßnahmen anzuordnen.
- Strafbefehl (vgl. §§ 407 ff. StPO): Ein schriftliches Urteil ohne mündliche Hauptverhandlung für geringere Straftaten, das rechtskräftig und bindend ist. Summiert die rechtliche Bewertung von kleineren Delikten, die im Kontext einer Bewährungsentscheidung relevant sein können. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Belegte die erneuten, geringfügigen Straftaten des Betroffenen und bildete eine Grundlage für die Einschätzung der Schwere und Indizwirkung neuer Verstöße im Bewährungsverfahren.
- Kriminalprognose: Eine auf Tatsachen gestützte Einschätzung, ob von einem Verurteilten in Zukunft weitere Straftaten zu erwarten sind. Sie umfasst soziale, persönliche und verhaltensbezogene Aspekte. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Kernkriterium bei der Abwägung, ob der Widerruf gerechtfertigt ist; das Oberlandesgericht stellte eine günstige Prognose aufgrund der positiven Lebensentwicklung trotz vorheriger Verfehlungen fest.
- § 473 Absatz 4 StPO: Regelt im Rechtsmittelverfahren die Kostenverteilung bei Teilerfolg, sodass Gerichtsgebühren und Auslagen gerecht zwischen den Parteien aufgeteilt werden können. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Grundlage für die faire Kostenentscheidung nach dem Teilerfolg des Betroffenen bei der Aufhebung des Widerrufs und Verlängerung der Bewährungszeit.
Das vorliegende Urteil
Oberlandesgericht Thüringen – Az.: 3 Ws 479/24 – Beschluss vom 30.01.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.