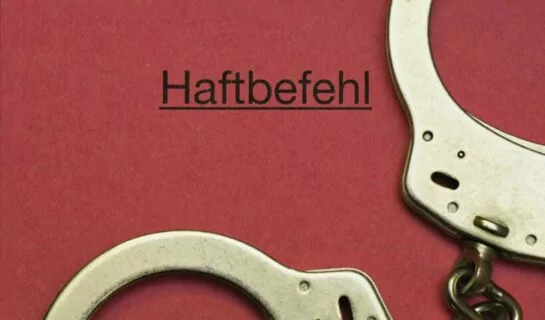1. Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen den Beschluss des Amtsgerichts Potsdam vom 28. Januar 2025 – Az.: 76 Gs 143/24 – wird als unbegründet verworfen.
2. Die Staatskasse hat die Kosten des Rechtsmittels zu tragen.
Gründe
I.
Der straf- uns verkehrsrechtlich nicht vorbelastete Beschuldigte, der im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B ist, befuhr am frühen Morgen des 3. Oktober 2025 um 3:50 Uhr mit einem E-Scooter der Marke O. des Sharing-Anbieters T. den Radweg der B.- Straße in Potsdam in Richtung L.-Brücke. Dabei legte er Fahrtstrecke von mindestens 150 Metern zurück. Die um 4:45 Uhr entnommene Blutprobe ergab eine Blutalkoholkonzentration (BAK) von 1,44 ‰.
Den Antrag der Staatsanwaltschaft Potsdam vom 27. Dezember 2024 auf Entziehung der Fahrerlaubnis sowie Durchsuchung der Wohnung u.a. zu dem Zwecke, den Führerschein aufzufinden, falls dieser nicht freiwillig herausgegeben werde, wurde mit Beschluss des Amtsgerichts Potsdam vom 28. Januar 2025 (Az.: 76 Gs 143/24) mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Voraussetzungen der Regelvermutung gemäß § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB im Hinblick auf das mit sog. Pedelecs (Pedal Electric Cycles) vergleichbare Gefährdungspotential, eine geringere Fahrgeschwindigkeit sowie eine geringere Eigen- und Fremdgefährdung nicht vorlägen.
Hiergegen wendet sich die Staatsanwaltschaft Potsdam mit Beschwerde vom 3. Februar 2025, mit dem sie das Ziel ihres Antrags vom 27. Dezember 2024 – Entziehung der Fahrerlaubnis sowie Durchsuchung – weiterverfolgt.
Das Amtsgericht Potsdam hat der Beschwerde nicht abgeholfen. Das Landgericht hat dem Beschuldigten mit Verfügung vom 21. Februar 2025 Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt.
II.
Die gemäß § 304 Abs. 1 StPO statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Denn die Voraussetzungen der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 111a Abs. 1 S. 1 StPO liegen nicht vor.
Nach dieser Vorschrift kann einem Beschuldigten die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen werden, wenn dringende Gründe dafür vorliegen, dass ihm die Fahrerlaubnis zum Schluss des Strafverfahrens gemäß § 69 StGB entzogen werden wird. Das ist gemäß § 69 Abs. 1 StGB dann der Fall, wenn der Beschuldigte wegen einer rechtswidrigen Tat, die er bei dem Führen eines Kraftfahrzeugs begangen hat, verurteilt wird und sich aus der Tat ergibt, dass er zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist.
Das ist vorliegend jedoch nicht der Fall.
Es ist bereits zweifelhaft, ob der Beschuldigte dringend verdächtig ist, sich nach § 316 StGB strafbar gemacht zu haben (dazu 1.). Es kann jedenfalls nicht angenommen werden, dass er eine rechtswidrige Tat im Sinne des § 69 Abs. 1 S. 1 StGB begangen hat, aus der sich ergibt, dass er zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist (dazu 2.).
1. Es ist zweifelhaft, ob der Beschuldigte durch das Fahren mit dem E-Scooter mit einer BAK von 1,44 ‰ ein Fahrzeug geführt hat, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage gewesen ist, dieses sicher zu führen.
a) Vorliegend ist eine BAK von 1,44 ‰ im Tatzeitpunkt zugrunde zu legen. Die 55 Minuten nach der Tat entnommene Blutprobe wies eine entsprechende Höhe der BAK auf.
Aufgrund des körpereigenen Abbaus von Alkohol, bedarf es zwar grundsätzlich der Rückrechnung auf die erhöhte BAK im Tatzeitpunkt. Da die sog. Anflutungs- oder Resorptionsphase, also des Zeitraumes, innerhalb dessen der aufgenommene Alkohol in das Blut übergeht, bis zu 120 Minuten andauern kann, ist bei einer Blutentnahme innerhalb dieser Zeitspanne seit der Tatbegehung und bei einem unbekannten Trinkende in dubio pro reo zu unterstellen, dass die Alkoholaufnahme erst unmittelbar vor dem Tatzeitpunkt beendet war. Es ist daher davon auszugehen, dass die Resorptionsphase im Zeitpunkt der Blutentnahme noch nicht abgeschlossen war. Daher ist vorliegend vom BAK-Wert im Blutentnahmezeitpunkt auszugehen.
b) Fahrunsicherheit im Sinne des § 316 StGB ist gegeben, wenn die Gesamtleistungsfähigkeit des Fahrzeugführers, etwa infolge Enthemmung, so weit herabgesetzt ist, dass er nicht mehr fähig ist, ein Fahrzeug der jeweiligen Verkehrsart eine längere Strecke und auch bei plötzlichem Eintritt schwieriger Verkehrslagen, sicher zu steuern (BGHSt 13 83, 90; König, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2020, § 316 StGB, Rn. 11).
aa) Dass eine Person nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen, kann nach ständiger Rechtsprechung einerseits dadurch festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer mindestens eine BAK von 0,3 ‰ aufweist und infolge dieser Alkoholisierung Ausfallerscheinungen zeigt – sog. relative Fahruntüchtigkeit.
bb) Dass ein Fahrzeug nicht sicher geführt werden kann, kann aber auch dadurch festgestellt werden, dass die BAK derart hoch ist, dass nach allgemeinem Erfahrungswissen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das sichere Führen eines entsprechenden Fahrzeugs im Straßenverkehr – mithin für jedermann – ausgeschlossen werden kann, insbesondere auch unabhängig von einer individuellen Alkoholverträglichkeit oder einer besonderen Fahrbefähigung des Einzelnen (BGH NJW 1967, 116, 117) – sog. absolute Fahruntüchtigkeit. Es genügt dabei eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, da eine absolute Gewissheit für den maßgeblichen naturwissenschaftlichen Bereich nicht möglich ist (BGH NJW 1967, 116, 117), sodass es gleichwohl der juristischen Bewertung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse bedarf (BGH NJW 1990, 2393, 2394). Bei der absoluten Fahruntüchtigkeit handelt es sich insofern um ein „scharfes Schwert“ (Pegel, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 316 StGB, Rn. 49) als dass der Gegenbeweis mit der Erreichung der BAK unwiderleglich ist.
(1) Nach den hergebrachten Grundsätzen des Bundesgerichtshofs handelt es sich bei der absoluten Fahruntüchtigkeit nicht um einen Grad der Trunkenheit oder um die Qualität der alkoholbedingten Leistungsminderung, sondern allein um die Art und Weise, wie der Nachweis der Fahruntüchtigkeit zu führen ist (BGH, Urteil vom 22. April 1982 – 4 StR 43/82, Rn. 7, juris). Der jeweilige Wert beruht dabei auf der – unter Beachtung des Zweifelsgrundsatzes gewonnenen – Annahme, dass jeder entsprechend alkoholisierte Fahrer fahrunsicher ist.
Demnach bedarf es zur Ermittlung des entsprechenden BAK-Grenzwerts empirischer, insbesondere medizinisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnisse (BGH NJW 1990, 2393, 2394). Diese sind als für den Richter verbindlich hinzunehmen, wenn sie in den maßgebenden Fachkreisen allgemein und zweifelsfrei als richtig und zuverlässig anerkannt sind (BGH NJW 54, 83; BGH NJW 1967, 116, 117). Die Bindung der Strafgerichte an diese Erfahrungssätze ist auch mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung gemäß § 261 StPO vereinbar, (verfassungs-)rechtlich gar zwingend, denn „[e]s gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, denen eine unbedingte, jeden Gegenbeweis mit anderen Mitteln ausschließende Beweiskraft zukommt. Solche allgemein als gesichert geltenden Erkenntnisse muß der Tatrichter als richtig hinnehmen, selbst wenn er ihre Grundlagen im einzelnen nicht selbst erschöpfend nachprüfen kann. Wo eine Tatsache aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnis feststeht, ist für eine abweichende richterliche Feststellung und Überzeugungsbildung kein Raum mehr.“ (BVerfG NJW 1995, 125, 126).
(a) Nachdem absolute Fahruntüchtigkeit für Fahrer von Kraftwagen zunächst bei einer BAK von 1,5‰ anerkannt wurde (BGH NJW 1954, 159), wurde der Wert in der Folge sukzessive abgesenkt. Für Krafträder wurde zunächst ein geringerer Wert als für Kraftwagen, namentlich 1,3‰, festgesetzt (BGH NJW 1959, 1046). Dieser Wert wurde sodann im Jahr 1966 nach dem Erscheinen eines Gutachtens des damaligen Bundesgesundheitsamts (Lundt/Jahn, Gutachten des Bundesgesundheitsamtes zur Frage Alkohol bei Verkehrsstraftaten, 1966) auch für Kraftwagen – aufgrund fortgeschrittener naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und zunehmender Messgenauigkeit – auf 1,3‰ (BGH NJW 1967, 116) festgesetzt (1,1 Grundwert, 0,2 Sicherheitszuschlag). Die Festlegung eines Grenzwerts für absolute Fahruntüchtigkeit wurde für sog. Mofas (Fahrräder mit Hilfsmotor) höchstrichterlich im Jahr 1974 zunächst mit der Begründung abgelehnt, dass sich „in der Fachliteratur […] keine wissenschaftlichen Ergebnisse oder entsprechend anwendbare Erfahrungen finden [lassen], aus denen sich ein gültiger Beweisgrenzwert der Blutalkoholkonzentration […] ableiten ließe“ (BGH NJW 1974, 2056, 2057). Dabei wurde angenommen, dass sich diesbezüglich die „Gleichbehandlung sämtlicher Fahrer von einspurigen Kfz“ verbiete. Aufgrund einer „großangelegten Untersuchung“ (unter Bezugnahme auf Schewe, Schuster et al., Blutalkohol 1980, 298 ff.) erkannte der Bundesgerichtshof im Jahr 1981 schließlich auch einen absoluten Grenzwert für Mofas an, der auch bei 1,3‰ lag (BGH NJW 1982, 588). Der BAK-Grenzwert lag somit für Kraftwagen, Krafträder und Mofas einheitlich bei 1,3‰. Im Wege vergleichender Betrachtung übertrug der Bundesgerichtshof den Grenzwert auch auf das Führen eines betriebsunfähigen Kraftwagens, der (mittels eines Abschleppseiles) abgeschleppt wurde (BGH, Beschluss vom 18. Januar 1990 – 4 StR 292/89, juris). In Ermangelung hinreichend aussagekräftiger wissenschaftlicher Studien wurde ein Grenzwert für Radfahrer indes erst im Jahr 1986 anerkannt – zunächst 1,7‰ (BGH NJW 1986, 2650), wegen Verbesserungen der Messgenauigkeit liegt er mittlerweile herrschend bei 1,6‰ (Fischer, ders., StGB, 72. Aufl. 2025, § 316, Rn. 27).
Auf der Grundlage eines Revisionsverfahrens, dem das Führen eines Personenkraftwagens mit 1,24‰ BAK zugrunde lag, legte das Oberlandesgericht Braunschweig dem Bundesgerichtshof (gemäß § 120 Abs. 2 GVG) die Frage „Ist der Führer eines Kraftfahrzeuges bereits von einem Blutalkoholgehalt von 1,1 Promille an absolut fahruntüchtig?“ vor, was dieser „für alle Führer von Kraftfahrzeugen“ bejahte (BGH NJW 1990, 2393), sodass der Grenzwert für Kraftwagen, Krafträder und Mofas einheitlich von 1,3‰ auf 1,1‰ herabgesetzt wurde; der vorige Grundwert von 1,1‰ wurde auf 1,0‰, der Sicherheitszuschlag von 0,2‰ auf 0,1‰ herabgesetzt. Dies begründete der Bundesgerichtshof hinsichtlich des Grundwerts zum einen – erneut – mit dem Gutachten des Bundesgesundheitsamts aus dem Jahr 1966, wobei er die darin enthaltenen – einen höheren Grenzwert als 1,0‰ begründenden – Untersuchungen von Freudenberg relativierte und die darin enthaltenen Studien, die einen Grenzwert von 1,0‰ begründeten, durch eine Vielzahl von neu erschienenen Studienergebnissen – medizinischen und statistischen, insbesondere aber Fahrversuchen, denen er besondere Bedeutung beimaß – als bestätigt ansah. Ergänzend verwies er auf gestiegene Anforderungen an Kraftfahrer aufgrund eines höheren Verkehrsaufkommens und gestiegener Durchschnittsgeschwindigkeiten. Die Senkung des Sicherheitszuschlags begründete er mit der verbesserten BAK-Messgenauigkeit (BGH NJW 1990, 2393, 2394).
(b) In seiner neueren Rechtsprechung scheint der Bundesgerichtshof seine hergebrachten naturwissenschaftlichen Anforderungen für die Festlegung eines BAK-Grenzwerts für eine absolute Fahruntüchtigkeit gelockert zu haben.
Seine Grundsatzentscheidung, mit der er „für alle Kraftfahrzeuge“ einen BAK-Wert von 1,1‰ bestimmt hatte (BGH NJW 1990, 2393), scheint er nicht nur auf die im Entscheidungszeitpunkt existenten und seinerzeit wissenschaftlich untersuchten Kraftfahrzeuge – Kraftwagen, Kraftrad und Mofa – zu beziehen, sondern versteht die damalige Entscheidung auch in die Zukunft reichend, sodass der Grenzwert grundsätzlich auch für neu entwickelte – aktuelle – Fahrzeugkategorien Geltung beanspruchen soll, soweit sie (straßenverkehrsrechtlich) als Kraftfahrzeuge qualifiziert werden (BGH NStZ 2021, 608). Dementsprechend hat er in seinem Beschluss vom 13.04.2023 – 4 StR 439/22 (BGH NZV 2023, 41) absolute Fahruntüchtigkeit bei der Fahrt mit einem E-Scooter mit einer baubedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h (also oberhalb des Grenzwerts der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h für Elektrokleinstfahrzeuge nach § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr [eKFV]) – ebenfalls bei einem BAK-Wert von 1,1‰ angesetzt. Dies hat er insofern konsequent allein mit Verweis auf die Grundsatzentscheidung in BGH NJW 1990, 2393, also der Qualifikation des E-Scooters als Kraftfahrzeug, begründet – ohne eine empirische oder vergleichende Betrachtung, etwa im Hinblick auf Fahrdynamik, Unfall- und Verletzungsgefahren, vorzunehmen.
(c) Dabei hat der Bundesgerichtshof die Übertragung des Grenzwerts von 1,1‰ jedoch ausdrücklich auf E-Scooter bzw. Kraftfahrzeuge beschränkt, bei denen es sich nicht um Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne des (§ 1 Abs. 1) eKFV handelt (so zuvor bereits BGH NStZ 2021, 608). Bezüglich Elektrokleinstfahrzeugen im Sinne der eKFV hat er die Übertragung des 1,1‰-Grenzwerts ausdrücklich offenstehen lassen („Ob an dieser pauschalen Betrachtung auch mit Blick auf die neu aufgekommene Fahrzeugklasse der Elektrokleinstfahrzeuge festgehalten werden kann, hat der Senat bisher offengelassen“ und „bedarf auch hier keiner Entscheidung“, BGH NZV 2023, 418, 419).
(d) Die bisherige obergerichtliche Rechtsprechung überträgt den Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1‰ weitgehend auch auf E-Scooter, die dem eFKV unterfallen, vgl. KG, Beschluss vom 31.05.2022 – (3) 121 Ss 40/22 (13/22) = BeckRS 2022, 14318; BayObLG, Beschluss vom 24.07.2020 – 205 StRR 216/20 = BeckRS 2020, 21388; OLG Hamm, Urteil vom 08.01.2025 – 1 ORs 70/24 = BeckRS 2025, 1706); OLG Hamburg, Urteil vom 16.03.2022 – 9 Rev 2/22, BeckRS 2022, 10351 (ohne diesbezügliche Begründung); offen gelassen indes von OLG Braunschweig, Urteil vom 30.11.2023 – 1 ORs 33/23 = BeckRS 2023, 36371. Das BayObLG geht davon aus, dass der Grenzwert von 1,1‰ nach dem Bundesgerichtshof für sämtliche Kraftfahrzeuge gelten müsse. Es sieht – im Rahmen rein normativer Betrachtung – keinen Anlass, von diesem Wert abzuweichen, da es sich bei Elektrokleinstfahrzeugen um Kraftfahrzeuge handele und der Gesetzgeber keine abweichenden Regelungen geschaffen habe. Das KG – und dem folgend bzw. in der Begründung im Wesentlichen deckungsgleich das OLG Hamm – weicht von der Begründung des BayObLG ab, indem es „[d]ie bloße rechtliche Einordnung eines E-Scooters als Kraftfahrzeug“ explizit nicht als ausreichend ansieht. Den Grenzwert von 1,1‰ nimmt es gleichwohl als Ausgangspunkt und prüft, ob es einer Heraufsetzung bedürfe, lehnt dies jedoch im Ergebnis ab. Dies begründet es damit, dass dies nicht aus der eFKV abgeleitet werden könne, die bautechnische Beschaffenheit zudem eher erhöhte Anforderungen an den Fahrbetrieb nahelege – wie in Bezug auf einzelne Gesichtspunkte näher begründet wird (kleine Räder, dadurch geringe stabilisierende Kreiselkräfte; stehende Haltung mit relativ hohem Schwerpunkt des Fahrzeugs und dadurch Fahrinstabilität sowie, damit verbunden, höheres Aufmerksamkeitsbedürfnis; erzielbare Geschwindigkeit von 20 km/h ohne eigenes Zutun) – und auch statistische Auswertungen als auch die Studie der Universität Düsseldorf aus dem Jahr 2020 (mit Verweis auf die Publikation „E-Scooter driving under acute influence of alcohol – a real-driving fitness study“, International Journal of Legal Medicine vom 26. Februar 2022) ein Abweichen nicht begründen könnten.
(2) Auch wenn Vieles darauf hindeutet, dass auch Fahrer von E-Scootern, die der eKFV unterfallen, ihr Fahrzeug maximal bei einer BAK von 1,1‰ BAK – Tendenz niedriger – sicher führen können, erscheint es fraglich, ob ein Grenzwert für eine absolute Fahruntüchtigkeit derzeit bestimmt werden kann.
(a) Gegen ein rein normativ begründete Übertragung des 1,1‰-Grenzwerts auf alle Fahrzeuge, die die (straßenverkehrsrechtliche) Definition eines Kraftfahrzeugs erfüllen, bestehen erhebliche Bedenken.
(aa) Dabei erscheint es zunächst äußerst zweifelhaft, dass die Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1990 dahingehend verstanden werden kann (ablehnend auch OLG Karlsruhe BeckRS 2020, 16074; Valerius, Gesamtdokumentation 61. Verkehrsgerichtstag 2023, S. 171, 173). Die entsprechenden Formulierungen ließen sich zwar bei isolierter Betrachtung dahingehend interpretieren. Gegen ein solches Verständnis spricht jedoch, dass zum Entscheidungszeitpunkt lediglich die damaligen Fahrzeugtypen – und nicht die weitere Entwicklung – Diskussionsgegenstand waren die etwaige Gestalt weiterer Fahrzeugtypen nicht absehbar war. Auch wäre es ungewöhnlich, wenn sich der Bundesgerichtshof über den konkreten Entscheidungsgegenstand hinaus in derart bestimmter Weise hätte binden wollen, zumal ohne hinreichende Klarstellung und Begründung hinsichtlich der beabsichtigten – zukunftsgerichteten – Dimension. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Bundesgerichtshof sich in den Entscheidungsgründen umfassend auf damalige empirische Untersuchungen bezogen und zudem die Bedeutung und Aussagekraft von Fahrversuchen hervorgehoben hat (BGH NJW 1990, 2393, 2394), die denklogisch auf die damaligen Fahrzeugtypen begrenzt waren und eine Antizipation des BAK-Grenzwerts für unbekannte zukünftige Kraftfahrzeugtypen und entsprechende Leistungsanforderungen an einen Fahrer (etwa bei selbstfahrenden Kraftfahrzeugen) nicht zulässt. Auch ging der Bundesgerichtshof zuvor ausdrücklich davon aus, dass das jeweilige Verkehrsmittel bei der Beurteilung der Fahruntüchtigkeit berücksichtigt werden muss (BGH NJW 1959, 1046, 1047).
(bb) Eine Abkehr vom naturwissenschaftlichen – hin zu einem normativierten – Ansatz kann der Entscheidung aus dem Jahr 1990 zudem nicht entnommen werden und wäre auch verfassungsrechtlich bedenklich, da das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf den BAK-Grenzwert eine naturwissenschaftliche Bindungswirkung angenommen hat, wenn dies „aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnis feststeht“, wodurch „für eine abweichende richterliche Feststellung und Überzeugungsbildung kein Raum mehr“ sei (BVerfG NJW 1995, 125, 126). Dem vorgelagert erfordert dies bei der Aufstellung eines naturwissenschaftsakzessorischen Erfahrungssatzes, wie bei der BAK-Bestimmung bei der absoluten Fahruntüchtigkeit, diesen auf der Grundlage hinreichenden naturwissenschaftlichen Sachverstands festzusetzen.
Auch ist es gleichheitsrechtlich bedenklich, für Kraftwagen, Motorrad, Mofa und Fahrrad einen schwerpunktmäßig naturwissenschaftlich hergeleiteten BAK-Grenzwert (von 1,1‰ bzw. 1,6‰) festzulegen, sich für neu aufgekommene Fahrzeugkategorien dann jedoch von diesem strengen Maßstab zu lösen.
(cc) Dadurch, dass der Bundesgerichtshof es ausdrücklich offenstehen lassen hat, ob eine „pauschale Betrachtung“ bei Elektrokleinstfahrzeugen festgehalten werden kann (BGH NZV 2023, 418, 419), liegt es im Übrigen nahe, dass er den Grenzwert von 1,1‰ zukünftig nicht schlicht übertragen wird, vielmehr dürfte er Elektrokleinstfahrzeuge als (zumindest eine) eigene Kategorie ansehen, die eine eigene naturwissenschaftliche Grenzwertbestimmung für die Fahrsicherheit erfordern.
(b) Hält man demzufolge die empirische Begründung der absoluten Fahruntüchtigkeit für erforderlich, ist es zweifelhaft, ob auf der Grundlage des derzeitigen Standes der Wissenschaft für E-Scooter nach der eKFV – wie hier, vgl. (aa) – ein entsprechender Grenzwert mit dem erforderlichen Grad an Sicherheit bestimmt werden kann – dazu (bb) –, oder zumindest ein (Mindest-)Grenzwert im Wege einer Vergleichsanalyse ermittelt werden kann – dazu (cc).
(aa) Es handelt sich bei dem tatgegenständlichen E-Scooter zunächst um ein Elektrokleinstfahrzeug im Sinne der eFKV.
Nach § 1 Abs. 2 eFKV darf ein Elektrokleinstfahrzeug insbesondere maximal eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erreichen und eine Fahrzeugmasse von 55 kg nicht überschreiten und muss bestimmte Maße (der Lenk- bzw. Haltestange, Gesamtbreite, -länge und höhe) einhalten.
Davon kann vorliegend ausgegangen werden, auch wenn lediglich der Hersteller (O. GmbH) aktenkundig ist, nähere Angaben zur Fabrikation hingegen fehlen. Dies folgt daraus, dass es sich um ein Fahrzeug aus der Flotte des Sharing-Anbieter T. (bzw. D., als dessen Rechtsnachfolger) als deutschlandweit größtem Sharing-Anbieter für E-Scooter handelt und dieser ausschließlich E-Scooter ohne Fahrerlaubnispflicht unterhält, die – damit zwangsläufig – der eFKV entsprechen müssen. Da das Unternehmen seine Fahrzeuge zudem ausschließlich aus einheitlicher Serienfertigung bezieht, die speziell für den deutschen Markt unter Einhaltung der technischen Anforderungen gefertigt werden, kann es ausgeschlossen werden, dass einzelne Fahrzeuge die fabrikationsbedingten Anforderungen der Verordnung nicht erfüllen; dies gilt jedenfalls soweit – wie hier – keine presseöffentlichen Anhaltspunkte für (systemische) Verstöße bekannt sind.
(bb) Es erscheint jedoch zweifelhaft, ob der derzeitige Stand der Wissenschaft die Bestimmung eines BAK-Grenzwerts für die absolute Fahruntüchtigkeit entsprechender Fahrzeuge erlaubt.
Da der Rechtsbegriff der absoluten Fahruntüchtigkeit primär als naturwissenschaftlich determiniert anzusehen ist und einen dergestalt verdichteten wissenschaftlichen Erkenntnisstand erfordert, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Schluss zulässt, dass ein jeder Fahrer – unbesehen individueller Konstitution und Umständen – bei der betreffenden BAK zum sicheren Führen des betreffenden Fahrzeugtyps nicht mehr in der Lage ist, kommt empirischen Forschungsergebnissen eine zentrale Bedeutung zu (näher dazu bereits II. 1. b)).
(aaa) Dabei haben Realfahrversuche des betreffenden Fahrzeugtyps – hier von E-Scootern – besondere Aussagekraft (BGH NJW 1990, 2393, 2394). Dies folgt daraus, dass das Zusammenspiel der alkoholbedingten Auswirkungen bei diesen umfassend in die Ergebnisse einfließt (anders als bei der Untersuchung von Einzelmerkmalen, wie etwa der Reaktionsfähigkeit oder Sehleistung). Es wird zudem aufgrund von kontrollierten Bedingungen die Messbarkeit und Vergleichbarkeit des Verkehrssettings sowie der Fahrfehler sichergestellt. Auch ist der Abgleich der Fahrleistung zum nüchternen Zustand möglich (anders als etwa bei Unfallstatistiken). Außerdem kommt es zu keinen Verzerrungen aufgrund des Dunkelfeldes oder unbekannten Unfallparametern. Im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung sind jedoch weiterhin auch (unfall-)statistische und naturwissenschaftliche, insbesondere medizinische, Erkenntnisse zur Auswirkung von Alkohol berücksichtigungsbedürftig (BGH NJW 1990, 2393, 2394) sowie Forschung zu entsprechenden Fahrleistungen bei anderen Fahrzeugtypen, allerdings regelmäßig mit geringerem Gewicht.
Der ersten und – soweit ersichtlich – bisher einzigen Realfahrversuchsstudie des Universitätsklinikums Düsseldorf (Institut für Rechtsmedizin) in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Mathematisches Institut) und der Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Rechtsmedizin) unter Einbindung juristischen Sachverstands (RiBGH a.D. Rüdiger Maatz) kommt insofern zentrale Bedeutung zu. Bei dieser Untersuchung durchfuhren 57 E-Scooter mehrfach bei steigender BAK einen Parcours, der verschiedene Verkehrssituationen durch Hindernisse simulierte, wodurch die Abnahme der individuellen Leistungsfähigkeit bei unterschiedlicher BAK anhand der Veränderung der Fehlerquoten gemessen werden konnte. Dabei zeigte sich bei 0,21-0,4‰ eine Abnahme der Fahrleistung um etwa 40%, bei 0,81-1,00‰ um etwa 62% und 1,01-1,2‰ um etwa 72% (Zube/Daldrup/Maatz/Lau/Hartung, Blutalkohol 2022, 175, 179; dazu auch Zube/Daldrup/Lau/Maatz/Tank et al., International Journal of Legal Medicine, 136(5): 2021, 1281 [https://link.springer.com/article/10.1007/s00414-022-02792-3] Zube, Auswirkung von Alkoholeinfluss auf die Fahrsicherheit von E-Scooter-Fahrenden [Dissertation 2024; https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-72434/Zube,%20 Katharina%20-%20finale%20Fassung%20.pdf] s. auch LG Hechingen BeckRS 2023, 54310; KG BeckRS 2022, 14318). Trotz der Singularität dieser Studie in Bezug auf E-Scooter, gilt es im Hinblick auf die Aussagekraft zu berücksichtigen, dass es sich um eine elaborierte Untersuchung eines interdisziplinären Forschungsteams gehandelt hat, das auf einem etablierten Forschungsdesign zum Einfluss von Alkohol und Rauschmitteln auf die Fahrleistung aufgebaut hat (Blutalkohol 2022, 175, 176) und aus dem mittlerweile eine Mehrzahl an – auch englischsprachigen – Publikationen hervorgegangen ist (s.o.), gegen die – soweit ersichtlich – bislang keine Mängel hinsichtlich Methodik und/oder Aussagekraft vorgebracht worden sind. Die Steigerung der Fehlerquoten entspricht zudem etwa vergleichbaren Realfahrversuchen mit Mofas, für die nach ständiger Rechtsprechung auch die 1,1‰-Grenze gilt. Die Fehlerquoten haben sich bei diesen bei einer BAK von 0,8‰ um etwa 70% (E-Scooter: 0,81-1,0‰ um etwa 62%) und insbesondere bei einer BAK von 1,3‰ um etwa 87% (E-Scooter: 1,01-1,2‰ um etwa 72%) gegenüber der Leistung im nüchternen Zustand gesteigert (Schewe/Schuster/Englert et al., Blutalkohol 1980, 298). Dass sich im BAK-Bereich von 1,01-1,2‰ die Fehlerquote aller Probanden bei allen Hindernissen verschlechtert hat, spricht zudem dafür, dass allgemein – also grundsätzlich einen jeden Fahrer – von einer Abnahme der Fahrleistungen ausgegangen werden kann (Zube/Daldrup/Maatz/Lau/Hartung, Blutalkohol 2022, 175, 179). Auch ist bei E-Scootern bauartbedingt von erhöhten Anforderungen an Gleichgewicht und Koordination auszugehen (Brandt, Blutalkohol 2022, 216, 221; Zube/Daldrup/Maatz/Lau/Hartung, Blutalkohol 2022, 175 f.), sodass sich die alkoholbedingten Beeinträchtigungen dieser Fähigkeiten aufgrund der erhöhten Leistungsanforderungen besonders stark auswirken dürften.
Bedenken bestehen jedoch im Hinblick darauf, dass es sich bisher gleichwohl nur um einen singulären Realfahrversuch handelt und dieser lediglich relative Leistungseinbußen zum Gegenstand hat. Anders als – der Grenzwertbestimmung des Bundesgerichtshofs zugrundeliegender – Forschung zu Kraftwagen, Kraftrad und Fahrrad fehlt es bisher an näheren Auseinandersetzungen und ergänzender naturwissenschaftlich-normativer Bewertung, ab welcher BAK ein jeder Fahrer – mithin absolut – einen E-Scooter nicht mehr sicher zu führen imstande ist. Auch fehlt es an Vergleichsstudien von E-Scootern zu anderen Fahrzeugen (so etwa Schewe/Schuster/Englert, Blutalkohol 1980, 298 im Verhältnis vom Fahrrad zum Mofa). Darüber hinaus bewerten Mitglieder des Forschungsteams die Aussagekraft der Ergebnisse selbst als begrenzt bzw. nehmen an, dass allein auf Grundlage der Studienergebnisse ein Grenzwert nicht bestimmt werden kann (so Zube, Auswirkung von Alkoholeinfluss auf die Fahrsicherheit von E-Scooter-Fahrenden, 2024, S. 43, 53: „[…] festzuhalten, dass sich durch die Ergebnisse dieser Arbeit allein kein Grenzwert festlegen lässt, sondern dass diese Arbeit lediglich als Entscheidungshilfe dienen kann. Eine Grenzwertfindung muss der Rechtsprechung beziehungsweise der Gesetzgebung vorbehalten bleiben.“; „Erst in Zusammenschau mit den epidemiologischen Daten lässt sich näherungsweise eine Promillegrenze bestimmen.“). Auch bestehen Zweifel, ob die Erkenntnisse als hinreichend gesichert angesehen werden können, da „Faktoren wie beispielsweise eine Alkoholgewöhnung, Fahrerfahrung/Fahrpraxis und ein daraus resultierendes höheres Kompensationsvermögen […] nicht ausgeschlossen werden [können] […]“ (Zube, aaO, S. 44).
Gerade hinsichtlich des Aspekts der Alkoholgewöhnung wecken neue Forschungsergebnisse – auf der Grundlage von Daten überwiegend aus dem ländlichen Raum – Zweifel an der hinreichenden Absicherung des BAK-Werts von 1,1‰. Im Rahmen einer Studie wurden die an das Institut für Rechtsmedizin Greifswald gerichteten gesamten Aufträge der Strafverfolgungsbehörden in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund des Verdachts von Trunkenheit im Straßenverkehr mit E-Scootern ausgewertet. Von 252 Personen wurde bei 80,5% eine BAK von mindestens 1,1‰, bei 35,7% gar von mindestens 1,6‰ festgestellt, zugleich wurde bei 121 Personen (47,2%) die Bewegung/Koordination als „unauffällig“ dokumentiert und in 90 Fällen (35,71%) wurde die Fahrweise – wohl von Polizeibeamten – als „sicher“ und lediglich in 32 Fällen (12,70%) als „unsicher“ bewertet (Wudtke/Dokter/Talarico et al., Blutalkohol 2025, 199). Auch wenn eine „unauffällige“ Bewegung/Koordination und eine als „sicher“ qualifizierte Fahrweise sowie die geringe Unfallquote absolute Fahrunsicherheit nicht zwingend ausschließen – da diese es erfordert, auch schwierige Verkehrslagen bewältigen zu können, zu denen es nicht bei einer jeden Fahrt kommen muss – und die Bewertungen im Übrigen subjektiver Natur sind und regelmäßig auf der Basis einer kurzen Wahrnehmung/Untersuchung erfolgt sein dürften, begründet die Gesamtschau des Zahlenverhältnisses mit Blick auf die enormen Alkoholisierungsquoten (von 80,5% mit mindestens 1,1‰ und 35,7% mit mindestens 1,6‰) prima facie gleichwohl erhebliche Zweifel daran, dass mit einer an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei 1,1‰ niemand sicher einen E-Scooter führen kann.
(bbb) Zwar ist im Allgemeinen zudem auch die Übertragung eines anerkannten BAK-Grenzwerts der absoluten Fahruntüchtigkeit eines anderen Fahrzeugtyps möglich (vgl. OLG Braunschweig, Urteil vom 30. November 2023 – 1 ORs 33/23, Rn. 14, juris; hinsichtlich des Führers eines betriebsunfähigen abgeschleppten Fahrzeugs: BGH, Beschluss vom 18. Januar 1990 – 4 StR 292/89, Rn. 20, juris). Die Vergleichsbetrachtung erfordert jedoch den gleichen Grad an Gewissheit wie das Aufstellen von Erfahrungssätzen, also einen Vergleichs- oder Erst-Recht-Schluss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Andernfalls würden die hohen Anforderungen an Ausnahmen von der freien richterlichen Beweiswürdigung (§ 261 StPO) unterlaufen. Grobe oder auf Schätzungen beruhende Analogie-Begründungen verbieten sich insofern (Pegel, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 316 Rn. 49), insbesondere wenn die Vergleichsparameter selektiv oder einseitig gewählt sind. Vielmehr müssen die Anforderungen an das sichere Führen des neuen Fahrzeugtyps – hier: des E-Scooters – im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der relevanten Parameter mit der erforderlichen Gewissheit dem eines Vergleichsfahrzeugs entsprechen oder diese übersteigen (siehe auch Pegel, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 316 Rn. 34).
Vorliegend begründen bereits die vorstehenden Forschungsergebnisse von Wudtke/Dokter/Talarico et al., Blutalkohol 2025, 199 gleichermaßen Zweifel an einem Vergleich mit anderen Kraftfahrzeugen.
Im Übrigen dürfte auch ein Vergleich von E-Scootern mit einem Personenkraftwagen, Kraftrad oder Mofa (Grenzwert 1,1‰), aber auch mit Fahrrädern und Pedelecs (Grenzwert 1,6‰) ausscheiden. Denn die Leistungsanforderungen unterscheiden sich wesentlich (im Sinne eines „aliud“), wobei diese zudem nicht ausschließlich und offensichtlich als höher als bei den Fahrzeugen mit einem Grenzwert von 1,1‰ anzusehen sind. Sowohl ein Vergleich als auch ein Erst-Recht-Schluss scheiden damit aus. Dies beruht darauf, dass sich E-Scooter insbesondere im Hinblick auf Bauweise, Lenkverhalten, Fahrdynamik, (Höchst-)Geschwindigkeit wesentlich von Personenkraftwagen, Motorrad, Mofa und auch Fahrrädern unterscheiden (so tendenziell auch Zube/Daldrup/Maatz/Lau/Hartung, Blutalkohol 2022, 175 [„neue wissenschaftliche Untersuchungen in Bezug auf den BAK-Beweisgrenzwert der absoluten Fahrunsicherheit in Höhe von 1,10 ‰ notwendig, da die Anforderungen zum Führen eines E-Scooters nur sehr bedingt mit dem Führen eines Pkw vergleichbar sind.“]; Zube, Auswirkung von Alkoholeinfluss auf die Fahrsicherheit von E-Scooter-Fahrenden, 2024, S. 16). Gegenüber den genannten Kraftfahrzeugen unterscheidet sich etwa die Lenkung durch die regelmäßig gerade Lenkstange deutlich, durch den aufrechten Stand zudem das Fahrverhalten und die Kurvendynamik, die Steuerung ist typischerweise weniger komplex (im Wesentlichen Gas, Bremse, Klingel), die (Höchstgeschwindigkeit – auch bergab – ist auf 20 km/h gedrosselt, die (Rundum-)Sicht besser als bei geschlossener Fahrweise oder Helmtragung (die bei E-Scootern nicht zwingend, zudem unüblich ist), die Pflicht grundsätzlich Radwege zu verwenden (§ 10 Abs. 1 eKFV) führt ferner dazu, dass seltener eine schnelle Reaktionsfähigkeit gefordert ist. Auch kann in Notsituationen ohne Weiteres vom E-Scooter herabgesprungen werden, anders als bei den anderen Fahrzeugtypen. Ein wissenschaftlich hinreichend gesicherter Vergleich erscheint angesichts der offenkundigen Unterschiede daher nicht möglich.
(3) Vor diesem Hintergrund erscheint es äußerst zweifelhaft, ob der Beschuldigte als fahruntüchtig angesehen werden kann, da nicht klar ist, ob und wenn ja, in welcher Höhe derzeit ein Grenzwert für absolute Fahruntüchtigkeit bei E-Scootern (nach eFKV) festgesetzt werden kann.
2. Ob der Beschuldigte einer Trunkenheit im Straßenverkehr dringend verdächtig ist, kann aber letztlich dahinstehen, da die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 StGB jedenfalls nicht vorliegen, sodass sich der Entzug der Fahrerlaubnis nach dieser Vorschrift verbietet.
a) Nach § 69 Abs. 1 StGB entzieht das Gericht die Fahrerlaubnis insbesondere im Falle der Verurteilung wegen einer Tat, die im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs begangen wurde, wenn sich aus der Tat ergibt, dass der Täter zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist. Nach Abs. 2 der Vorschrift ist er in der Regel als ungeeignet in diesem Sinne anzusehen, wenn er eine der enumerativ aufgezählten Straftatbestände – u.a. die Trunkenheit im Verkehr – begangen hat.
aa) Bei der Entziehung der Fahrerlaubnis im Sinne des § 69 StGB handelt es sich ausweislich § 61 Nr. 5 StGB um eine Maßregel der Besserung und Sicherung, wobei der Aspekt der Besserung – mangels resozialisierender oder therapeutischer Elemente – unbeachtlich ist. Rechtsfolge ist die Entziehung der Fahrerlaubnis; die Untersagung des Führens von nicht fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen ist aufgrund des klaren Wortlauts (anders als bei Fahrverbot gemäß § 44 StGB) hingegen nicht möglich. Die Maßnahme dient allein der Sicherheit des Straßenverkehrs vor gefährlichen Tätern (Sinn, in: SK-StGB, 9. Aufl. 2016, § 69 StGB, Rn. 2 m.w.N.) und hat ausschließlich spezialpräventiven Charakter (BGH, Beschl. v. 27.04.2005 – GSSt 2/04 –, BGHSt 50, 93; Radtke, in: LK-StGB, 13. Aufl., Vor §§ 61 ff., Rn. 27; Freund/Rostalski, in: MüKo-StGB, 5. Aufl. 2024, vor § 13 StGB, Rn. 99 f. m.w.N.), sodass generalpräventive Gesichtspunkte – wie etwa eine kollektive Abschreckung wegen der Zunahme bestimmter Straftaten – bei der Entscheidung über die Anordnung unbeachtlich sein müssen (OLG Düsseldorf NZV 1993, 117; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, 2. Aufl. 2020, § 69 StGB, Rn. 2; siehe auch BT-Drs. IV/651, S. 16). Auch dient § 69 StGB ausschließlich dazu, die Rechtsgüter anderer Verkehrsteilnehmer – namentlich Leben, Gesundheit und Eigentum –, nicht jedoch die des Täters selbst zu schützen (BGH, Beschl. v. 27.04.2005 – GSSt 2/04).
bb) Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Sicherung des Straßenverkehrs (StraßenVSichG) im Jahr 1952 oblag die Entziehung der Fahrerlaubnis allein Verwaltungsbehörden, die bei Verkehrsverstößen im Rahmen einer Gesamtschau und gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Sachverstand hierüber zu befinden hatten. Aufgrund der zunehmenden Belastung der Behörden durch das wachsende Verkehrsaufkommen – vor allem von Personenkraftwagen – und vor dem Hintergrund, dass die Strafgerichte bei der Verurteilung von Straftaten im Straßenverkehr ohnehin mit den betreffenden Sachverhalten befasst wurden, wurde § 42m StGB (a.F.) eingeführt, die Vorgängernorm des § 69 StGB. Danach wurde die Entscheidung über die Entziehung einer Fahrerlaubnis Strafgerichten in einem Teilbereich übertragen, namentlich dann, wenn die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen bereits durch die strafverfahrensgegenständliche Tat, die Anlasstat, begründet wurde; im Übrigen blieb – was nach wie vor der Fall ist – die Verwaltungs- bzw. Fahrerlaubnisbehörde zuständig, dessen Anwendungsbereich weitaus umfassender war und ist (Valerius, in: LK-StGB, 14. Aufl. 2024, § 69 StGB, Rn. 14).
Mit dem Zweiten Gesetz zur Sicherung des Straßenverkehrs (2. StraßenVSichG) wurde 1975 der Regelkatalog (seinerzeit § 42m Abs. 2 a.F., nunmehr in § 69 Abs. 2 StGB) eingeführt. Hierdurch sollten die Strafgerichte bei bestimmten Straftaten von der Gesamtwürdigung der Tatumstände und der Persönlichkeit, soweit diese sich im Tatgeschehen offenbart hat, befreit werden. Vielmehr wurde die Indizwirkung der abzuurteilenden Tat als so stark angesehen, dass die sonst gebotene umfassende Würdigung obsolet werden sollte. Der Katalog enthielt bereits damals die Strafbarkeit wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gemäß § 316 StGB. Diese war jedoch auf Kraftfahrzeuge begrenzt, das Führen von Fahrrädern wurde mithin nicht erfasst. Begründet wurde dies nur allgemein damit, dass die berauschte „Teilnahme am Kraftverkehr“ erfahrungsgemäß häufig zu Verkehrsunfällen führt, die „im Durchschnitt ungleich viel schwerer sind als die Schäden bei anderen Unfällen.“ (BT-Drs. IV/651, S.18).
cc) Die aktuelle Rechtsprechung zur Frage der Anwendung des § 69 Abs. 1 und 2 StGB auf E-Scooter ist uneinheitlich.
(1) Der Bundesgerichtshof hat bisher noch nicht entschieden, ob § 69 StGB auf E-Scooter (als Elektrokleinstfahrzeuge nach eFKV) Anwendung findet, und bejahendenfalls, ob die Verwendung von E-Scootern als Tatmittel bei der Frage der Widerlegung der Regelwirkung des § 69 Abs. 2 StGB zu berücksichtigen sind.
(2) Die bisher mit der Frage befassten Obergerichte – namentlich: BayObLG (BeckRS 2020, 21388) und OLG Hamm (BeckRS 2025, 1706) – halten § 69 StGB für anwendbar. Für den Begriff des Kraftfahrzeugs im Sinne der Vorschrift gelte die Definition des § 1 Abs. 2 Straßenverkehrsgesetz (StVG), nach der grundsätzlich alle mit Maschinenkraft angetriebenen Landfahrzeuge erfasst seien. Auch gebe es für E-Scooter keine Ausnahmeregelung, wie in § 1 Abs. 3 StVG, wonach bestimmte Pedelecs als Fahrräder eingestuft werden, deren Wertung auf § 69 StGB zu übertragen sei. Infolgedessen handele es sich um einen Regelfall nach § 69 Abs. 2 StGB, bei dem eine Widerlegung der Indizwirkung aufgrund der gesetzgeberischen Wertung nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen möglich sei; dass das Tatmittel ein E-Scooter sei dabei belanglos.
(3) Ein Teil der Land- und Amtsgerichte halten § 69 StGB auf E-Scooter für anwendbar und wollen deren Verwendung als Tatmittel bei der Frage der Widerlegung der Regelvermutung nach § 69 Abs. 2 StGB gleichfalls nicht berücksichtigen (LG Dortmund SVR 2020, 194 m. Anm. Krumm; LG Dresden BeckRS 2020, 7598; LG Flensburg BeckRS 2021, 35545; LG München I BeckRS 2020, 3467; LG Stuttgart BeckRS 2020, 48936; LG Stuttgart BeckRS 2021, 4320; LG Wuppertal BeckRS 2022, 1255; LG Mannheim BeckRS 2022, 43161). Ein Teil der Rechtsprechung stützt die Widerlegung der Indizwirkung des § 69 Abs. 2 StGB hingegen allein auf die Verwendung eines E-Scooters oder berücksichtigt dies jedenfalls mit erheblichem Gewicht (LG Leipzig BeckRS 2022, 22219; LG Chemnitz BeckRS 2022, 22233; LG Halle Blutalkohol 2020, 293; AG Heidelberg BeckRS 2021, 41621; LG Potsdam Beschl. v. 10. Juni – 2022 23 Qs 25/22; AG Köln BeckRS 2023, 43809; AG Frankfurt a. M. BeckRS 2022, 48207; zudem Zeyher HRRS 2022, 218, 222 f.; Valerius, Gesamtdokumentation 61. Verkehrsgerichtstag 2023, S. 171, 173). Begründet wird dies insbesondere damit, dass das Gefährdungspotential ungleich geringer als bei anderen Kraftfahrzeugen ist, etwa im Hinblick auf die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, und zudem vom Gesetzgeber und tatsächlich eher Fahrrädern und Pedelecs entspreche.
b) Richtigerweise ist § 69 StGB schon dem Grunde nach nicht anwendbar.
Die grammatische, systematische und historische Auslegung wecken bereits Zweifel, ob fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge vom Tatbestand des § 69 Abs. 1 S. 1 StGB erfasst sind – dazu aa). Jedenfalls aber mahnt die historische Auslegung des § 42m StGB a.F. (bzw. § 69 StGB) einen restriktiven Anwendungsbereich an; die teleologische Auslegung verdichtet dies zu dem Schluss, dass E-Scooter tatbestandlich nicht erfasst sind – dazu bb). Dem stehen insbesondere auch die Wertungen der eFKV oder des Straßenverkehrsrechts nicht entgegen; vielmehr haben diese keine Aussagekraft für die Frage der Anwendung von § 69 StGB auf E-Scooter – dazu cc).
aa) (1) In gesetzesgenetischer Hinsicht ging der Gesetzgeber ausweislich seiner Begründung davon aus, dass die Fahrerlaubnisentziehung ausschließlich Personen betrifft, die im Besitz einer solchen sind. So heißt es, dass „[…] der Entwurf [vorschlage], auch dem Strafrichter eine Zuständigkeit zur Entziehung der Fahrerlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen zu geben, wenn der Führer eines Kraftfahrzeugs durch ein mit Strafe bedrohtes Verhalten dargetan hat, daß ihm der Führerschein nicht belassen werden kann“ (BT-Drs. 1/2674, S. 12; Hervorhebung nur hier), wodurch sich zeigt, dass der Besitz eines Führerscheins (bzw. einer Fahrerlaubnis) vorausgesetzt wird.
Hätte der historische Gesetzgeber auch Anlasstaten mit solchen Fahrzeugen bedacht, die keiner Fahrerlaubnis bedürfen, hätte es sich aufgedrängt, sich damit zu befassen, dass die Rechtsfolge bei diesem Personenkreis leerläuft. Konsequenterweise hätte er ein Verbot, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge zu führen, als weitere Rechtsfolge implementieren müssen. In den Gesetzesmaterialien findet sich nichts hierzu, obwohl dies im Falle des Bedenkens derartiger Fälle nahegelegen hätte.
(2) Die Beschränkung auf fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge wird durch grammatische und systematische Gesichtspunkte gestützt. Die Voraussetzung der „Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen“ in § 69 Abs. 1 S. 1, letzter Hs. StGB kann nur dahin verstanden werden, dass hiermit fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge gemeint sind. Dies ergibt sich daraus, dass die Voraussetzung der Ungeeignetheit in unmittelbarem Zusammenhang mit der Rechtsfolge – der Fahrerlaubnisentziehung – steht, wobei die Entziehung einer Erlaubnis als Rechtsfolge naturgemäß nur Konsequenzen zeitigen kann, wenn ein Verhalten von einer Erlaubnis abhängt. Ein weiterreichendes dahingehendes Verständnis, dass die Fahrerlaubnisentziehung auch zu einer Untersagung des Führens von übrigen – von keiner Fahrerlaubnis abhängigen – Fahrzeugen erfasst, verbietet sich unumstritten vor dem Hintergrund des eindeutigen Wortlauts (vgl. Valerius, in: LK-StGB, 14. Aufl. 2024, § 69 StGB, Rn. 180, 184 m.w.N.). Die Fahrerlaubnisentziehung kann und soll daher nur vor Verkehrsgefährdungen mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen sichern.
Kommt man entsprechend der vorstehenden Erwägungen zu dem Ergebnis, dass die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen wegen dieses systematischen Zusammenhangs dahingehend erweitert verstanden werden muss, dass die Ungeeignetheit sich auf das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bezieht, dann liegt es aufgrund des engen Zusammenhangs nahe, dass die gleichlautenden Tatbestandsmerkmale des „Kraftfahrzeugs“ (als Tatmittel) in § 69 Abs. 1 S. 1, Hs. 1 und 2 StGB identisch zu verstehen sind. Eine gespaltene Auslegung im selben Satz wäre nicht nur ungewöhnlich, sondern im Hinblick auf das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot auch äußerst bedenklich.
bb) Doch auch wenn man Anlasstaten mit fahrerlaubnisfreien Kraftfahrzeugen ausreichen lässt, können E-Scooter nicht als von § 69 StGB erfasst angesehen werden.
(1) In zeitgeschichtlich-historischer Hinsicht ist zunächst zu berücksichtigen, dass bei Schaffung des § 42m StGB a.F. im Jahr 1952 praktisch nur Personen- und Lastkraftwagen sowie Kraft- und Fahrräder existierten. Das Entstehen neuer Fahrzeugkategorien war nicht absehbar. Der Gesetzgeber hatte insofern nur diese Fahrzeugkategorien im Blick.
(2) Das Gebot eines restriktiven Anwendungsbereichs des § 69 StGB ergibt sich ferner daraus, dass die Entziehung der Fahrerlaubnis – vor dem historischen Hintergrund – dem Strafrichter nur für klare Fälle übertragen werden sollte, also nur dann, wenn die Anlasstat die Ungeeignetheit zum Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge eindeutig offenbart. Im Übrigen sollte weiterhin die subsidiäre Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden gelten. Diese haben zur Verschaffung hinreichender Klarheit über die Ungeeignetheit einer Person insbesondere die Möglichkeit, die Einholung und Vorlage medizinisch-psychologischer Gutachten (MPU) vor ihrer Entscheidung zu verlangen.
(3) Das Gebot der restriktiven Auslegung der Voraussetzungen des § 69 StGB gilt im Übrigen auch vor dem Hintergrund, dass die nach § 62 StGB für Maßregeln der Besserung und Sicherung grundsätzlich vorgesehene Verhältnismäßigkeit im Einzelfall für die Entziehung einer Fahrerlaubnis nach § 69 S. 2 StGB ausgeschlossen ist (s. etwa Halecker/Scheffler in: Leipold/Tsambikakis/Zöller, AnwK-StGB, 3. Aufl. 2020, Rn. 48; näher zum Verständnis des § 69 S. 2 StGB: Valerius, in: LK-StGB, 14. Aufl. 2024, § 69 StGB, Rn. 178).
(4) Der Gesetzgeber war zudem dahingehend auf Restriktion bedacht, dass Verkehrsstraftaten mit Fahrrädern von der (auf Strafgerichte übertragenen) Fahrerlaubnisentziehung ausgenommen werden sollten. Dies schlug sich im Wortlaut darin nieder, dass nur „Kraftfahrzeuge“ und nicht „Fahrzeuge“ erfasst wurden. Hintergrund der Beschränkung war es augenscheinlich, dass der Entzug der Fahrerlaubnis bei einer Verkehrsstraftat mit einem Fahrrad angesichts des vergleichsweise geringeren Gefährdungspotenzials für andere Verkehrsteilnehmer dem Gesetzgeber als unverhältnismäßig erschien und er daher eine Erheblichkeitsschwelle einführen wollte. Da jedoch gleichwohl auch Radfahrer im Besitz von Fahrerlaubnissen sein und Kraftfahrzeuge führen können, die Maßregel also gleichwohl zumindest vor dem Führen von Kraftfahrzeugen schützen würde, muss aus der legislativen Anwendungsbeschränkung zugleich der Schluss gezogen werden, dass er keine Indizwirkung für einen solchen prospektiven Unrechtssprung – vom Fahrrad hin zum Kraftfahrzeug – gesehen hat, konkret also etwa ein Radfahren im Zustand der Fahruntüchtigkeit keinen, jedenfalls hinreichend klaren, Schluss auf ein künftiges – gefährlicheres – Fahren eines Personenkraftwagens in einem solchen Zustand zulasse, mithin keine Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen im Sinne des § 69 StGB geschlussfolgert werden kann.
(5) Dies gilt gleichermaßen für E-Scooter (nach der eFKV); auch hier kann – wie vom Gesetzgeber für Radfahrer angenommen – keine dahingehende Indizwirkung bzw. kein entsprechender Erfahrungssatz begründet werden. Vom fahruntüchtigen Führen eines fahrerlaubnisfreien E-Scooters kann nicht auf das fahruntüchtige Führen eines fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugs geschlossen werden. § 69 Abs. 1 S. 1 StGB ist vor diesem Hintergrund jedenfalls abzulehnen, weil sich die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht – jedenfalls allein – „aus der Tat [ergibt]“, wie nach dem Wortlaut verlangt. Die Verwendung eines E-Scooters ist mitunter eine Vermeidungsstrategie, um nicht betrunken mit einem Personenkraftwagen zu fahren (so etwa auch LG Dortmund BeckRS 2020, 3435; Zeyher, HRRS 2022, 218, 222. In Bezug auf Radfahrer: VG Potsdam, Beschluss vom 8. Juli 2005 – 10 L 279/05, Rn. 11, 13, juris; VG Potsdam, Urteil vom 14. August 2007 – 10 K 881/07, Rn. 25, juris; VG Augsburg, Beschluss vom 11. Dezember 2008 – Au 3 S 08.1564, Rn. 17, juris).
Das alkoholisierte Führen eines E-Scooters lässt also nicht den hinreichend sicheren Schluss zu, dass der Täter auch ein typisches Kraftfahrzeug, wie einen Personenkraftwagen, im fahruntüchtigen Zustand führen würde, da die Hemmschwelle dies zu tun höher sein kann. Dies beruht auch darauf, dass das Führen eines E-Scooters im Straßenverkehr weniger gefährlich ist. Die Gefährlichkeit entspricht im Wesentlichen der von Fahrrädern und Pedelecs im Sinne von § 1 Abs. 3 StVG. Letztere sind mit einzubeziehen, da sie aufgrund der straßenverkehrsrechtlichen Anwendungsherausnahme des § 1 Abs. 3 StVG nach der – soweit ersichtlich einhelligen – Rechtsprechung und Literatur nicht von § 69 StGB erfasst werden (vgl. zuletzt OLG Hamm BeckRS 2025, 1706; Valerius, in: LK-StGB, 14. Aufl. 2024, § 69 StGB, Rn. 47). Würde man E-Scooter hinsichtlich § 69 StGB nicht wie Fahrräder und Pedelecs behandeln, würde dies zu einem nicht begründ- und hinnehmbaren Wertungswiderspruch im Hinblick auf die Gefährlichkeitsbetrachtung führen (ähnl. LG Halle BeckRS 2020, 18948, Rn. 9).
(6) Eine vergleichbare Gefährlichkeit von E-Scootern zu Fahrrädern und Pedelecs, in Abgrenzung zu typischen Kraftfahrzeugen, legt auch der Verordnungsgeber der eFKV zugrunde – dazu (a). Die vergleichbare Gefährlichkeit ergibt sich insbesondere aus der tatsächlichen Betrachtung – dazu (b). Wie vorstehend skizziert schlägt dies zugleich auf die – subjektiv geprägte – Indizwirkung durch. Eine Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter lässt also nicht hinreichend sicher die Erwartung zu, dass eine solche mit einem typischen Kraftfahrzeug wiederholt würde – dazu (c).
Im Ausgangspunkt ist dabei zu berücksichtigen, dass bei der Fahrerlaubnisentziehung nach § 69 StGB der Schutz von dritten Verkehrsteilnehmern allein maßgeblich ist (dazu bereits oben unter II. 2. a) aa)).
(a) Die gesetzgeberische Ausgestaltung liegt im Hinblick auf die Verkehrssicherheit weitgehend auf einer Linie mit Fahrrädern und Pedelecs. Die vom Verordnungsgeber der eFKV perpetuierte Gefahrenbewertung hebt sich dementsprechend nahezu ausnahmslos positiv von anderen Kraftfahrzeugen ab – auch von Mofas, die das unterste Ende der Kategorie der Kraftfahrzeuge markieren. Dies geht sowohl aus dem Gesetzeswortlaut als auch den Gesetzgebungsmaterialien hervor.
(aa) Dies bringt der Verordnungsgeber explizit zum Ausdruck; er begründet es damit, dass „[d]ie Fahreigenschaften sowie die Verkehrswahrnehmung […] am stärksten denen des Fahrrads [ähneln]“ (BR-Drs. 158/19, S. 2, 24, 33; s. auch LG Potsdam, Beschl. v. 10.06.2022 – 23 Qs 25/22).
Ferner heißt es: „Das zugrunde liegende Konzept orientiert sich zu Gunsten der allgemeinen Verkehrssicherheit an den bestehenden verhaltensrechtlichen Regelungen für den Fuß- und Radverkehr, die für Elektrokleinstfahrzeuge unter bestimmten Voraussetzungen im Sinne dieser Verordnung entsprechend gelten sollen.“ (BR-Drs. 158/19, S. 23). Dieses legislative Konzept schlägt sich eindeutig in den einzelnen Regelungen nieder:
(bb) So ist für das Führen von Elektrokleinstfahrzeugen – wie Fahrrädern und Pedelecs – keine (theoretische und/oder praktische) Prüfung erforderlich, sei es durch Erwerb einer Fahrerlaubnis (wie für bestimmte Kleinkrafträder und Kraftfahrzeuge etc.) oder einer niedrigschwelligeren sog. Prüfbescheinigung (wie für Mofas vorausgesetzt, vgl. § 5 der Fahrerlaubnis-Verordnung [FeV]). Dies lässt sich wohl nur damit begründen, dass der Gesetzgeber dem Führen derartiger Fahrzeuge eine im Vergleich zu den typischen Kraftfahrzeugen geringere Gefährlichkeit beimisst.
(cc) Ebenfalls in Abgrenzung zu typischen Kraftfahrzeugen, insbesondere auch Mofas, können Elektrokleinstfahrzeuge innerorts, wo sie primär genutzt werden, auch auf Radwegen, Radfahrstreifen und gemeinsamen Geh- und Radwegen geführt werden (§ 10 Abs. 1 und Abs. 2 eKFV). Zunächst wurde gar erwogen, diese gar teilweise auf Gehwegen zuzulassen (LG Potsdam, Beschl. v. 10.06.2022 – 23 Qs 25/22). Die Ausgestaltung lässt sich aufgrund der damit verbundenen größeren Nähe zu Fußgängern – gerade bei gemeinsamen Geh- und Radwegen (i.S.v. Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO, Nr. 19, Zeichen 240) – nur dahin deuten, dass eine gegenüber Kraftfahrzeugen geringere, Fahrrädern im Wesentlichen vergleichbare Betriebsgefahr angenommen wurde (Schefer NZV, 2020, 239, 242).
(dd) Die Altersgrenze liegt bei 14 Jahren (§ 3 eFKV), wobei dies in der Gesetzesbegründung wie folgt begründet wird: „Diese Regelung orientiert sich an der Empfehlung des 50. Deutschen Verkehrsgerichtstages, dass Pedelecs für die Benutzung durch Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet sind.“ (BR-Drs. 158/19, S. 33).
(ee) Auch hat der Verordnungsgeber die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h so gewählt, dass nach der allgemeinen Vorschrift des § 21a Abs. 2 StVO keine Helmpflicht besteht (BR-Drs 158/19, S. 31). Im Übrigen erfolgte auch „[d]ie Beschränkung der Abmaße von Elektrokleinstfahrzeugen […] in Anlehnung an die Abmessungen von Fahrrädern und dem Segway“ (BR-Drs. 158/19, S. 31).
(ff) Das Ministerium für Verkehr plant ferner eine möglichst umfassende, mithin noch weitergehende, Angleichung der verhaltensrechtlichen Regelungen an die des Radverkehrs (Referentenentwurf – Verordnung zur Änderung der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften, Bearbeitungsstand 26. Juni 2025, https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-20/verordnung-aenderung-elektrokleinstfahrzeuge-verordnung-novelle.pdf?__blob=publicationFile).
(b) Vergleicht man E-Scooter mit Fahrrädern und Pedelecs auf der einen Seite, und Kraftfahrzeugen, wie Personenkraftwagen und Mofas, auf der anderen, lässt sich im Rahmen einer wertenden Gesamtschau keine größere Gefahr als bei Fahrrädern und Pedelecs feststellen. Zwar gibt es auch Aspekte bezüglich derer das Gefährdungspotential höher als bei Fahrrädern und Pedelecs ist (aa), hinsichtlich einer Mehrzahl von Gesichtspunkten ist dieses jedoch vergleichbar (bb) oder geringer als Fahrräder bzw. Pedelecs (cc).
(aa) Eine größere Gefährlichkeit gegenüber Fahrrädern und Pedelecs besteht insbesondere im Hinblick auf die bauartbedingten geringeren stabilisierenden Kreiselkräfte (sog. gyroskopischer Effekt) wegen der relativ kleinen Räder sowie des hohen Schwerpunkts aufgrund der stehenden Haltung (OLG Hamm BeckRS 2025, 1706, Rn. 20). Diese Aspekte reduzieren die Fahrstabilität und erhöhen die Sturzgefahr.
(bb) Eine Vergleichbarkeit mit Fahrrädern/Pedelecs ist insbesondere im Hinblick auf die geringe Komplexität der Bedienung gegeben, die sich im Kern auf die Betätigung von Gas und Bremse beschränkt. Gegenüber Fahrzeugen mit geschlossener Bauweise ist die (Rundum-)Sicht zudem besser (Schefer NZV 2020, 239, 242). Anders als bei Verbrennungsmotoren ist die Beschleunigung zudem direkt, linear und ruckelfrei.
(cc) Zu berücksichtigen ist, dass die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgängern, im Falle einer Kollision bauartbedingt deutlich geringer ist, insbesondere im Vergleich zu Pedelecs.
So haben Pedelecs in der Regel durchschnittlich ein – etwa um 5-10 kg – größeres (Kollisions-)Gewicht. Da kinetische Energie, die beim Aufprall wirkt, mit der Masse des Fahrzeugs unmittelbar zunimmt und dadurch die Kraft des Aufpralls deutlich verstärkt, steigt die Verletzungsgefahr für Fußgänger hierdurch überproportional.
Die Verletzungsgefahren für Fußgänger sind zudem im Hinblick darauf geringer, dass das wesentliche Gewicht des E–Scooter primär die Batterie – bodennah ist, sodass es kaum zu einem unmittelbaren Aufprall eines solchen schwergewichtigen Fahrzeugteils unmittelbar mit besonders empfindlichen Körperteilen kommen kann.
Als kollidierendes Fahrzeugteil eines E-Scooters kommt zudem vornehmlich die Vertikal- und Lenkstange in Betracht, die typischerweise lediglich ein Gewicht von bis zu 2 kg hat, zudem keine scharfen Kanten, wie mitunter bei Fahrrädern und Pedelecs.
Auch ist die Geschwindigkeit bei E-Scootern nach eFKV bei 20 km/h abgeriegelt, Fahrräder und Pedelecs können hingegen, gerade bei Gefälle, deutlich höhere Geschwindigkeiten erzielen, wodurch die Verletzungsgefahren ebenfalls überproportional steigen.
Gefahrsenkend ist zudem, dass Fahrer von E-Scootern – anders als bei Fahrrädern/Pedelecs – im Falle einer drohenden Kollision abspringen können, wodurch der E-Scooter aufgrund der geringeren stabilisierenden Kreiselkräfte und Gewichtsverteilung regelmäßig zur Seite wegklappt, was die Kollisionsgefahr mit dem Fahrgerät selbst – nicht indes mit dem Fahrer – reduziert.
Zu beachten ist insbesondere, dass – anders als bei anderen Fahrzeugen – ein enormer Anteil der statistisch erfassten Unfälle Alleinunfälle sind, also Unfälle ohne eine Beteiligung oder Verletzung Dritter, was die höheren Zahlen in den Unfallstatistiken im Hinblick auf die allein maßgebende Fremdgefährdung deutlich relativiert oder gar nivelliert; der Anteil an Alleinunfällen divergiert indes je nach Studie deutlich: 43% (Blutalkohol 2025, 62, 65 f.), 84,5% in Bezug alkoholisierte Männer (Wudtke/Dokter/Talarico et al., Blutalkohol 2025, 199), 75% bis 92% (Ringhand/Anke/Petzoldt/Gehlert, Forschungsbericht Nr. 75: Verkehrssicherheit von E-Scootern, 2021, S. 27 m.w.N.); der Anteil von Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern liegt laut Zube (Auswirkung von Alkoholeinfluss auf die Fahrsicherheit von E-Scooter-Fahrenden, Dissertation 2024, S. 15) unter Verweis auf zwei andere Studien bei 2% (E-Scooter) zu 18% (Fahrräder). Soweit ersichtlich existieren bisher keine Untersuchungen, die die Anzahl von E-Scooter-Unfällen und die Schwere der hieraus resultierenden Verletzungen allein hinsichtlich Drittschädigungen anderen Fahrzeugtypen gegenüberstellt (zum Aspekt der Alleinunfälle auch: LG Leipzig BeckRS 2022, 22219 Rn. 22; Timm, DAR 2020, 112, 112; Zeyher, HRRS 2022, 218, 222; Valerius, Gesamtdokumentation 61. Verkehrsgerichtstag 2023, S. 171, 179).
Nach Zahlen des statistischen Bundesamts für das Jahr 2023 sind die Todeszahlen bei Unfällen mit Fahrrädern (3,61 Tote pro 1000 Unfällen [absolut: 256 Tote bei 70.900 Unfällen]) und insbesondere Pedelecs (7,95 Tote pro 1000 Unfällen [absolut: 188 Tote bei 23.658 Unfällen]) zudem signifikant höher (https://www.n-tv.de/panorama/Opfer-von-Pedelec-Unfaellen-werden- immer-juenger-article24834910.html) als bei E-Scootern (2,33 Tote pro 1000 Unfällen [absolut: 22 Tote bei 9.425]) (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/unfaelle-e-scooter- deutschland-anstieg-100.html), wobei die bei E-Scooter vergleichsweise hohe Anzahl von Alleinunfällen mit alleiniger Schädigung des Fahrers mit enthalten sind.
Dass die Gefahren von E-Scootern diejenigen von Fahrrädern und insbesondere Pedelecs in tatsächlicher Hinsicht übersteigen – oder gar denen von typischen Kraftfahrzeugen entsprechen –, kann angesichts der vielen im Vergleich gefahrmindernden Gesichtspunkte nicht angenommen werden. Welches Gewicht den einzelnen gefahrerhöhenden und gefahrsenkenden Aspekten letztlich konkret zukommt, kann im Übrigen nur im Rahmen weiterer empirischer Untersuchungen mit entsprechenden Forschungsdesigns näher eruiert werden.
Es ist zu konstatieren, dass weder die Wertungen des Verordnungsgebers der eFKV noch die empirischen Erkenntnisse die Annahme erlauben, dass E-Scooter ihrer Natur nach eine höhere Gefahr für die Verkehrssicherheit – insbesondere Leib und Leben Dritter – als Fahrräder und Pedelecs darstellen. Eine Erstreckung von § 69 StGB auf diese im Wege der Auslegung verbietet sich daher.
(c) Die Vergleichbarkeit der tatsächlichen Gefahren und des Rechtsrahmens von E-Scootern mit Fahrrad/Pedelec führt zudem zu einer entsprechenden subjektiven Gefahreneinschätzung. Dies ist auch der Grund für die im Vergleich zu anderen Kraftfahrzeugen bisweilen gesenkte Hemmschwelle diese alkoholisiert zu führen. Das hat wiederum zur Folge, dass aus dem Führen von E-Scootern keine hinreichend sichere Indizwirkung für das Führen von anderen (fahrerlaubnispflichtigen) Kraftfahrzeugen gefolgert werden kann, sodass sich die Ungeeignetheit zu Führen dieser Fahrzeuge zudem nicht – wie der Gesetzeswortlaut verlangt – (allein) „aus der Tat ergibt“.
cc) Dem vorstehenden restriktiven Auslegungsergebnis stehen Wertungen der eFKV – dazu (1) – und der StVG – dazu (2) – nicht entgegen.
(1) Auch wenn Anknüpfungspunkt hierfür sein könnte, dass der Verordnungsgeber des eFKV in seiner Definition von Elektrokleinstfahrzeugen im Wortlaut des § 1 Abs. 1 eFKV zugrunde legt, dass es sich bei diesen um (spezielle) „Kraftfahrzeuge“ handelt, ist ein Schluss auf den Anwendungsbereich des § 69 StGB nicht möglich.
Dies beruht insbesondere darauf, dass der Verordnungsgeber – wie bereits im Einzelnen ausgeführt – annimmt, dass E-Scooter am stärksten Fahrrädern ähneln.
Zudem ist im Hinblick auf die Grenzziehung zu (übrigen) Kraftfahrzeugen im Ausgangspunkt zu beachten, dass die Kriterien zur Qualifikation als Elektrokleinstfahrzeug vom Unionsgesetzgeber herrühren, die darin wurzeln, dass er keinen Harmonisierungsbedarf gesehen hat, insbesondere keinen Bedarf für unionsweit vereinheitlichte Typengenehmigungen für Fahrzeuge unterhalb der Qualifikationsschwelle (s. etwa Huppertz, NZV 2019, 387); der deutsche Verordnungsgeber hat die Abgrenzungskriterien mithin nicht selbst entwickelt. Auch insgesamt standen seinerzeit die grundlegenden Fragen für die Zulassung zum Straßenverkehr im Vordergrund, wie Betriebserlaubnis, technischer Zulassungsanforderungen, Versicherungspflicht oder Regelungen zur Nutzung.
Für eine Differenzierung spricht zudem, dass der Bundesgerichtshof – in Bezug auf den judikativen Kraftfahrzeugbegriff im Zusammenhang mit dem BAK-Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit – es jüngst in den Raum gestellt hat, dass Elektrokleinstfahrzeuge einer gesonderten Betrachtung bedürfen (BGH NZV 2023, 418, 419).
Es findet sich überdies kein Anhaltspunkt im Text der Verordnung, deren Begründung, dem zugrundeliegenden Referentenentwurf oder sonst den Materialien, dass die Übertragung auf § 69 StGB intendiert oder auch nur erkannt worden wäre. Im Übrigen findet sich auch in den diesbezüglichen 39 Stellungnahmen von Verbänden etc., soweit diese veröffentlicht sind, nichts hierzu (https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Gesetze-19/entwurf-verordnung-teilnahme-elektrokl einstfahrzeuge-strassenverkehr.html?nn=382740). Hätte der Verordnungsgeber mit einer Ausweitung von § 69 StGB gerechnet, hätte er die Mehrbelastung für die Justizhaushalte der Länder (auch wenn nicht konkret bezifferbar) zudem unter „Weitere Kosten“ in der Verordnungsbegründung aufführen müssen. Die Verordnung wurde zudem von drei Ministerien erlassen, nicht jedoch dem für Strafrecht zuständigen Bundesministerium der Justiz. Die Verordnung wurde im Bundesrat zudem mehreren Ausschüssen zugewiesen (vgl. BR-Drs. 158/19, S. 1), nicht indes dem Rechtsausschuss, der bei Berührungspunkten mit dem Strafrecht stets (mitberatend) befasst wird.
Vor diesem Hintergrund ist es fernliegend, aus der Verwendung des Begriffs „Kraftfahrzeug“ in der eFKV einen Willen des Verordnungsgebers auf die gleichlautende Voraussetzung in § 69 StGB herleiten zu können.
Im Übrigen könnte der Verordnungsgeber das Straf- und Maßregelrecht aufgrund des Vorbehalts des Gesetzes bzw. der Wesentlichkeitslehre nicht (auf weitere Fahrzeugtypen) ausweiten (s. auch LG Potsdam, Beschl. v. 10.06.2022 – 23 Qs 25/22, S. 6). Die Regelungsmaterie ist zudem nicht von den Ermächtigungen der eFKV, die sich in § 6 StVG befinden, oder anderweitigen Ermächtigungsgrundlagen mit erfasst und damit jedenfalls aus diesem Grunde wegen der Verletzung von Art. 80 Abs. 1 Grundgesetz (GG) verfassungs- und rechtswidrig.
(2) Die Definition des § 1 Abs. 2 StVG, wonach „[a]ls Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes […] Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein[, gelten]“, sodass danach auch Elektrokleinstfahrzeuge erfasst wären, kann ebenfalls nicht auf § 69 StGB übertragen werden.
Zuvörderst gilt zu beachten, dass der Gesetzeswortlaut es eindeutig zum Ausdruck bringt, dass die Definition des Kraftfahrzeugs auf das StVG beschränkt sein soll („im Sinne dieses Gesetzes“) und die Definition im Übrigen aus der Zeit stammt, als es noch keine Elektrokleinstfahrzeuge gab.
Auch hat der historische Gesetzgeber in Bezug auf das Tatbestandsmerkmal „Kraftfahrzeug“ (im Rahmen des § 42m StGB a.F.) weder im Wortlaut noch in der Begründung auf die dem heutigen § 1 Abs. 2 StVG im Wesentlichen entsprechende Kraftfahrzeug-Definition – die seit 1909 in § 1 Abs. 2 im Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen (v. 03.05.1909, RGBl. S. 437) normiert war – Bezug genommen, obgleich ihm dies möglich war.
Insbesondere ist aus der Bereichsausnahme für Pedelecs in § 1 Abs. 3 StVG kein dahingehender Umkehrschluss möglich, dass Elektrokleinstfahrzeuge wie andere Kraftfahrzeuge zu behandeln sind. Begründet wird dies ergänzend insbesondere damit, dass der Gesetzgeber – jedenfalls zwischenzeitlich – eine solche Ausnahmevorschrift hätte schaffen können, zumal er das StVG 2021 geändert hat (so etwa OLG Hamburg BeckRS 2022, 10351, Rn. 24 ff.; s. auch Valerius, Gesamtdokumentation 61. Verkehrsgerichtstag 2023, S. 171, 180; Zeyher, HRRS 2022, 218, 220).
Auch hier gilt es zunächst zu beachten, dass Bereichsausnahmen im StVG nach der gesetzgeberischen Konzeption in § 1 Abs. 2 StVG nur für das StVG („im Sinne dieses Gesetzes“), nicht hingegen für § 69 StGB verbindlich gelten, auch wenn die Rechtsprechung die Privilegierung für Pedelecs (in § 1 Abs. 3 StVG) auf § 69 StGB übertragen hat. Eine Bereichsausnahme im StVG wäre daher gleichwohl fehlplatziert, da die Anwendung für § 69 StGB vielmehr gelten würde und die Übertragung von den Unwägbarkeiten der Rechtsprechung abhängig wäre. Die (straßenverkehrs- als auch strafrechtliche) Gesetzgebung hat sich insofern bisher stets einer Positionierung zu Grenzfällen des § 69 StGB enthalten, sodass die konkrete Abgrenzung bisher der Rechtsprechungskonkretisierung überlassen blieb.
Die mangelnde Positionierung des Gesetzgebers im Hinblick auf das Strafrecht steht auch mit dem historischen Hintergrund der Bereichsausnahme für Pedelecs im Zusammenhang. Denn diese geht zurück auf das Güterkraftverkehrsgesetz aus dem Jahr 2013, das die Definition seinerseits aus Art. 1 Abs. 2 lit. a und h der Richtlinie 2002/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. März 2002 über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 92/61/EWG des Rates übernommen hatte (BT-Drs. 17/12856, S. 7, 11). Die Ausnahme des § 1 Abs. 3 StVG war also unionsrechtlich vorbestimmt und mitnichten strafrechtlich oder vom deutschen Gesetzgeber vor dem Hintergrund der Straßenverkehrssicherheit entwickelt. Der Unionsgesetzgeber seinerseits hat bei der Bestimmung der Kriterien diverse (Lenkungs-)Zwecke, Marktgegebenheiten und Ähnliches berücksichtigt (Richtlinie 2002/24/EG). Es überzeugt vor diesem Hintergrund nicht, aus der fehlenden Normierung eines Ausnahmetatbestands für Elektrokleinstfahrzeuge oder E-Scooter – im Umkehrschluss – eine irgendgeartete Indikation für die Auslegung des § 69 StGB herzuleiten.
Abseits dessen, dass mangels Befassung möglicherweise eine legislative Willensbildung schlicht fehlte oder nötige politische Mehrheiten – in die eine oder andere Richtung – nicht beschafft werden konnten oder „die Legislative“ die Frage bewusst der Rechtsprechungskonkretisierung überlassen wollte, drängt sich eine Kurskorrektur durch den Gesetzgeber im Übrigen auch vor dem Hintergrund nicht auf, dass bisher noch keine klare Rechtsprechungslinie bzw. höchstrichterliche Entscheidung hierzu existiert.
(3) Demnach lässt die Rechtsprechungshistorie des StVG und der eFKV keine Schlüsse auf die Frage der Anwendung des § 69 StGB auf E-Scooter zu und steht dem dies ablehnenden Auslegungsergebnis – das insbesondere aus Systematik, Historie (des § 42m StGB a.F.) und Telos geschöpft wurde – nicht entgegen.
dd) Die Annahme, dass § 69 StGB E-Scooter-Fahrer nicht erfasst, ist auch im Hinblick auf den Gesetzeszweck der Gewährleistung der Straßenverkehrssicherheit unbedenklich. Denn es greift die subsidiäre Kompetenz der Fahrerlaubnisbehörden, sodass es im Wesentlichen nur zu einer Zuständigkeitsverlagerung kommt. Die Fahrerlaubnisbehörden haben dabei eine umfassende Betrachtung vorzunehmen, mithin Umstände über die konkrete Tat hinaus miteinzubeziehen, anders als der Strafrichter bei Anwendung von § 69 StGB. Insbesondere können die Fahrerlaubnisbehörden sich vor einer Entziehungsentscheidung medizinisch-psychologischen Sachverstands bedienen, um das individuelle Gefahrenpotential zu eruieren.
3. Würde man im Übrigen – anders als hier vertreten – annehmen, dass die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 StGB dem Grunde nach vorliegen, es sich bei E-Scootern (als Tatmittel) insbesondere um Kraftfahrzeuge in Sinne von § 69 Abs. 1 S. 1, Hs. 1 und 2 StGB handelt und „sich aus der Tat“ mit einem E-Scooter grundsätzlich auch ergeben kann, dass der Täter zum Führen von (fahrerlaubnispflichtigen) Kraftfahrzeugen im Sinne von § 69 Abs. 1 S. 1, letzter Hs. StGB ungeeignet ist, müsste die Fahrerlaubnisentziehung im Ergebnis gleichwohl abgelehnt werden.
Zwar ist bei der – hier etwaig vorliegenden – Trunkenheit im Straßenverkehr (dazu vorstehend unter II. 1.) nach dem gesetzlichen Leitbild des § 69 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 316 StGB regelmäßig die Fahrerlaubnis zu entziehen.
Vorliegend ist die grundsätzliche Indizwirkung jedoch als entkräftet anzusehen.
a) Nach § 69 Abs. 2 StGB hat der Gesetzgeber in den aufgelisteten Fällen die richterliche Bewertung und Prognose der Frage der Eignung vorweggenommen und dem Richter die Feststellung eines Eignungsmangels erleichtert (Kinzig in: TK-StGB, 31. Aufl. 2025, § 69, Rn. 34 m.w.N.). Die Wirkung der gesetzlichen Vermutung geht dahin, dass für die Feststellung der Ungeeignetheit eine sie explizit begründende Gesamtwürdigung nur erforderlich ist, wenn ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Ausnahmefall vorliegen könnte (Fischer, StGB, 72. Aufl. 2025, § 69 Rn. 22). Solche besonderen Umstände können entweder in der Tat, in der Persönlichkeit des Täters oder dem Nachtatverhalten liegen (Valerius, in: LK-StGB, 14. Aufl. 2024, § 69, Rn. 136) und sind insbesondere dann besonders sorgfältig zu prüfen, wenn Anlasstat ein Fall der Trunkenheit im Verkehr ist (BayObLG BeckRS 2020, 21388; Valerius, in: LK-StGB, 14. Aufl. 2024, § 69, Rn. 194). Als Fall besonderer Umstände der Tat wird nach der amtlichen Begründung in Betracht gezogen, dass der Täter in einer notstandsähnlichen Lage gehandelt hatte, die sein Verhalten zwar nicht voll entschuldigen, aber immerhin begreiflich erscheinen ließen (BT.-Drs. IV/651 S. 17). Die Indizwirkung kann der Rechtsprechung nach auch bei sog. Bagatellfahrten entfallen, worunter vor allem folgenlos gebliebene Trunkenheitsfahrten zu verstehen sind, bei denen der alkoholisierte Fahrer das Kraftfahrzeug auf der Straße oder einem öffentlichen Parkplatz lediglich um wenige Meter versetzt, um das Fahrzeug ordnungsgemäß zu parken (vgl. OLG Stuttgart, NJW 1987, 142; OLG Düsseldorf, NZV 1988, 29). Besondere Umstände in der Persönlichkeit des Täters sind unter Umständen anzunehmen, wenn die Tat eher persönlichkeitsfremde Züge aufweist, nicht zuletzt situationsbedingt war und demzufolge mit hinreichender Sicherheit erwartet werden darf, dass der Täter gleiche oder ähnliche Taten künftig nicht mehr begehen wird. Dies wäre beispielsweise zu prüfen, wenn der Täter sich bei Tatbegehung in einem emotionalen Ausnahmezustand befunden hätte (BayObLG BeckRS 2020, 21388; OLG Hamm BeckRS 2025, 1706; Valerius, in: LK-StGB, 14. Aufl. 2024, § 69, Rn. 142, von Heintschel-Heinegg/Huber, in: MüKO-StGB, 4. Aufl. 2020, § 69, Rn. 76).
Ein solcher Ausnahmefall liegt hier vor.
Dies beruht allein auf dem Umstand, dass es sich bei dem Tatmittel um einen E-Scooter handelt.
Dies folgt aus den unter II. 2. c) bb) (5) und (6), insbesondere dort unter (b) und (c), dargelegten Gründen. Insbesondere kann eine größere Gefährdung dritter Verkehrsteilnehmer als bei – von § 69 StGB nach dem klaren gesetzgeberischen Willen per se nicht erfassten – Fahrrädern und Pedelecs nicht begründet werden.
Wie unter II. 2. c) cc) kann die Erfassung von E-Scootern insbesondere auch nicht mit Verweis auf entsprechende Wertentscheidungen des Gesetzgebers (insbesondere des StVG) oder Verordnungsgebers (der eFKV) begründet werden; denn solche existieren bereits nicht.
Im Rahmen der gebotenen Gesamtwertung tritt vorliegend im Übrigen hinzu, dass der Beschuldigte keinerlei Einträge im Verkehrszentralregister und keine Vorstrafen hat.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 473 Abs. 2 StPO.