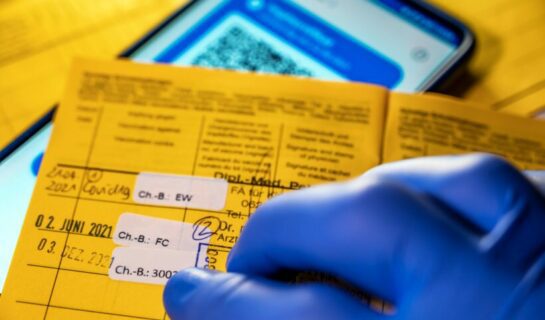Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Ein Urteil des AG Paderborn im Fokus
- Die Person des Angeklagten und sein Vorleben
- Vollstreckungsverfahren und die Eskalation
- Die rechtliche Grundlage: § 113 StGB und die Duldungspflicht
- Tätlicher Angriff und die Konsequenzen
- Die Bewährung und ihre Bedingungen
- Was bedeutet das Urteil für Menschen in ähnlichen Situationen?
- Handlungsempfehlungen und rechtliche Beratung Vollstreckung
- Die Kosten des Verfahrens und die Bedeutung der Bewährung
- Vollstreckungsabwehr und präventive Maßnahmen
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Benötigen Sie Hilfe?
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was gilt rechtlich als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte?
- Welche Strafen drohen bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte?
- Wie sollte man sich bei einer Vollstreckungsmaßnahme rechtlich korrekt verhalten?
- Welche rechtlichen Verteidigungsmöglichkeiten gibt es nach einem Widerstandsvorwurf?
- Wann ist eine Vollstreckungsmaßnahme rechtmäßig und wann darf man sich wehren?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Das vorliegende Urteil
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: AG Paderborn
- Datum: 07.11.2023
- Aktenzeichen: 75 Ds-44 Js 393/23-120/23
- Verfahrensart: Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte
- Rechtsbereiche: Strafrecht
- Beteiligte Parteien:
- Angeklagte: Türkischer Staatsangehöriger, geboren am 02.11.1971, verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern sowie einem 11-jährigen Kind und Rentner. Er wird beschuldigt, sich tätlich angreifend gegen Vollstreckungsbeamte sowie Personen, die diesen gleichstehen, verhalten zu haben.
- Um was ging es?
- Sachverhalt: Am 31.03.2023, gegen 16:35 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem mutmaßlichen Suizid gerufen. Aufgrund einer Fehleinschätzung des tatsächlichen Einsatzortes – der 1,5 km vom vermuteten Ort entfernt lag – fuhr ein Pkw (Audi Q7) an die Stelle, in dem der Angeklagte auf dem Beifahrersitz saß.
- Kern des Rechtsstreits: Es ging um die rechtliche Würdigung der Handlungen des Angeklagten, die als Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen diese und tätlicher Angriff auf ihnen gleichgestellte Personen eingestuft wurden.
- Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten verurteilt, wobei die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem trägt er die Kosten des Verfahrens sowie seine notwendigen Auslagen.
- Begründung: Das Gericht stützte seine Entscheidung auf die besonderen persönlichen Umstände des Angeklagten – insbesondere seine bisherige Straffreiheit, sein Rentnerstatus und die familiäre Situation – sowie auf die konkreten Umstände des Tathergangs, die eine Bewährungsstrafe rechtfertigten.
- Folgen: Der Angeklagte muss die festgesetzten Verfahrenskosten und notwendigen Auslagen selbst tragen. Mit der Aussetzung der Freiheitsstrafe unter Bewährung hat er die Chance, sich straffrei zu bewähren.
Der Fall vor Gericht
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Ein Urteil des AG Paderborn im Fokus

Das Amtsgericht Paderborn fällte am 07. November 2023 ein Urteil (Az.: 75 Ds-44 Js 393/23-120/23) wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt, deren Vollstreckung jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem wurde er zur Übernahme der Kosten des Verfahrens und seiner notwendigen Auslagen verpflichtet. Die Entscheidung stützt sich auf die Paragraphen §§ 113 Abs. 1, 114 Abs. 1, 115 Abs. 3, 52 StGB. Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe dieses Urteils und die damit verbundenen rechtlichen Aspekte.
Die Person des Angeklagten und sein Vorleben
Der Angeklagte ist ein 1971 geborener türkischer Staatsangehöriger. Er ist verheiratet, hat mehrere Kinder und bezieht eine monatliche Rente von etwa 1.270,00 Euro. Bis zu diesem Verfahren war er strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten, was aus dem Bundeszentralregister ersichtlich ist. Dieser Umstand der bisherigen Straffreiheit dürfte bei der Entscheidung des Gerichts, die Strafe zur Bewährung auszusetzen, eine Rolle gespielt haben.
Vollstreckungsverfahren und die Eskalation
Obwohl das Urteil selbst keine detaillierte Schilderung des Tathergangs enthält, lässt sich aus der Anklage und den angewendeten Paragraphen ableiten, dass der Fall im Kontext einer gerichtlichen Vollstreckung oder einer ähnlichen Maßnahme stattfand. Häufig beginnen solche Situationen mit einem Haftbefehl Widerstand gegen eine behördliche Anordnung oder eine ausstehende Forderung. Der Angeklagte leistete dabei rechtswidrigen Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamte Widerstand leisten, was zur Anklage wegen tätlichen Angriffs führte.
Der Begriff „tateinheitlich“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die verschiedenen Handlungen (Widerstand und tätlicher Angriff) als eine einzige Tat im juristischen Sinne gewertet werden. Dies ist relevant für die Strafzumessung, da die Strafe für die schwerste Tat (hier vermutlich der tätliche Angriff) die Grundlage bildet.
Die rechtliche Grundlage: § 113 StGB und die Duldungspflicht
Zentral für das Urteil ist der Paragraph 113 des Strafgesetzbuches (StGB), der den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte unter Strafe stellt. Entscheidend ist, dass die Vollstreckungsbeamten rechtmäßig handeln und der Widerstand sich gegen diese rechtmäßige Handlung richtet. Das bedeutet, dass eine Duldungspflicht gegenüber der Zwangsmaßnahme besteht.
§ 113 Abs. 1 StGB lautet (vereinfacht): „Wer einem Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Verfügungen oder Anordnungen berufen ist, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung tätlich angreift, Gewalt androht oder Widerstand leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
Der springende Punkt ist der Begriff des „Widerstands“. Dieser umfasst jede aktive Handlung, die darauf abzielt, die Vollstreckungsmaßnahme zu verhindern oder zu erschweren. Ein Einschreiten gegen Vollstreckungsbeamte kann also schnell den Tatbestand des § 113 StGB erfüllen.
Tätlicher Angriff und die Konsequenzen
Der Umstand, dass der Angeklagte nicht nur Widerstand leistete, sondern auch einen tätlichen Angriff verübte, verschärfte die Situation. Ein tätlicher Angriff geht über bloßen Widerstand hinaus und beinhaltet eine aggressive, körperliche Einwirkung auf die Vollstreckungsbeamten. Die Verurteilung erfolgte zudem wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Dies deutet darauf hin, dass neben den eigentlichen Beamten auch andere Personen (z.B. Gerichtsvollziehergehilfen) von dem Angriff betroffen waren.
Die Bewährung und ihre Bedingungen
Obwohl der Angeklagte verurteilt wurde, setzte das Gericht die Strafe zur Bewährung aus. Dies bedeutet, dass er die Freiheitsstrafe nicht im Gefängnis verbüßen muss, solange er sich in der Bewährungszeit (die in der Regel zwischen zwei und fünf Jahren liegt) nichts zuschulden kommen lässt. Die Aussetzung zur Bewährung ist ein Zeichen dafür, dass das Gericht dem Angeklagten eine positive Sozialprognose bescheinigt, also davon ausgeht, dass er zukünftig keine Straftaten mehr begehen wird.
Die Bewährung kann mit Auflagen verbunden sein, wie beispielsweise die Zahlung einer Geldstrafe, die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder die Erfüllung bestimmter Weisungen des Gerichts oder des Bewährungshelfers. Verstößt der Angeklagte gegen diese Auflagen oder begeht er während der Bewährungszeit eine neue Straftat, kann die Bewährung widerrufen werden und er muss die ursprüngliche Freiheitsstrafe doch noch verbüßen.
Was bedeutet das Urteil für Menschen in ähnlichen Situationen?
Dieses Urteil verdeutlicht die Ernsthaftigkeit, mit der der Staat gegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeht. Personen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, sollten sich bewusst sein, dass Erzwungene Vollstreckung grundsätzlich zu dulden ist. Anstatt Widerstand zu leisten, sollten sie versuchen, die Situation deeskalierend zu lösen und ihre rechtlichen Ansprüche Vollstreckung geltend zu machen.
Es gibt durchaus rechtliche Mittel gegen Vollstreckung, wie beispielsweise den Einspruch gegen Vollstreckung oder die Beantragung von Vollstreckungsschutz. Diese müssen jedoch auf dem Rechtsweg und nicht durch rechtswidriger Widerstand geltend gemacht werden.
Handlungsempfehlungen und rechtliche Beratung Vollstreckung
Sollte man mit einer Vollstreckungsbehörde in Konflikt geraten, ist es ratsam, sich umgehend rechtliche Beratung Vollstreckung zu suchen. Ein Anwalt kann die Sachlage prüfen, die Erfolgsaussichten von Rechtsmitteln einschätzen und im besten Fall eine gütliche Einigung mit der Vollstreckungsbehörde erzielen. Es ist in jedem Fall besser, frühzeitig Zwangsmaßnahmen vermeiden zu wollen, anstatt durch Einschreiten gegen Vollstreckungsbeamte eine Eskalation zu provozieren. Die frühzeitige anwaltliche Beratung kann helfen, unnötige strafrechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Sollte es dennoch zu einer Situation kommen, in der man sich ungerecht behandelt fühlt, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und die Situation nicht durch Gewalt zu verschlimmern. Auch wenn der Impuls groß ist, sich zu wehren, sollte man sich bewusst sein, dass dies in der Regel nur zu einer Verschärfung der Situation führt. In solchen Fällen kann es ratsam sein, eine Freiwillige Rückgabe in Betracht zu ziehen und gleichzeitig rechtliche Beratung Vollstreckung in Anspruch zu nehmen, um die eigenen Rechte zu wahren.
Es ist wichtig zu betonen, dass Notwehr gegen Vollstreckungsbeamte nur in extremen Ausnahmefällen gerechtfertigt ist, beispielsweise wenn die Beamten unverhältnismäßige Gewalt anwenden. In der Regel ist es jedoch besser, die Situation zu dokumentieren und im Nachhinein rechtliche Schritte einzuleiten.
Die Kosten des Verfahrens und die Bedeutung der Bewährung
Die Übernahme der Kosten des Verfahrens durch den Angeklagten ist eine übliche Konsequenz einer Verurteilung. Diese Kosten können je nach Umfang des Verfahrens erheblich sein und eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellen. Die Aussetzung der Strafe zur Bewährung ist jedoch ein positives Signal, das dem Angeklagten eine zweite Chance gibt. Es liegt nun an ihm, diese Chance zu nutzen und sich zukünftig an die Gesetze zu halten.
Vollstreckungsabwehr und präventive Maßnahmen
Es ist wichtig zu verstehen, dass es verschiedene Möglichkeiten der Vollstreckungsabwehr gibt, bevor es zu einer Situation kommt, in der Widerstand geleistet wird. Dazu gehören beispielsweise die Vereinbarung von Ratenzahlungen, die Beantragung von Stundungen oder die Geltendmachung von Einwendungen gegen die Forderung selbst. Es ist ratsam, sich frühzeitig über diese Möglichkeiten zu informieren und gegebenenfalls Sicherheitsleistungen bei Vollstreckung zu erbringen, um eine Eskalation zu vermeiden.
Dieses Urteil des Amtsgerichts Paderborn dient als Mahnung, dass Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Es zeigt aber auch, dass das Gericht bei der Strafzumessung die individuellen Umstände des Falles berücksichtigt und die Möglichkeit der Bewährung gewährt, wenn eine positive Sozialprognose besteht.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil zeigt, dass auch erstmalige Straftäter bei Angriffen auf Einsatzkräfte mit Freiheitsstrafen rechnen müssen, selbst wenn keine Verletzungen entstanden sind. Die Behinderung von Rettungseinsätzen wird als besonders verwerflich eingestuft, da hierdurch die Hilfe für andere Menschen verzögert werden kann. Ein Geständnis, Einsicht und Entschuldigung können jedoch zu einer Bewährungsstrafe führen.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Wenn Sie Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit behindern oder gar angreifen, müssen Sie mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 3 Monaten rechnen – auch wenn Sie bisher nicht straffällig geworden sind. Zeigen Sie sich im Verfahren jedoch einsichtig und gestehen die Tat, kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Sie vermeiden damit einen Gefängnisaufenthalt, haben aber dennoch eine Vorstrafe. Besonders schwer wiegt es, wenn durch Ihr Verhalten Rettungseinsätze verzögert werden und dadurch andere Menschen zu Schaden kommen könnten.
Benötigen Sie Hilfe?
Klare Perspektiven bei Konflikten mit Vollstreckungsbeamten?
In Situationen, in denen behördliche Maßnahmen und persönliche Reaktionen zu komplexen rechtlichen Fragestellungen führen, ist eine fundierte und präzise Analyse der Umstände von entscheidender Bedeutung. Ein sachlicher Blick auf die Details kann helfen, Ihre Situation besser zu verstehen und etwaige Unsicherheiten auszuräumen.
Unsere Kanzlei unterstützt Sie dabei, den Kern Ihres Anliegens systematisch zu erfassen. Mit einer sorgfältigen Fallanalyse und einer verständlichen Beratung, die Ihre individuellen Besonderheiten berücksichtigt, arbeiten wir daran, Ihnen Klarheit über Ihre rechtlichen Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln. Setzen Sie auf professionelle Beratung, um in unsicheren Zeiten die richtige Richtung einzuschlagen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was gilt rechtlich als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte?
Der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist in § 113 StGB geregelt und liegt vor, wenn Sie einem Amtsträger bei der Vornahme einer Diensthandlung mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt Widerstand leisten.
Geschützte Amtsträger
Die Vorschrift schützt verschiedene Personengruppen bei der Ausübung ihrer Diensthandlungen:
- Polizeibeamte bei Verkehrskontrollen, Durchsuchungen oder Festnahmen
- Gerichtsvollzieher bei Pfändungen
- Rettungskräfte bei hoheitlichen Aufgaben
- Soldaten der Bundeswehr im Rahmen ihrer Dienstausübung
Formen des Widerstands
Als Widerstand gelten aktive Bemühungen, die darauf abzielen, eine Vollstreckungshandlung zu verhindern oder zu erschweren. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Widerstand erfolgreich war. Strafbar sind zwei Handlungsformen:
Gewaltanwendung, zum Beispiel:
- Schubsen eines Gerichtsvollziehers bei einer Pfändung
- Wehren gegen das Anlegen von Handschellen
- Zufahren mit einem Kraftfahrzeug auf einen Polizeibeamten
Drohung mit Gewalt, etwa:
- Ankündigung von Schlägen bei einer Kontrolle
- Verbale Androhung körperlicher Gewalt
- Bedrohliche Gesten mit gefährlichen Gegenständen
Besonders schwere Fälle
Ein besonders schwerer Fall liegt vor, wenn:
- Sie oder andere Beteiligte Waffen oder gefährliche Werkzeuge bei sich führen
- Der Amtsträger in Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung gebracht wird
- Die Tat gemeinschaftlich begangen wird
Wichtig: Die Tat ist nicht strafbar, wenn die Diensthandlung selbst nicht rechtmäßig ist. Dies gilt auch dann, wenn Sie irrtümlich annehmen, die Diensthandlung sei unrechtmäßig.
Die bloße Flucht oder das passive Verweigern einer Handlung erfüllt noch nicht den Tatbestand des Widerstands. Erst wenn Sie aktiv Gewalt anwenden oder mit dieser drohen, machen Sie sich strafbar.
Welche Strafen drohen bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte?
Bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach § 113 StGB droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Die konkrete Strafe richtet sich nach der Schwere des Widerstands und den Umständen der Tat.
Einfacher Widerstand
Ein einfacher Widerstand liegt vor, wenn Sie sich beispielsweise gegen das Anlegen von Handschellen wehren oder bei einer Verkehrskontrolle den Anweisungen nicht Folge leisten. In solchen Fällen wird meist eine Geldstrafe verhängt, die bei mindestens 90 Tagessätzen beginnt.
Besonders schwere Fälle
Die Strafe erhöht sich auf sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe, wenn:
- Sie oder andere Beteiligte eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug bei sich führen
- Sie den Beamten in Lebensgefahr oder die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringen
- Die Tat gemeinschaftlich mit anderen begangen wird
Strafmildernde Umstände
Das Gericht kann die Strafe mildern oder von einer Bestrafung absehen, wenn:
- Sie irrtümlich annahmen, die Diensthandlung sei nicht rechtmäßig
- Sie den Irrtum nicht vermeiden konnten
- Eine geringe Schuld vorliegt
Ein typisches Beispiel aus der Praxis: Wenn Sie bei einer Verkehrskontrolle unbewusst gegen einen Beamten lehnen, während Sie Ihre Brieftasche greifen, und der Polizist dies als tätlichen Angriff wertet, kann bereits eine mehrmonatige Freiheitsstrafe drohen.
Wie sollte man sich bei einer Vollstreckungsmaßnahme rechtlich korrekt verhalten?
Grundlegende Verhaltensregeln
Bei einer Vollstreckungsmaßnahme müssen Sie den Anordnungen der Vollstreckungsbeamten Folge leisten. Bleiben Sie stets höflich und leisten Sie keinen Widerstand, da dies strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
Der Gerichtsvollzieher muss sich in der Regel schriftlich bei Ihnen ankündigen. Mit dieser Ankündigung erhalten Sie normalerweise auch den Vollstreckungstitel. Sie können die Identität des Vollstreckungsbeamten durch Vorlage des Dienstausweises überprüfen lassen.
Ihre Rechte und Pflichten
Sie sind nur verpflichtet, folgende Angaben zu Ihrer Person zu machen:
- Name
- Anschrift
- Geburtsort und Geburtsdatum
- Familienstand
- Verwandtschaftsverhältnisse
Ohne richterlichen Beschluss müssen Sie dem Gerichtsvollzieher nicht den Zutritt zur Wohnung gewähren. Der Vollstreckungsbeamte darf jedoch bei wiederholter Zutrittsverweigerung eine richterliche Durchsuchungsanordnung beantragen.
Pfändungsschutz und Grenzen der Vollstreckung
Der Gerichtsvollzieher darf nicht Ihre gesamte Wohnung leerräumen. Es gibt klare Pfändungsschutzgrenzen. Gepfändete Gegenstände werden mit einem Pfandsiegel versehen und dürfen dann weder genutzt noch veräußert werden.
Kommunikation während der Vollstreckung
Vermeiden Sie unbedachte Äußerungen, da diese protokolliert werden können. Der Vollstreckungsbeamte ist verpflichtet, über jede Vollstreckungshandlung eine Niederschrift anzufertigen.
Wenn Sie der Auffassung sind, dass der zu vollstreckende Anspruch nicht oder nicht in voller Höhe besteht, können Sie Einwendungen erheben. Bei bürgerlich-rechtlichen Forderungen muss die Vollstreckung in diesem Fall eingestellt werden.
Welche rechtlichen Verteidigungsmöglichkeiten gibt es nach einem Widerstandsvorwurf?
Prüfung der Rechtmäßigkeit der Diensthandlung
Bei einem Widerstandsvorwurf ist zunächst die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahme zu prüfen. Eine Verteidigung kann ansetzen, wenn die Vollstreckungshandlung rechtswidrig war oder formelle Fehler aufweist.
Tatbestandliche Einschränkungen
Der Tatbestand des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erfordert aktives Handeln. Rein passives Verhalten wie Sitzblockaden oder die bloße Weigerung, einer polizeilichen Anordnung Folge zu leisten, erfüllt nicht den Tatbestand.
Subjektive Komponenten
Eine wichtige Verteidigungsmöglichkeit liegt im Vorsatzerfordernis. Der Täter muss gewusst haben, dass es sich bei den Personen um Vollstreckungsbeamte handelt und dass diese eine Diensthandlung vornehmen. Fehlt diese Kenntnis, liegt kein strafbarer Widerstand vor.
Notsituationen als Rechtfertigung
In bestimmten Situationen können Notwehr oder Notstand als Rechtfertigungsgründe in Betracht kommen. Dies ist etwa der Fall, wenn die Vollstreckungshandlung mit unverhältnismäßiger Gewalt durchgeführt wurde.
Prozessuale Strategien
Eine effektive Verteidigung setzt bei der genauen Dokumentation des Geschehensablaufs an. Oft weichen die Darstellungen der Beteiligten voneinander ab. Hier ist die detaillierte Schilderung der eigenen Wahrnehmung von großer Bedeutung.
Strafmildernde Faktoren
Bei der Strafzumessung können verschiedene Aspekte mildernd berücksichtigt werden:
- Fehlende Vorstrafen
- Situative Überforderung
- Spontanität der Handlung
- Geringes Gewaltpotential
Beweissicherung
Unmittelbar nach dem Vorfall sollten alle relevanten Informationen dokumentiert werden. Dazu gehören:
- Genaue Beschreibung des Ablaufs
- Namen möglicher Zeugen
- Vorhandene Verletzungen
- Beschädigungen an Kleidung oder Gegenständen
Wann ist eine Vollstreckungsmaßnahme rechtmäßig und wann darf man sich wehren?
Eine Vollstreckungsmaßnahme ist nur dann rechtmäßig, wenn sie auf einem vollstreckbaren Titel basiert und alle formellen sowie materiellen Voraussetzungen erfüllt sind.
Voraussetzungen für eine rechtmäßige Vollstreckung
Grundvoraussetzungen für eine rechtmäßige Vollstreckungsmaßnahme sind:
- Ein vollstreckbarer Verwaltungsakt oder Titel
- Die vorherige Bekanntgabe des Leistungsgebots
- Die Fälligkeit des Anspruchs
- Der Ablauf der Vollstreckungsschonfrist
Bei der Durchführung der Vollstreckung müssen die staatlichen Vollstreckungsorgane den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. Das bedeutet, die gewählte Maßnahme muss in einem angemessenen Verhältnis zum erstrebten Erfolg stehen.
Unrechtmäßige Vollstreckungsmaßnahmen
Eine Vollstreckungsmaßnahme ist nicht rechtmäßig, wenn:
- Der zugrundeliegende Anspruch erloschen ist
- Die Vollstreckung durch Stundung oder Aussetzung gehindert ist
- Die Vollstreckung aus Billigkeitsgründen eingestellt wurde
Möglichkeiten der Gegenwehr
Wenn eine Vollstreckungsmaßnahme nicht rechtmäßig ist, dürfen Sie sich dagegen zur Wehr setzen. Allerdings ist dabei zu beachten:
Aktiver Widerstand durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt ist auch bei unrechtmäßigen Maßnahmen grundsätzlich strafbar. Stattdessen sollten Sie den Rechtsweg beschreiten.
Wenn Sie irrtümlich annehmen, dass eine Diensthandlung nicht rechtmäßig ist, kann das Gericht die Strafe mildern oder bei geringer Schuld von einer Bestrafung absehen.
Rechtliche Konsequenzen bei Widerstand
Bei unberechtigtem Widerstand gegen rechtmäßige Vollstreckungsmaßnahmen drohen:
- Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
- In besonders schweren Fällen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
Die Vollstreckungsbehörde muss Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren Standpunkt nach der Vollstreckung durch Einlegung eines Vollstreckungsrechtsbehelfs darzulegen.
Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte
Ein schwerwiegendes Delikt nach § 114 StGB, bei dem ein aktiver körperlicher Angriff gegen einen Amtsträger während seiner Diensthandlung erfolgt. Anders als beim Widerstand muss keine konkrete Vollstreckungshandlung vorliegen. Bereits das gezielte Angreifen des Beamten ist strafbar, auch wenn keine Verletzung eintritt.
Beispiel: Ein Demonstrant wirft gezielt eine Flasche nach einem Polizisten während einer Streifenfahrt, verfehlt ihn aber.
Tateinheit
Wenn mehrere Straftaten durch eine einzige Handlung begangen werden, spricht man von Tateinheit (§ 52 StGB). Es wird nur das Gesetz mit der schwersten Strafandrohung angewendet, die anderen Delikte werden aber bei der Strafzumessung berücksichtigt.
Beispiel: Ein Schlag gegen einen Polizisten erfüllt gleichzeitig den Tatbestand der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Bewährung
Die Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung bedeutet, dass der Verurteilte nicht ins Gefängnis muss, wenn er während der Bewährungszeit (2-5 Jahre) keine weiteren Straftaten begeht. Geregelt in §§ 56 ff. StGB. Das Gericht kann zusätzlich Auflagen und Weisungen erteilen.
Beispiel: Eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten wird zur Bewährung ausgesetzt mit der Auflage, 60 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten.
Notwendige Auslagen
Kosten, die für die Verteidigung im Strafverfahren zwingend erforderlich waren, insbesondere Anwaltskosten und Fahrtkosten zu Gerichtsterminen. Bei einer Verurteilung muss der Angeklagte diese selbst tragen (§ 465 StPO).
Beispiel: Anwaltshonorar, Fahrtkosten zum Gericht, Kosten für notwendige Gutachten.
Das vorliegende Urteil
AG Paderborn – Az.: 75 Ds-44 Js 393/23-120/23 – Urteil vom 07.11.2023
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.