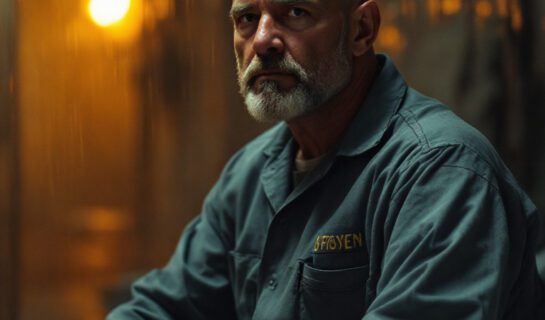Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich dieser Frage gestellt und eine feine Linie gezogen: Wann genau ist das Wegfahren ohne zu zahlen eigentlich strafrechtlich vollendet? Die Antwort hängt von einem Detail ab, das die übliche Vorstellung von Tankbetrug auf den Kopf stellt.
Übersicht
- Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Weggefahren ohne zu zahlen: Der BGH zieht eine feine Linie beim Tankbetrug – Wann ist es vollendet, wann nur Versuch?
- Der Fall, der die Debatte neu befeuerte: ein junger Mann und vier Tankfüllungen
- Das juristische Puzzle: Was macht einen Betrug zum Betrug?
- Die entscheidende Frage des BGH: Hat überhaupt jemand etwas bemerkt?
- Die Konsequenz: Nur versuchter Betrug ohne bemerkten Vorgang
- Warum eigentlich kein Diebstahl? Die Sache mit dem Einverständnis
- Die praktischen Folgen der BGH-Entscheidung
- Was ist mit der Unterschlagung? Ein juristischer Nebenschauplatz
- Der schmale Grat zwischen Versuch und Vollendung: Auswirkungen auf die Strafe
- Häufig gestellte Fragen zum Tankbetrug nach der BGH-Entscheidung
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Ist Tankbetrug jetzt immer nur noch versuchter Betrug?
- Was ist, wenn die Tankstelle komplett videoüberwacht ist? Zählt das als „bemerkt werden“?
- Was passiert, wenn ich beim Tanken versehentlich vergesse zu bezahlen und wegfahre?
- Spielt es eine Rolle, ob die Tankstelle sehr voll oder fast leer war?
- Was sollte ich tun, wenn mir Tankbetrug vorgeworfen wird?
- Ändert diese BGH-Entscheidung etwas an älteren Urteilen wegen Tankbetrugs?
- Warum macht das Gesetz überhaupt so einen komplizierten Unterschied zwischen Versuch und Vollendung?
- Fazit: Klare Linie in einem komplexen Feld

Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Ein vollendeter Tankbetrug (§ 263 StGB) liegt vor, wenn der Täter durch sein Verhalten (z.B. Auftreten als normaler Kunde) über seine fehlende Zahlungsabsicht täuscht, dadurch beim zuständigen Personal ein Irrtum über die Zahlungsbereitschaft entsteht und dieses deshalb das Betanken oder Wegfahren duldet, wodurch ein Schaden entsteht. Entscheidend ist der Irrtum einer konkreten Person, nicht zwingend die lückenlose Beobachtung.
- Wenn das Personal den Vorgang nicht bemerkt oder die Täuschungsabsicht durchschaut, sodass kein Irrtum entsteht, ist der Betrug nur versucht (§§ 263, 22, 23 StGB), sofern der Täter mit Vorsatz handelte, nicht zu zahlen.
- Diese Unterscheidung ist wichtig, da die Strafe für versuchten Betrug milder ausfallen kann als für vollendeten Betrug.
- Tankbetrug ist in der Regel kein Diebstahl (§ 242 StGB), weil die Tankstelle das Tanken aufgrund der (durch Täuschung erschlichenen) Annahme der Zahlungsbereitschaft gestattet – es fehlt am Gewahrsamsbruch gegen den Willen des Berechtigten.
- Für die Staatsanwaltschaft bedeutet das: Sie muss für eine Verurteilung wegen vollendeten Betrugs nachweisen, dass das Personal tatsächlich einem Irrtum unterlag. Gelingt dies nicht, kommt bei nachweisbarem Vorsatz eine Verurteilung wegen versuchten Betrugs in Betracht.
- Tankstellenbetreiber und Gerichte müssen Beweise (z. B. Video, Zeugen) sorgfältig prüfen, insbesondere im Hinblick auf den Irrtum des Personals.
- Für Betroffene heißt das: Bei Vorwürfen wegen Tankbetrugs ist frühzeitiger rechtlicher Beistand wichtig, da der Nachweis des Irrtums beim Personal ausschlaggebend für die Einordnung als vollendete oder versuchte Tat ist.
Quelle: Bundesgerichtshof (BGH) Az.: 6 StR 676/24 vom 21.01.2025
Weggefahren ohne zu zahlen: Der BGH zieht eine feine Linie beim Tankbetrug – Wann ist es vollendet, wann nur Versuch?
Die Preise an der Zapfsäule treiben vielen Autofahrern Sorgenfalten auf die Stirn. Da mag der Gedanke, nach dem Tanken einfach davonzufahren, für einen kurzen, dunklen Moment verlockend erscheinen. Doch was juristisch nach einer klaren Sache – Diebstahl oder Betrug – klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als komplexes rechtliches Minenfeld.
Insbesondere an modernen Selbstbedienungstankstellen stellt sich immer wieder die Frage: Wann genau ist der sogenannte „Tankbetrug“ eigentlich vollendet? Ist es schon passiert, sobald der letzte Tropfen Benzin im Tank ist und der Fahrer Gas gibt? Oder braucht es mehr? Mit dieser kniffligen Abgrenzung hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) in einem aufschlussreichen Beschluss vom 21. Januar 2025 (Aktenzeichen: 6 StR 676/24) auseinandergesetzt und wichtige Leitplanken für die Praxis gesetzt. Das Urteil ist nicht nur für Juristen relevant, sondern gerade auch für Betroffene – seien es Tankstellenbetreiber oder Autofahrer, die vielleicht selbst in eine solche Situation geraten sind oder sich davor schützen wollen.
Der Fall, der die Debatte neu befeuerte: ein junger Mann und vier Tankfüllungen
Im Zentrum der BGH-Entscheidung stand der Fall eines jungen Mannes, nennen wir ihn Herrn S., der vor dem Landgericht Magdeburg angeklagt war. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, in vier Fällen den Wagen seiner Schwester an verschiedenen Tankstellen betankt zu haben. Nach außen hin, so stellte das Landgericht fest, trat Herr S. dabei wie ein zahlungsfähiger und -williger Kunde auf. Doch dieser Schein trog. Herr S. hatte von Anfang an nicht die Absicht zu bezahlen. Nach jedem Tankvorgang stieg er wieder ein und fuhr davon, ohne die Rechnung an der Kasse zu begleichen.
Das Landgericht Magdeburg sah darin einen vollendeten Betrug und verurteilte Herrn S. unter Einbeziehung weiterer Delikte (Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis) zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren und neun Monaten.
Herr S. legte gegen dieses Urteil Revision beim Bundesgerichtshof ein – und hatte damit zumindest teilweise Erfolg. Der 6. Strafsenat des BGH kippte die Verurteilung wegen vollendeten Betrugs in den vier Tank-Fällen. Doch warum? Hatte Herr S. nicht eindeutig getankt und war weggefahren, ohne zu zahlen? Die Antwort liegt in den Feinheiten des Betrugstatbestands und der Frage, was genau im Kopf eines Tankstellenmitarbeiters vorgehen muss, damit aus einer dreisten Tat ein juristisch vollendeter Betrug wird.
Das juristische Puzzle: Was macht einen Betrug zum Betrug?
Um die Entscheidung des BGH zu verstehen, müssen wir uns kurz ansehen, was das Gesetz unter Betrug versteht. Der entsprechende Paragraf im Strafgesetzbuch, § 263 StGB, ist Dreh- und Angelpunkt. Ein Betrug liegt demnach vor, wenn jemand eine andere Person über Tatsachen täuscht, dadurch bei dieser Person einen Irrtum hervorruft oder unterhält, und diese Person aufgrund des Irrtums eine sogenannte Vermögensverfügung vornimmt, die letztlich zu einem Vermögensschaden bei ihr oder einem Dritten führt. Der Täter muss dabei die Absicht haben, sich oder jemandem anderem einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen.
Im Fall des Tankbetrugs läuft die Argumentationskette für einen vollendeten Betrug typischerweise so:
- Täuschung: Der Täter täuscht, indem er sich wie ein normaler Kunde verhält (vorfährt, tankt). Dieses Verhalten beinhaltet die stillschweigende (juristisch: konkludente) Erklärung, dass er zahlungsfähig und zahlungswillig ist.
- Irrtum: Ein Tankstellenmitarbeiter (Kassierer, Aufsicht) bemerkt den Tankvorgang und glaubt aufgrund des normalen Verhaltens des Täters fälschlicherweise, dieser werde gleich bezahlen.
- Vermögensverfügung: Aufgrund dieses Irrtums gestattet der Mitarbeiter (wiederum oft stillschweigend) den Tankvorgang bzw. die Wegnahme des Benzins. Er duldet, dass der Kraftstoff in den Tank fließt, weil er von der späteren Bezahlung ausgeht. Ohne diesen Irrtum würde er einschreiten oder den Vorgang unterbinden.
- Vermögensschaden: Der Wert des getankten Kraftstoffs geht der Tankstelle verloren.
- Vorsatz und Bereicherungsabsicht: Der Täter handelte absichtlich und wollte sich das Benzin ohne Bezahlung verschaffen.
Der Knackpunkt, an dem die Argumentation oft hakt und an dem auch der BGH im Fall von Herrn S. ansetzte, ist der Irrtum des Mitarbeiters.
Die entscheidende Frage des BGH: Hat überhaupt jemand etwas bemerkt?
Der Bundesgerichtshof stellte in seiner Entscheidung klar: Die Feststellungen des Landgerichts Magdeburg reichten nicht aus, um Herrn S. wegen vollendeten Betrugs zu verurteilen. Das Landgericht hatte zwar beschrieben, dass Herr S. sich wie ein normaler Kunde verhielt und von Anfang an nicht zahlen wollte. Es hatte aber nicht explizit festgestellt, dass das Tankstellenpersonal den jeweiligen Tankvorgang überhaupt bemerkt hatte.
Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Der BGH bekräftigte seine ständige Rechtsprechung: Ein vollendeter Tankbetrug setzt voraus, dass die Täuschungshandlung (das Auftreten als zahlungswilliger Kunde) bei einem Mitarbeiter einen konkreten Irrtum hervorruft. Dieser Irrtum muss dann ursächlich dafür sein, dass der Mitarbeiter die Vermögensverfügung – also das (stillschweigende) Einverständnis mit dem Tanken – vornimmt.
Die Logik dahinter ist stringent: Wenn kein Mitarbeiter den Tankvorgang bemerkt hat, kann er auch nicht über die Zahlungsabsichten des Kunden bezüglich dieses spezifischen Vorgangs irren. Ein Irrtum setzt Wahrnehmung voraus. Man kann sich nicht über etwas irren, von dem man gar nichts weiß. Fehlt aber der Irrtum beim Personal bezüglich des konkreten Tankens, dann fehlt auch die darauf basierende Vermögensverfügung. Die Kausalkette des vollendeten Betrugs ist an dieser Stelle unterbrochen.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein großes Restaurant mit Selbstbedienungstheke, nehmen sich unbemerkt ein Gericht und essen es an einem Tisch in einer Ecke. Auch wenn Sie von Anfang an nicht zahlen wollten, haben Sie niemanden aktiv über Ihre Absicht getäuscht, der daraufhin eine Vermögensverfügung getroffen hätte (wie etwa ein Kellner, der Ihnen das Essen serviert, weil er glaubt, Sie zahlen später). Beim Tankbetrug ist es ähnlich: Das bloße technische Funktionieren der Zapfsäule ist noch keine irrtumsbedingte Vermögensverfügung eines Menschen.
Die Konsequenz: Nur versuchter Betrug ohne bemerkten Vorgang
Was bedeutet das nun rechtlich, wenn die Wahrnehmung durch das Personal nicht nachgewiesen werden kann? Der BGH war hier eindeutig: „Fehlt – wie hier – eine entsprechende Feststellung [dass der Tankvorgang bemerkt wurde], ist mangels Irrtumserregung nur ein versuchter Betrug gegeben.“
Ein versuchter Betrug liegt nach §§ 22, 23 StGB vor, wenn der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestands unmittelbar ansetzt. Beim Tankbetrug beginnt der Versuch spätestens mit dem Einführen des Zapfhahns in den Tankstutzen in der Absicht, nicht zu bezahlen. Der Täter hat den festen Vorsatz, alle Merkmale des Betrugs zu verwirklichen, aber es scheitert an einem objektiven Tatbestandsmerkmal – hier eben daran, dass der erforderliche Irrtum bei einem Mitarbeiter nicht hervorgerufen wird, weil dieser den Vorgang gar nicht mitbekommt.
Der BGH stützt sich dabei auf eine gefestigte Rechtsprechungslinie und verweist auf mehrere frühere Entscheidungen, die genau diese Abgrenzung bestätigen (z.B. BGH NJW 1983, 2827; Beschlüsse vom 13.01.2016 – 4 StR 532/15, vom 21.08.2019 – 3 StR 221/18 und vom 09.03.2021 – 6 StR 74/21). Die aktuelle Entscheidung ist also keine komplette Neuheit, sondern eine Bekräftigung und Mahnung zur sorgfältigen Prüfung der Fakten durch die Gerichte.
Experten-Einblick: Der feine, aber entscheidende Unterschied
Die BGH-Entscheidung macht deutlich: Für den vollendeten Tankbetrug reicht es nicht, dass der Täter trickreich handelt und die Tankstelle einen Schaden erleidet. Es muss nachweisbar sein, dass ein Mensch – der Tankstellenmitarbeiter – den konkreten Vorgang wahrgenommen hat und aufgrund einer Täuschung (dem scheinbar normalen Kundenverhalten) eine Fehlvorstellung entwickelte („Der zahlt gleich“), die ihn dazu brachte, das Abzapfen des Benzins zu dulden. Fehlt dieser Nachweis der Wahrnehmung und des daraus resultierenden Irrtums, bleibt es beim Versuch. Dieser Unterschied ist juristisch relevant, insbesondere für das Strafmaß.
Warum eigentlich kein Diebstahl? Die Sache mit dem Einverständnis
Man könnte sich fragen: Wenn niemand etwas bemerkt, warum ist das Wegfahren mit dem Benzin dann nicht einfach Diebstahl nach § 242 StGB? Diebstahl ist die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache in der Absicht, sie sich rechtswidrig zuzueignen. Das klingt doch passend?
Juristisch wird Diebstahl beim Tanken an einer Selbstbedienungstankstelle jedoch meist verneint. Der Grund liegt im sogenannten tatbestandsausschließenden Einverständnis. Gerichte gehen davon aus, dass der Tankstellenbetreiber generell damit einverstanden ist, dass Kunden den Kraftstoff aus der Zapfsäule entnehmen und in ihren Tank füllen.
Dieses Einverständnis wird zwar unter der Bedingung erteilt, dass anschließend bezahlt wird. Aber das Einverständnis in die Wegnahme selbst liegt im Moment des Tankens vor. Fehlt es an einer Wegnahme gegen oder ohne den Willen des Gewahrsamsinhabers, scheidet Diebstahl aus. Die Strafbarkeit verschiebt sich daher in Richtung Betrug, weil der Täter das generelle Einverständnis durch Vortäuschung der Zahlungsbereitschaft erschleicht.
Die praktischen Folgen der BGH-Entscheidung
Die Klarstellung des BGH hat handfeste Konsequenzen für alle Beteiligten:
Für Staatsanwaltschaften:
Wollen sie eine Verurteilung wegen vollendeten Tankbetrugs erreichen, müssen sie aktiv Beweise dafür vorlegen, dass ein Mitarbeiter den Vorgang wahrgenommen hat. Das kann durch Zeugenaussagen des Personals geschehen oder unter Umständen durch Videoaufzeichnungen, die zeigen, dass ein Mitarbeiter den Vorgang beobachtet oder darauf reagiert hat.
Können solche Beweise nicht erbracht werden, ist eine Anklage wegen versuchten Betrugs der juristisch sicherere Weg, um der BGH-Rechtsprechung gerecht zu werden. Die Beweislast für die Wahrnehmung liegt bei der Anklagebehörde.
Für Verteidiger
Sie erhalten ein starkes Argument, um Verurteilungen wegen vollendeten Betrugs anzugreifen, wenn das Urteil des Tatgerichts (Amtsgericht oder Landgericht) keine konkreten Feststellungen zur Wahrnehmung und zum Irrtum des Personals enthält. Pauschale Formulierungen wie „der Täter trat wie ein normaler Kunde auf“ reichen nach der BGH-Entscheidung allein nicht aus, um den vollendeten Betrug zu begründen. Die Verteidigung kann gezielt auf das Fehlen dieser Feststellungen hinweisen und auf eine Verurteilung (allenfalls) wegen Versuchs drängen.
Für die Gerichte (Amts- und Landgerichte):
Die Tatrichter müssen in ihren Urteilsgründen präzise und nachvollziehbar darlegen, ob und wie das Tankstellenpersonal den Vorgang wahrgenommen hat und ob daraus ein relevanter Irrtum entstanden ist, wenn sie wegen vollendeten Betrugs verurteilen wollen. Fehlen diese Feststellungen, ist das Urteil in diesem Punkt angreifbar und wird einer Überprüfung durch den BGH wahrscheinlich nicht standhalten, wie der Fall von Herrn S. zeigt. Die Entscheidung dient als Mahnung zur Sorgfalt bei der Beweisaufnahme und Urteilsabfassung.
Für Tankstellenbetreiber:
Die Entscheidung unterstreicht indirekt die Herausforderung, Betrug in einer Umgebung nachzuweisen, die auf Selbstbedienung und wenig Personalinteraktion ausgelegt ist. Es könnte ein Anreiz sein, über technische Lösungen nachzudenken, die entweder die Tat erschweren (z.B. Bezahlsysteme direkt an der Säule) oder die Beweisführung erleichtern (z.B. verbesserte Videoüberwachung, die auch die Aufmerksamkeit des Personals dokumentieren könnte). Rein rechtlich ändert die Entscheidung aber nichts daran, dass der Betrug strafbar ist – die Hürde liegt im Nachweis der Vollendung.
Was ist mit der Unterschlagung? Ein juristischer Nebenschauplatz
Im Zusammenhang mit Tankbetrug wird manchmal auch diskutiert, ob nicht zusätzlich eine Unterschlagung nach § 246 StGB vorliegt. Unterschlagung begeht, wer sich eine fremde bewegliche Sache rechtswidrig zueignet. Der Täter hat das Benzin ja im Tank, also in seinem Besitz, und will es behalten, ohne zu zahlen. Lesen Sie auch unseren Artikel zum Unterschied zwischen Diebstahl und Unterschlagung.
Hier gehen die Meinungen unter Juristen auseinander:
- Die herrschende Meinung geht davon aus, dass eine mögliche Unterschlagung hinter dem (zumindest versuchten) Betrug zurücktritt und von diesem verdrängt wird. Das Gesetz sagt in § 246 Abs. 1 StGB selbst, dass Unterschlagung nur bestraft wird, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist (Subsidiaritätsklausel). Da Betrug (auch im Versuch) in der Regel schwerer wiegt, würde die Unterschlagung nicht gesondert bestraft.
- Eine Mindermeinung argumentiert, dass eine Verurteilung wegen tateinheitlicher Unterschlagung (also Unterschlagung und versuchter Betrug) notwendig sei, um klarzustellen, dass die Tat des Täters erfolgreich war (er hat das Benzin doch bekommen) und nicht nur ein gescheiterter Versuch.
Für die praktische Einordnung des BGH-Beschlusses spielt diese Debatte jedoch eine untergeordnete Rolle. Der BGH konzentrierte sich auf die Abgrenzung zwischen vollendetem und versuchtem Betrug.
Der schmale Grat zwischen Versuch und Vollendung: Auswirkungen auf die Strafe
Warum ist diese Unterscheidung zwischen Versuch und Vollendung überhaupt so wichtig? Der entscheidende Punkt ist die Strafandrohung. Das Gesetz sieht in § 23 Abs. 2 StGB vor, dass der Versuch eines Vergehens (wie Betrug) milder bestraft werden kann als die vollendete Tat. Nach § 49 Abs. 1 StGB ist der Strafrahmen für den Versuch nach unten verschoben.
Im Fall von Herrn S. hat der BGH den Schuldspruch in den vier Tank-Fällen von vollendetem auf versuchten Betrug geändert. Dies kann sich auf die Gesamtstrafe ausgewirkt haben, auch wenn die Quellen keine Details zur endgültigen Strafhöhe nennen. Eine Verurteilung „nur“ wegen Versuchs ist für den Angeklagten in der Regel günstiger.
Die Entscheidung des BGH zeigt damit auch die Korrekturfunktion des Revisionsverfahrens. Der BGH prüft nicht nur, ob das Recht richtig ausgelegt wurde, sondern auch, ob die vom Tatgericht festgestellten Tatsachen die rechtliche Schlussfolgerung (hier: vollendeter Betrug) überhaupt tragen. Wenn – wie im Fall von Herrn S. – die Faktenlage klar ist und nur die rechtliche Bewertung falsch war, kann der BGH das Urteil selbst ändern (§ 354 Abs. 1 StPO), ohne den Fall zur erneuten Verhandlung zurückverweisen zu müssen.
Häufig gestellte Fragen zum Tankbetrug nach der BGH-Entscheidung
Die Entscheidung des BGH wirft für Laien verständlicherweise einige Fragen auf. Hier einige Antworten auf die häufigsten Unklarheiten:
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ist Tankbetrug jetzt immer nur noch versuchter Betrug?
Was ist, wenn die Tankstelle komplett videoüberwacht ist? Zählt das als „bemerkt werden“?
Was passiert, wenn ich beim Tanken versehentlich vergesse zu bezahlen und wegfahre?
Spielt es eine Rolle, ob die Tankstelle sehr voll oder fast leer war?
Was sollte ich tun, wenn mir Tankbetrug vorgeworfen wird?
Ändert diese BGH-Entscheidung etwas an älteren Urteilen wegen Tankbetrugs?
Warum macht das Gesetz überhaupt so einen komplizierten Unterschied zwischen Versuch und Vollendung?
Fazit: Klare Linie in einem komplexen Feld
Der Beschluss des Bundesgerichtshofs zum Aktenzeichen 6 StR 676/24 mag auf den ersten Blick wie eine juristische Spitzfindigkeit wirken. Doch er hat erhebliche praktische Bedeutung. Er schärft den Blick dafür, dass der Betrugstatbestand auch im Zeitalter der Selbstbedienung und zunehmenden Automatisierung immer noch an die Täuschung eines Menschen und dessen subjektive Fehlvorstellung geknüpft ist. Das bloße Wegfahren ohne zu bezahlen reicht für den vollendeten Betrug nicht aus, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass das Tankstellenpersonal den Vorgang überhaupt bemerkt hat.
Die Entscheidung ist eine wichtige Erinnerung an die Notwendigkeit sorgfältiger Tatsachenfeststellungen durch die Gerichte und gibt klare Leitlinien für die Strafverfolgung und Verteidigung in Fällen von Tankbetrug. Sie zeigt, dass auch scheinbar alltägliche Delikte juristisch vielschichtig sein können und eine genaue Prüfung des Einzelfalls erfordern. Für Betroffene unterstreicht sie einmal mehr, wie wichtig es ist, bei strafrechtlichen Vorwürfen frühzeitig juristischen Rat einzuholen. Denn zwischen Versuch und Vollendung kann ein erheblicher Unterschied liegen – nicht nur rechtlich, sondern auch bei den Konsequenzen.