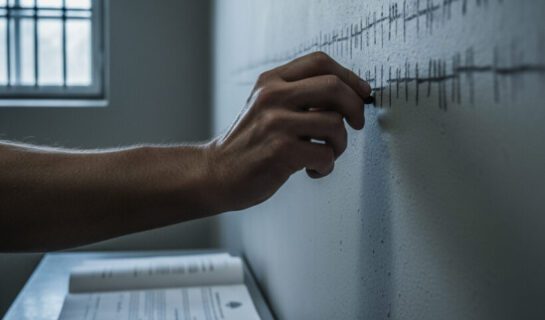Ein einschlägig vorbestrafter Mann beging erneut Betrug mit einem Schaden von nur 130,47 Euro, während er unter Bewährung stand. Die vollständige Rückzahlung dieses geringen Betrages sollte ihn vor Strafe schützen, doch das Oberlandesgericht sah das anders.
Übersicht
- Das Urteil in 30 Sekunden
- Die Fakten im Blick
- Der Fall vor Gericht
- Kann die vollständige Rückzahlung einer kleinen Schuld vor einer Strafe wegen Betrugs schützen?
- Was genau war passiert und wie kam es zur Anklage wegen Betrugs?
- Wie entschieden die ersten beiden Gerichte über den Betrug?
- Warum legte die Staatsanwaltschaft Revision gegen das Urteil ein?
- Unter welchen strengen Voraussetzungen darf ein Gericht von einer Strafe absehen?
- Welchen entscheidenden Verfahrensfehler machte das Landgericht bei der Urteilsfindung?
- Wie entschied das Oberlandesgericht Bamberg und was sind die Folgen?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wie wirkt sich Schadenswiedergutmachung auf meine Strafe aus?
- Kann ich meine Strafe durch Wiedergutmachung bei Betrug ganz abwenden?
- Muss meine Wiedergutmachung nach § 46a StGB erheblich sein?
- Wie prüft das Gericht meine Schadenswiedergutmachung im Strafverfahren?
- Kann ich meine Strafe durch Wiedergutmachung bei Betrug ganz abwenden?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 2 Ss 101/12 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Urteil in 30 Sekunden
- Das Problem: Ein Mann, bereits wegen Betrugs vorbestraft und auf Bewährung, beging erneut einen kleinen Betrug. Ein Gericht verzichtete auf eine Strafe, da er den Schaden beglichen hatte.
- Die Rechtsfrage: Schützt die späte Rückzahlung eines geringen Betrags vor einer Strafe wegen Betrugs?
- Die Antwort: Nein. Die bloße Rückzahlung eines geringen Geldbetrags, besonders unter Ermittlungsdruck, schützt nicht vor Strafe. Ein Straferlass erfordert eine besondere persönliche Leistung oder echten Ausgleich.
- Die Bedeutung: Gerichte sehen von einer Strafe nur unter sehr strengen Bedingungen ab. Die bloße Rückzahlung eines geringen Schadens reicht für einen Straferlass bei Betrug nicht aus.
Die Fakten im Blick
- Gericht: Oberlandesgericht Bamberg
- Datum: 04.12.2012
- Aktenzeichen: 2 Ss 101/12
- Verfahren: Revisionsverfahren in Strafsache
- Rechtsbereiche: Strafrecht, Strafprozessrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Die Staatsanwaltschaft. Sie legte Revision gegen ein Urteil ein, das von Strafe abgesehen hatte.
- Beklagte: Der Angeklagte. Er verteidigte die Entscheidung des Landgerichts, die von einer Bestrafung abgesehen hatte.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Ein Angeklagter hatte sich des Betruges schuldig gemacht. Das Landgericht hatte von einer Bestrafung abgesehen, weil der Schaden wiedergutgemacht wurde.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: War es zulässig, den Betrüger trotz seiner Tat nicht zu bestrafen, weil er den Schaden wiedergutgemacht hatte?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Das Urteil des Landgerichts wurde im Teil der Strafentscheidung aufgehoben.
- Zentrale Begründung: Die Voraussetzungen für ein Absehen von Strafe wegen Schadenswiedergutmachung waren nicht ausreichend dargelegt, und das Landgericht hat die notwendige mehrstufige Strafprüfung nicht durchgeführt.
- Konsequenzen für die Parteien: Der Fall muss von einer anderen Strafkammer des Landgerichts neu verhandelt und entschieden werden.
Der Fall vor Gericht
Kann die vollständige Rückzahlung einer kleinen Schuld vor einer Strafe wegen Betrugs schützen?
Ein Mann, einschlägig wegen Betrugs vorbestraft und unter laufender Bewährung stehend, begeht eine weitere Tat. Der Schaden ist gering, nur 130,47 Euro. Das Amtsgericht verurteilt ihn konsequent zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe. Doch in der Berufungsverhandlung geschieht etwas Unerwartetes: Das Landgericht bestätigt zwar den Schuldspruch, sieht aber von einer Strafe vollständig ab. Der Grund: Der Mann hatte den Schaden inzwischen beglichen.

Dieser richterliche Gnadenakt rief die Staatsanwaltschaft auf den Plan, die den Fall bis vor das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg trug. Es entbrannte ein juristischer Streit über eine zentrale Frage: Ist die bloße Wiedergutmachung eines kleinen Schadens ein Freifahrtschein aus der Strafbarkeit?
Was genau war passiert und wie kam es zur Anklage wegen Betrugs?
Der Sachverhalt, der die Justiz beschäftigte, war alltäglich. Ein Mann hatte die Firma P. um einen Betrag von 130,47 Euro betrogen. Problematisch für ihn war seine Vergangenheit: Mehrere Vorstrafen wegen Betrugsdelikten füllten sein Register, und die neue Tat beging er, während er unter Bewährung stand. Nach der Tat passierte zunächst wenig. Der Angeklagte behauptete später vor Gericht, er habe unverzüglich nach einem Schreiben der Firma versucht, eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Dieses Bemühen sei jedoch gescheitert, weil eine frühere Lebensgefährtin die an ihn adressierte Post nicht weitergeleitet habe.
Die Wende kam erst, als die Polizei Ermittlungen aufnahm und ihn als Beschuldigten vorlud. Plötzlich ging alles ganz schnell. Der Mann setzte sich mit der Polizei und der geschädigten Firma in Verbindung. Am 19. November 2011, lange nach der Tat, glich er den Schaden vollständig aus. Die Firma P. erklärte daraufhin, kein weiteres Interesse an einer Strafverfolgung zu haben. Für die Staatsanwaltschaft war der Fall damit aber keineswegs erledigt. Sie erhob Anklage wegen Betrugs, begangen während einer laufenden Bewährung.
Wie entschieden die ersten beiden Gerichte über den Betrug?
Die juristische Bewertung des Falles fiel in den ersten beiden Instanzen dramatisch unterschiedlich aus. Das Amtsgericht sah die Sache klar: Angesichts der Vorstrafen und des Bewährungsbruchs verurteilte es den Angeklagten am 16. April 2012 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von vier Monaten.
Der Angeklagte legte gegen dieses harte Urteil Berufung ein. Das Landgericht rollte den Fall am 23. Juli 2012 neu auf und kam zu einem völlig anderen Ergebnis. Zwar bestätigten die Richter den Schuldspruch wegen Betrugs, doch beim Strafmaß wählten sie einen Sonderweg. Gestützt auf § 46a des Strafgesetzbuches (StGB) sahen sie von einer Strafe vollständig ab. Das Gericht begründete diesen Schritt mit den Bemühungen des Angeklagten um Schadenswiedergutmachung. Es wertete seine – unwidersprochen gebliebene – Behauptung, er habe eine Ratenzahlung versucht, und die letztendliche vollständige Zahlung als ausreichenden Grund für diese milde Entscheidung. Die Tatsache, dass das Opfer kein Strafverfolgungsinteresse mehr hatte, bestärkte das Gericht in seiner Auffassung. Ein Schuldspruch ohne Strafe – für den Angeklagten ein Sieg auf ganzer Linie.
Warum legte die Staatsanwaltschaft Revision gegen das Urteil ein?
Die Staatsanwaltschaft akzeptierte diese Entscheidung nicht. Sie legte Revision beim Oberlandesgericht Bamberg ein und beschränkte ihren Angriff gezielt auf den Rechtsfolgenausspruch, also die Entscheidung, von einer Strafe abzusehen. Der Schuldspruch selbst wurde nicht angefochten. Im Kern argumentierte die Anklagebehörde, das Landgericht habe die Voraussetzungen des § 46a StGB falsch ausgelegt und damit das Recht fehlerhaft angewendet.
Ihrer Ansicht nach reicht die späte Zahlung eines geringen Betrags, die erst unter dem Druck polizeilicher Ermittlungen erfolgt, bei Weitem nicht aus, um einem mehrfachen, unter Bewährung stehenden Straftäter die Strafe komplett zu erlassen. Die Staatsanwaltschaft sah in der Entscheidung des Landgerichts eine unzulässige Aufweichung anerkannter Strafzwecke und forderte die Aufhebung des Urteils im Strafmaß.
Unter welchen strengen Voraussetzungen darf ein Gericht von einer Strafe absehen?
Das OLG Bamberg gab der Revision der Staatsanwaltschaft statt und hob den Rechtsfolgenausspruch des Landgerichts auf. Die Richter in Bamberg unterzogen die Entscheidung einer präzisen rechtlichen Prüfung und legten die hohen Hürden des § 46a StGB dar. Diese Vorschrift ist kein Automatismus, sondern eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift für besondere Fälle. Sie kennt zwei Alternativen.
Für die erste Alternative, den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich (§ 46a Nr. 1 StGB), genügt eine reine Geldzahlung nicht. Das Gesetz verlangt einen echten kommunikativen Prozess zwischen Täter und Opfer, der auf einen umfassenden Ausgleich der Tatfolgen abzielt. Das Verhalten des Täters muss Ausdruck aufrichtiger Verantwortungsübernahme sein. Davon konnte hier keine Rede sein. Die vage Behauptung des Angeklagten, seine Ex-Freundin habe Post unterschlagen, überzeugte das OLG nicht. Es stellte sich die naheliegende Frage: Warum hatte der Angeklagte nicht selbst erneut den Kontakt zur Firma gesucht? Sein Zögern und die Zahlung erst nach Einschaltung der Polizei sprachen gegen eine ernsthafte und freiwillige Bemühung um Ausgleich.
Auch die zweite Alternative, die Schadenswiedergutmachung (§ 46a Nr. 2 StGB), griff nicht. Diese setzt voraus, dass der Täter das Opfer nicht nur entschädigt, sondern dass diese Wiedergutmachung für ihn eine erhebliche persönliche Leistung oder einen erheblichen persönlichen Verzicht darstellt. Die Rückzahlung von 130,47 Euro erfüllt diese Anforderung nicht. Das OLG betonte, dass der Paragraph kein „Freikauf-Instrument“ für reuige Täter ist. Es muss ein spürbares Opfer erkennbar sein, das die Übernahme von Verantwortung untermauert. Das Landgericht hatte keinerlei Feststellungen getroffen, die auf einen solchen erheblichen Verzicht des Angeklagten hindeuteten. Die bloße Zahlung der Schuld war zu wenig.
Welchen entscheidenden Verfahrensfehler machte das Landgericht bei der Urteilsfindung?
Über die inhaltlichen Mängel hinaus deckte das OLG einen gravierenden formellen Fehler in der Urteilsbegründung des Landgerichts auf. Selbst wenn die Voraussetzungen des § 46a StGB vorgelegen hätten, hätte das Gericht nicht einfach auf eine Strafe verzichten dürfen. Die korrekte Vorgehensweise ist ein klar strukturierter, mehrstufiger Prozess.
- Prüfung der Strafrahmenmilderung: Zunächst hätte das Landgericht prüfen müssen, ob durch die Wiedergutmachung eine Strafrahmenmilderung nach § 49 Abs. 1 StGB in Betracht kommt.
- Bildung einer fiktiven Strafe: Anschließend hätte es innerhalb dieses gemilderten Rahmens eine konkrete, aber fiktive Strafe für den Täter festlegen müssen. Dabei wären alle strafschärfenden (Vorstrafen, Bewährungsbruch) und strafmildernden (Geständnis, Wiedergutmachung) Aspekte abzuwägen gewesen.
- Prüfung der Schwelle: Erst wenn diese fiktive Strafe eine Freiheitsstrafe von einem Jahr nicht übersteigt, darf das Gericht im letzten Schritt überhaupt erwägen, ganz von einer Strafe abzusehen.
Das Landgericht hatte diese gesamte, zwingend vorgeschriebene Abwägung unterlassen. Es war direkt von der Tat zur Straflosigkeit gesprungen. Diese Vorgehensweise machte die Entscheidung lückenhaft und damit rechtlich unhaltbar.
Wie entschied das Oberlandesgericht Bamberg und was sind die Folgen?
Das Oberlandesgericht Bamberg erklärte den Rechtsfolgenausspruch des Landgerichts für rechtsfehlerhaft und hob ihn auf. Die Richter machten unmissverständlich klar, dass die bloße Rückzahlung eines geringen Geldbetrages unter dem Druck von Ermittlungen nicht die strengen Anforderungen des § 46a StGB erfüllt. Eine solche Handhabung würde den Sinn und Zweck der Norm untergraben und könnte gerade bei Serientätern falsche Anreize setzen.
Der Fall wurde zur neuen Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen. Der Schuldspruch wegen Betrugs bleibt bestehen. Das neue Gericht muss nun über die richtige Strafe entscheiden – unter Berücksichtigung der klaren Vorgaben des Oberlandesgerichts. Die Chance des Angeklagten, trotz seiner Vorstrafen und des Bewährungsbruchs straffrei auszugehen, war damit vertan.
Die Urteilslogik
Ein Gericht gewährt Straferlass nur unter strengsten Bedingungen, auch wenn ein Täter den Schaden wiedergutmacht.
- Hürden für Straferlass: Eine reine Geldzahlung oder die Begleichung eines geringen Schadens allein genügt nicht für einen Straferlass; der Täter muss aufrichtige Verantwortung zeigen oder ein erhebliches persönliches Opfer bringen.
- Qualität der Wiedergutmachung: Die Wiedergutmachung entfaltet ihre strafbefreiende Wirkung nur, wenn sie ernsthaft und freiwillig erfolgt und nicht erst unter dem Druck polizeilicher Ermittlungen zustande kommt.
- Stufen der Strafzumessung: Gerichte müssen eine zwingend vorgeschriebene Abwägung vollziehen, indem sie zuerst eine fiktive Strafe festlegen, bevor sie überhaupt erwägen, von einer Bestrafung ganz abzusehen.
Diese Entscheidung unterstreicht, dass die Strafzwecke Vorrang haben und ein vollständiger Straferlass eine absolute Ausnahme bleibt, die strenge Voraussetzungen erfüllt.
Benötigen Sie Hilfe?
Haben Sie Fragen zur Strafbarkeit bei Betrug mit Schadenswiedergutmachung? Erhalten Sie eine unverbindliche Ersteinschätzung Ihres Falls.
Das Urteil in der Praxis
Wer dachte, eine späte Rückzahlung rette kleine Betrüger vor der Strafe, wird von diesem Urteil des OLG Bamberg harsch eines Besseren belehrt. Es zieht eine glasklare Grenze: § 46a StGB ist kein Freifahrtschein für eilige Wiedergutmachung unter Druck, sondern eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift. Gerade bei einschlägigen Vorstrafen und zögerlicher Zahlung muss die Justiz konsequent bleiben, um das Vertrauen in die Strafverfolgung nicht zu untergraben. Für die Praxis ist das Urteil ein unmissverständliches Signal: Reue zählt nur, wenn sie echt und frühzeitig ist – späte Pflichterfüllung nach dem Motto „erwischt, bezahlt“ führt nicht zur Straffreiheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie wirkt sich Schadenswiedergutmachung auf meine Strafe aus?
Schadenswiedergutmachung kann Ihre Strafe tatsächlich mildern oder in seltenen Fällen sogar zu einem Absehen von Strafe führen. Gerichte prüfen dabei genau, ob Ihre Leistung Ausdruck echter Verantwortungsübernahme ist oder nur ein taktisches Manöver. Eine bloße Zahlung, vor allem spät und unter Druck, reicht selten aus, um eine Strafverfolgung komplett abzuwenden, selbst bei geringem Schaden.
Juristen nennen das § 46a StGB, eine Ausnahmevorschrift, die hohe Hürden setzt. Hier geht es nicht nur ums Geld. Das Gesetz fordert einen echten Täter-Opfer-Ausgleich mit kommunikativem Prozess oder eine Wiedergutmachung, die für Sie eine erhebliche persönliche Leistung bedeutet. Ein bloßer „Freikauf“ ist ausgeschlossen.
Stellen Sie sich vor, ein Mann mit Vorstrafen betrügt für 130,47 Euro. Er zahlt erst, als die Polizei ermittelt. Das Amtsgericht verhängt vier Monate Freiheitsstrafe. Das Landgericht will ihn laufen lassen, weil er zahlte. Doch das Oberlandesgericht Bamberg stoppt dies. Der Grund: Die späte, unter Druck erfolgte Zahlung des geringen Betrags war keine erhebliche Leistung. Sie untergräbt sonst den Strafzweck.
Verstehen Sie: Nur eine rechtzeitige, ernsthafte und spürbare Anstrengung zur Schadenswiedergutmachung bei Betrug überzeugt Richter wirklich.
Kann ich meine Strafe durch Wiedergutmachung bei Betrug ganz abwenden?
Nein, bei Betrug reicht die bloße Rückzahlung des Schadens in der Regel nicht, um eine Strafe vollständig abzuwenden. Das Oberlandesgericht Bamberg hat klargestellt, dass § 46a StGB hohe Hürden setzt: Es braucht eine erhebliche persönliche Leistung oder einen echten Täter-Opfer-Ausgleich, nicht nur eine späte Geldzahlung.
Juristen nennen das eine „erhebliche persönliche Leistung“ oder einen „Täter-Opfer-Ausgleich“ – und der ist kein bloßer Geldtransfer. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, eine schwierige Prüfung nur durch Anwesenheit zu bestehen. Das reicht nicht; Sie müssen die gestellten Aufgaben, die strengen Voraussetzungen des § 46a StGB, erfüllen. Ein ehrlicher Täter-Opfer-Ausgleich erfordert einen kommunikativen Prozess, echte Verantwortungsübernahme. Wer nur zahlt, weil die Polizei vor der Tür steht, erfüllt das nicht.
Der Fall eines mehrfach vorbestraften Betrügers macht dies deutlich. Er prellte eine Firma um 130,47 Euro. Zwar glich er den Betrag schließlich aus, doch erst nach polizeilichen Ermittlungen. Das Landgericht sah von einer Strafe ab. Das OLG Bamberg kassierte diese Entscheidung. Der Grund: Eine geringe Summe, spät und ohne erkennbares persönliches Opfer beglichen, erfüllt die hohen Anforderungen des Gesetzes nicht. Das ist kein Freifahrtschein.
Prüfen Sie, ob Ihre Wiedergutmachung über die bloße Zahlung hinausgeht und wahre Verantwortungsübernahme zeigt.
Muss meine Wiedergutmachung nach § 46a StGB erheblich sein?
Ja, für das Absehen von Strafe nach § 46a StGB muss Ihre Wiedergutmachung eine spürbar erhebliche persönliche Leistung oder ein erheblicher persönlicher Verzicht für Sie darstellen. Das OLG Bamberg machte kürzlich deutlich: Die bloße Rückzahlung eines geringen Betrags – etwa 130,47 Euro – reicht hierfür nicht aus, besonders wenn sie erst unter Ermittlungsdruck erfolgt. Es geht nicht nur um die Summe, sondern um das dahinterstehende Opfer.
Warum ist das so? Das Gesetz macht klare Vorgaben: § 46a StGB ist kein „Freikauf-Instrument“. Die Regel lautet, dass die Wiedergutmachung Ausdruck echter Verantwortungsübernahme sein muss. Eine kleine Summe, die mühelos gezahlt wird, erfüllt dies selten. Gerichte suchen nach einem spürbaren Opfer, einer finanziellen Anstrengung, die über die bloße Erfüllung einer Schuld hinausgeht.
Stellen Sie sich vor, ein Täter schuldet 130,47 Euro und begleicht dies erst, als die Polizei bereits ermittelt. Genau das war der Fall vor dem OLG Bamberg. Der Mann hatte mehrere Vorstrafen wegen Betrugs. Trotz später Rückzahlung des geringen Schadens lehnte das Gericht ein Absehen von Strafe ab. Der Grund: Es fehlte an jeder Feststellung zu einem „erheblichen Verzicht“. Ohne dieses spürbare Opfer gab es keinen „Gnadenakt“.
Bewerten Sie also ehrlich, ob Ihre Leistung wirklich wehgetan hat – das wird vor Gericht zählen.
Wie prüft das Gericht meine Schadenswiedergutmachung im Strafverfahren?
Eine direkte Prüfung Ihrer Schadenswiedergutmachung ist ein Trugschluss; Gerichte folgen einem strengen, dreistufigen Prüfprozess, um überhaupt über ein Absehen von Strafe zu entscheiden. Zuerst prüfen sie eine mögliche Strafrahmenmilderung, dann bilden sie eine fiktive Strafe und erst am Ende erwägen sie, ob Sie ganz ohne Strafe davonkommen können – aber nur, wenn diese fiktive Strafe eine Freiheitsstrafe von einem Jahr nicht übersteigt.
Warum diese Strenge? Gerichte wollen Willkür vermeiden. Stellen Sie sich einen mehrstufigen Filter vor: Zuerst wird geprüft, ob die Tat überhaupt „mildbar“ ist, etwa durch Ihre Wiedergutmachungsbemühungen. Dann bestimmen Richter den „Grundwert“ der Strafe, indem sie alle relevanten Aspekte berücksichtigen, von Vorstrafen bis zu mildernden Umständen. Nur wenn dieser „Grundwert“ niedrig genug ist, kann der „Filter“ des Absehens von Strafe angewendet werden.
Ein Landgericht tat genau das nicht. Es erließ einem mehrfach vorbestraften Betrüger die Strafe vollständig, weil dieser einen geringen Schaden von 130 Euro beglichen hatte – und das erst nach Polizeikontakt. Das Oberlandesgericht Bamberg machte klare Vorgaben: Diese Abwägung war lückenhaft und damit rechtlich unhaltbar. Wer Schritte überspringt, handelt fehlerhaft.
Achten Sie darauf, dass Ihr Verteidiger diese präzise Abfolge beim Gericht einfordert.
Kann ich meine Strafe durch Wiedergutmachung bei Betrug ganz abwenden?
Nein, eine reine Rückzahlung des Betrugsschadens reicht meist nicht aus, um die Strafe durch Wiedergutmachung gänzlich abzuwenden. Gerichte verlangen nach § 46a StGB eine echte, persönliche Leistung oder einen tiefgreifenden Täter-Opfer-Ausgleich. Späte Zahlungen unter Ermittlungsdruck oder geringe Beträge sind oft unzureichend.
Juristen nennen das Absehen von Strafe eine Ausnahme, keinen Freifahrtschein. Das Gesetz macht klare Vorgaben: Geht es um einen Täter-Opfer-Ausgleich, fordert der Gesetzgeber einen echten Dialog, nicht bloß eine Überweisung. Der Täter muss Verantwortung übernehmen, kommunizieren. Zahlung erst nach Polizeidruck? Das ist kein freiwilliger Ausgleich.
Der Fall eines mehrfach vorbestraften Betrügers aus Bamberg illustriert das perfekt. Er zahlte 130 Euro Schaden zurück. Das Landgericht sah ihn straffrei, ein „Gnadenakt“. Das Oberlandesgericht Bamberg kassierte diese Entscheidung jedoch. Der Grund: 130 Euro sind keine „erhebliche persönliche Leistung“, und eine späte Zahlung ohne ernsthaften Kommunikationsversuch erfüllt die strengen Voraussetzungen des § 46a StGB nicht. Eine bloße Geldzahlung, zumal eine geringe und unter Zwang geleistete, wird selten als ausreichend angesehen.
Prüfen Sie: Gehen Ihre Wiedergutmachungsbemühungen über die bloße Zahlung hinaus und zeigen Sie echte Verantwortungsübernahme?
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Bewährung
Bewährung bedeutet, dass ein Gericht die Vollstreckung einer bereits verhängten Freiheitsstrafe für eine bestimmte Zeit aussetzt, damit der Verurteilte sich in Freiheit bewähren kann. Das Gesetz gibt dem Straftäter eine zweite Chance, sich als gesetzestreuer Bürger zu erweisen, ohne sofort ins Gefängnis zu müssen. Damit soll die Resozialisierung gefördert und die Belastung durch einen Gefängnisaufenthalt vermieden werden.
Beispiel: Obwohl der Mann unter laufender Bewährung stand, beging er eine neue Betrugstat, was die Staatsanwaltschaft dazu veranlasste, eine Freiheitsstrafe zu fordern.
Fiktive Strafe
Eine fiktive Strafe ist ein gedanklicher Schritt im Strafverfahren, bei dem das Gericht eine konkrete, vorläufige Strafe festlegt, ohne sie tatsächlich zu verhängen. Richter bilden diese Strafe, um alle Umstände des Falls – mildernde wie erschwerende – fair abzuwägen und so die Grundlage für weitere Entscheidungen, wie ein mögliches Absehen von Strafe, zu schaffen. Das soll sicherstellen, dass trotz einer möglichen Straflosigkeit der eigentliche Unrechtsgehalt der Tat korrekt bewertet wird.
Beispiel: Das Landgericht hatte versäumt, eine fiktive Strafe für den Betrüger zu bilden, bevor es von einer Verurteilung absah, was vom Oberlandesgericht Bamberg als Verfahrensfehler gerügt wurde.
Rechtsfolgenausspruch
Der Rechtsfolgenausspruch beschreibt den Teil eines gerichtlichen Urteils, der sich mit der konkreten Strafe oder anderen rechtlichen Konsequenzen der Tat befasst, nachdem die Schuld festgestellt wurde. Dieser Urteilsabschnitt legt fest, welche Sanktionen der Täter für seine Tat zu erwarten hat und bildet das Kernstück der Strafzumessung. Er ist entscheidend, denn er bestimmt, ob und in welchem Umfang der Täter bestraft wird.
Beispiel: Die Staatsanwaltschaft legte gezielt Revision gegen den Rechtsfolgenausspruch des Landgerichts ein, da sie das Absehen von einer Freiheitsstrafe als fehlerhaft erachtete.
Schadenswiedergutmachung
Die Schadenswiedergutmachung im Sinne des Strafrechts meint die Bemühung eines Täters, den durch seine Straftat entstandenen Schaden vollständig auszugleichen und so seine Verantwortung für die Tat zu übernehmen. Das Gesetz honoriert damit echte Reue und den Willen des Täters, das begangene Unrecht rückgängig zu machen, um die Belastungen des Opfers zu mindern. Entscheidend ist dabei, dass diese Wiedergutmachung für den Täter eine erhebliche persönliche Leistung darstellt.
Beispiel: Eine reine Schadenswiedergutmachung des geringen Betrugsschadens von 130,47 Euro, die erst nach Beginn der Polizeiermittlungen erfolgte, reichte dem Oberlandesgericht Bamberg nicht aus, um die Strafe zu erlassen.
Strafrahmenmilderung
Eine Strafrahmenmilderung ermöglicht es dem Gericht, die für eine Straftat vorgesehene gesetzliche Mindest- und Höchststrafe herabzusetzen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Herabsetzung dient dazu, dem Richter einen größeren Spielraum für eine gerechtere Strafzumessung zu geben, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen, wie etwa eine ernsthafte Reue oder ein umfassendes Geständnis. Damit kann das Gericht auch bei schweren Delikten eine angemessenere, mildere Strafe finden.
Beispiel: Das Landgericht hätte zunächst eine Strafrahmenmilderung prüfen müssen, bevor es in dem Betrugsfall überhaupt über ein vollständiges Absehen von Strafe nachdachte.
§ 46a Strafgesetzbuch (StGB)
Juristen bezeichnen § 46a Strafgesetzbuch (StGB) als eine Ausnahmevorschrift, die einem Gericht unter sehr strengen Voraussetzungen erlaubt, eine Strafe zu mildern oder sogar vollständig von ihr abzusehen. Diese Norm will Täter belohnen, die ernsthaft Verantwortung übernehmen, indem sie einen Täter-Opfer-Ausgleich suchen oder den Schaden erheblich wiedergutmachen. Der Gesetzgeber schafft so einen Anreiz für aktive Reue und Opferorientierung.
Beispiel: Im vorliegenden Fall hielt das Oberlandesgericht Bamberg die Voraussetzungen des § 46a StGB nicht für erfüllt, da die späte Zahlung keine erhebliche persönliche Leistung darstellte.
Täter-Opfer-Ausgleich
Ein Täter-Opfer-Ausgleich ist ein spezieller Weg zur Konfliktbeilegung im Strafrecht, bei dem Täter und Opfer aktiv in einen kommunikativen Prozess treten, um die Folgen der Straftat gemeinsam zu bewältigen. Das Gesetz fördert diesen Dialog, um das Opfer zu stärken und dem Täter die Möglichkeit zu geben, aufrichtige Reue zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen, was im Idealfall zu einer Strafmilderung oder sogar zum Absehen von Strafe führen kann. Hier geht es um mehr als nur Geld; es ist ein Prozess der Versöhnung.
Beispiel: Für einen wirksamen Täter-Opfer-Ausgleich im Sinne des § 46a StGB verlangte das Oberlandesgericht Bamberg einen echten kommunikativen Prozess und nicht nur die bloße Geldzahlung des Betrügers.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Absehen von Strafe bei Täter-Opfer-Ausgleich oder Schadenswiedergutmachung (§ 46a StGB)
Diese Vorschrift ermöglicht es Gerichten in Ausnahmefällen, ganz von einer Strafe abzusehen, wenn der Täter aktiv und ernsthaft versucht hat, den Schaden zu beheben oder sich mit dem Opfer auszugleichen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht hatte fälschlicherweise angenommen, die bloße und späte Rückzahlung des geringen Betrages durch den Angeklagten erfülle die strengen Voraussetzungen dieser Vorschrift für ein Absehen von Strafe, was das OLG Bamberg klar verneinte.
- Milderung des Strafrahmens (§ 49 Abs. 1 StGB)
Diese Norm erlaubt es einem Gericht, die mögliche Strafe herabzusetzen, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen, bevor es über ein Absehen von Strafe nachdenkt.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Oberlandesgericht rügte das Landgericht, weil es die zwingend vorgeschriebene Prüfung einer solchen Strafmilderung unterlassen hatte, bevor es direkt ein Absehen von Strafe annahm.
- Ziele der Strafverfolgung (Allgemeine Strafzwecke)
Das Strafrecht verfolgt über die Bestrafung hinaus wichtige Ziele wie die Abschreckung von Tätern und anderen, den Schutz der Gesellschaft und die Wiedereingliederung von Straftätern.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass ein vollständiges Absehen von Strafe bei einem Wiederholungstäter die wichtigen Ziele der Strafverfolgung untergräbt und nicht mit dem Gesetz vereinbar ist.
- Anforderungen an eine gerichtliche Urteilsbegründung (Formelle Rechtsfehler)
Ein Gericht muss in seinem Urteil nachvollziehbar und vollständig darlegen, wie es zu seiner Entscheidung gekommen ist, insbesondere bei der Strafzumessung.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG Bamberg hob das Urteil des Landgerichts auch deshalb auf, weil es wesentliche, gesetzlich vorgeschriebene Schritte der Strafzumessung nicht beachtet und somit eine lückenhafte und nicht nachvollziehbare Begründung vorgelegt hatte.
Das vorliegende Urteil
OLG Bamberg – Az.: 2 Ss 101/12 – Urteil vom 04.12.2012
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.