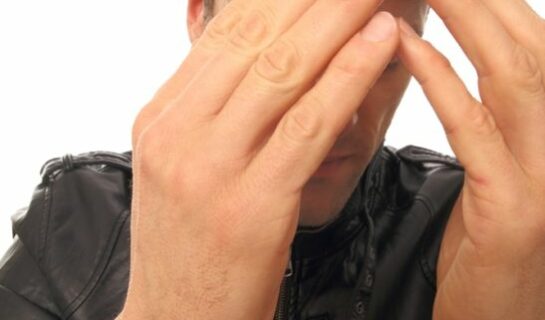Übersicht
- Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Strafaussetzung nach § 56 StGB: Ein Fall zur Resozialisierung im Fokus
- Der Fall vor Gericht
- Die Schlüsselerkenntnisse
- FAQ – Häufige Fragen
- Was bedeutet es, wenn eine Strafe zur Be### Was bedeutet es, wenn eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird?
- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann?
- Was passiert, wenn die Bewährungsauflagen nicht eingehalten werden?
- Kann man gegen die Aufhebung der Bewährung vorgehen, und wenn ja, wie?
- Was bedeutet die „Verteidigung der Rechtsordnung“ im Zusammenhang mit der Bewährungsstrafe?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Das Gericht befasste sich mit der Revision eines Angeklagten gegen ein vorheriges Urteil, das eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt hatte.
- Die Staatsanwaltschaft legte ebenfalls Revision ein, da sie mit der Entscheidung unzufrieden war.
- Der Angeklagte war wegen mehrerer Delikte, einschließlich Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, verurteilt worden.
- Die vorangegangene Strafe hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und 11 Monaten zur Folge, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.
- Das Gericht nahm an, dass die Aussetzung der Strafe zur Bewährung nicht angemessen war und hob diesen Teil des Urteils auf.
- Das Rechtsmittel des Angeklagten wurde abgelehnt, was bedeutet, dass seine Position vor Gericht nicht gestärkt wurde.
- Für die nunmehrige Entscheidung war die Wahrung der Strafrechtssystematik ausschlaggebend, insbesondere im Hinblick auf die Schwere der Taten.
- Die Entscheidung wird zur erneuten Prüfung zurück an eine andere Strafkammer des Landgerichts verwiesen.
- Die Revision der Staatsanwaltschaft hatte Erfolg, was die Grundsatzfragen zur Strafaussetzung betrifft und deren strikte Anwendung unterstreicht.
- Die neuen Überlegungen können zu einer unterschiedlichen Beurteilung und möglicherweise zu einer höheren Strafe für den Angeklagten führen.
Strafaussetzung nach § 56 StGB: Ein Fall zur Resozialisierung im Fokus
Die Strafaussetzung nach § 56 StGB ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Strafrechts. Sie ermöglicht es, eine verhängte Freiheitsstrafe unter bestimmten Voraussetzungen nicht sofort vollstrecken zu müssen.

Stattdessen können Täter auf Bewährung ihre Strafe im gesellschaftlichen Leben in der Regel verbringen, was auf das Konzept der Resozialisierung abzielt. Eines der zentralen Ziele ist es, Rückfallgefahr zu minimieren und den Tätern die Möglichkeit zu geben, sich in die Gemeinschaft zu reintegrieren, ohne eine unnötige Belastung durch den Strafvollzug zu erfahren.
Die Voraussetzungen für eine Strafaussetzung sind klar definiert und erfordern unter anderem die Überprüfung des individuellen Verhaltens des Täters sowie die Umstände des Delikts. Insbesondere die Frage, ob eine revidierte Strafe ausreichend abschreckend wirkt und ob der Täter eine positive Entwicklung gezeigt hat, spielt eine entscheidende Rolle. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen tragen dazu bei, dass die Gerichte eine fundierte Entscheidung treffen können, die sowohl dem Rechtssystem als auch den Opfern gerecht wird.
Im Folgenden wird ein konkreter Fall vorgestellt, der die Anwendung dieser Bestimmungen beleuchtet und die rechtlichen Überlegungen hinter der Entscheidung der Justiz verdeutlicht.
Der Fall vor Gericht
Schwere Körperverletzung und Angriff auf Polizisten: Bewährungsstrafe für 23-Jährigen aufgehoben
Das Oberlandesgericht Braunschweig hat die Bewährungsstrafe für einen 23-jährigen Mann teilweise aufgehoben, der wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt worden war.
Brutaler Überfall und Diebstahl
Laut Urteil griff der Angeklagte gemeinsam mit einem Mittäter Ende November 2020 nachts einen Mann in Braunschweig an. Der Haupttäter schlug dem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieses zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Der Angeklagte setzte sich auf den Bewusstlosen und schlug weiter auf ihn ein. Sein Komplize versuchte, dem Opfer ins Gesicht zu treten.
Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen wie Platzwunden, einen Bruch der Augenhöhle und eine Gehirnerschütterung. Er war 11 Wochen krankgeschrieben. Der Angeklagte stahl zudem das Handy des Opfers.
Widerstand gegen Polizisten bei Festnahme
Bei der anschließenden Festnahme leistete der 23-Jährige erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten. Er bedrohte einen Polizisten mit einer „Kopf ab“-Geste und den Worten „I kill you“. Außerdem versuchte er, den Beamten zu schlagen.
Urteil des Landgerichts Braunschweig
Das Landgericht Braunschweig verurteilte den Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten. Trotz erheblicher Bedenken setzte es die Strafe zur Bewährung aus. Als Begründung führte das Gericht an, der Angeklagte sei bisher nur zu Geldstrafen verurteilt worden und habe sich entschuldigt.
OLG hebt Bewährungsaussetzung auf
Das Oberlandesgericht kritisierte diese Entscheidung als rechtsfehlerhaft. Bei „erheblichen Bedenken“ dürfe eine Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Zudem habe das Landgericht nicht ausreichend begründet, warum trotz der Schwere der Taten besondere Umstände für eine Bewährung vorlägen.
Das OLG verwies den Fall zur erneuten Verhandlung an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurück. Diese muss nun neu über eine mögliche Strafaussetzung zur Bewährung entscheiden und dabei insbesondere prüfen, ob die Verteidigung der Rechtsordnung eine Vollstreckung der Strafe gebietet.
Revision des Angeklagten erfolglos
Die Revision des Angeklagten gegen die Verurteilung wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung wies das OLG hingegen als unbegründet zurück. Die Feststellungen des Landgerichts zu einem einvernehmlichen Zusammenwirken der Täter seien rechtlich nicht zu beanstanden.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das OLG Braunschweig verdeutlicht mit dieser Entscheidung die hohen Anforderungen an eine Strafaussetzung zur Bewährung bei schweren Gewaltdelikten. Eine Bewährungsstrafe darf nicht bei „erheblichen Bedenken“ verhängt werden, sondern erfordert eine positive Prognose und besondere Umstände. Bei Gewalttaten gegen Polizeibeamte ist zudem stets zu prüfen, ob die Verteidigung der Rechtsordnung eine Vollstreckung gebietet. Dies unterstreicht den besonderen Schutz von Vollstreckungsbeamten im Strafrecht.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Dieses Urteil verdeutlicht, dass Gerichte bei der Entscheidung über eine Bewährungsstrafe sehr sorgfältig vorgehen müssen. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, wegen einer schweren Straftat verurteilt wurden, bedeutet das: Eine Bewährungsstrafe ist bei Freiheitsstrafen von über einem Jahr nicht selbstverständlich. Das Gericht muss gute Gründe haben, warum es glaubt, dass Sie in Zukunft keine Straftaten mehr begehen werden. Ihre Reue und ein Geständnis können dabei helfen, reichen aber allein nicht aus. Bei Gewalt gegen Polizisten prüfen Gerichte besonders streng, ob eine Haftstrafe nötig ist, um die Rechtsordnung zu verteidigen. Haben Sie bereits Vorstrafen, wird eine Bewährung noch unwahrscheinlicher. Im Zweifel sollten Sie sich von einem erfahrenen Anwalt beraten lassen.
FAQ – Häufige Fragen
In dieser FAQ-Rubrik finden Sie alles Wissenswerte rund um das komplexe Thema der Bewährungsstrafe und die damit verbundene Aufhebung der Strafaussetzung. Unsere sorgfältig zusammengestellten Fragen und Antworten bieten Ihnen wertvolle Einblicke und Unterstützung, um die rechtlichen Aspekte besser zu verstehen und auf mögliche Unsicherheiten zu reagieren. Stöbern Sie durch unsere Informationen und klären Sie Ihre wichtigsten Anliegen.
Wichtige Fragen, kurz erläutert:
- Was bedeutet es, wenn eine Strafe zur Be### Was bedeutet es, wenn eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird?
- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann?
- Was passiert, wenn die Bewährungsauflagen nicht eingehalten werden?
- Kann man gegen die Aufhebung der Bewährung vorgehen, und wenn ja, wie?
- Was bedeutet die „Verteidigung der Rechtsordnung“ im Zusammenhang mit der Bewährungsstrafe?
Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie spezielle Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.
Was bedeutet es, wenn eine Strafe zur Be### Was bedeutet es, wenn eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird?
Wenn eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, bedeutet dies, dass die verhängte Freiheitsstrafe nicht sofort vollstreckt wird. Der Verurteilte muss die Haftstrafe nicht antreten, sondern erhält die Chance, sich in Freiheit zu bewähren. Dies ist nach § 56 StGB möglich bei Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren.
Voraussetzungen für eine Strafaussetzung
Für eine Strafaussetzung zur Bewährung müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:
- Bei Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr soll das Gericht die Strafe zur Bewährung aussetzen, wenn eine positive Prognose vorliegt.
- Bei Freiheitsstrafen zwischen einem und zwei Jahren kann das Gericht die Strafe zur Bewährung aussetzen.
- Es muss zu erwarten sein, dass der Verurteilte in Zukunft keine weiteren Straftaten begeht.
- Die Verteidigung der Rechtsordnung darf die Strafaussetzung nicht erfordern.
Bewährungszeit und Auflagen
Wird Ihre Strafe zur Bewährung ausgesetzt, legt das Gericht eine Bewährungszeit zwischen zwei und fünf Jahren fest. In dieser Zeit müssen Sie sich straffrei führen und bestimmte Auflagen erfüllen. Typische Bewährungsauflagen sind:
- Regelmäßige Meldungen bei einem Bewährungshelfer
- Schadenswiedergutmachung
- Gemeinnützige Arbeit
- Geldauflagen
- Teilnahme an Therapien oder Kursen
Rechtliche Konsequenzen
Auch wenn Sie bei einer Bewährungsstrafe nicht ins Gefängnis müssen, gelten Sie dennoch als vorbestraft. Die Verurteilung wird in Ihr Führungszeugnis eingetragen. Wenn Sie während der Bewährungszeit erneut straffällig werden oder gegen Auflagen verstoßen, kann das Gericht die Bewährung widerrufen. In diesem Fall müssen Sie die ursprünglich verhängte Freiheitsstrafe antreten.
Halten Sie sich hingegen an alle Auflagen und bleiben straffrei, wird die Strafe nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen. Sie haben sich dann erfolgreich bewährt.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann?
Für die Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:
Höhe der Freiheitsstrafe
Die verhängte Freiheitsstrafe darf maximal zwei Jahre betragen. Bei Strafen über zwei Jahren ist eine Aussetzung zur Bewährung grundsätzlich nicht möglich.
Positive Sozialprognose
Das Gericht muss zu der Überzeugung gelangen, dass der Verurteilte künftig keine weiteren Straftaten mehr begehen wird. Diese Prognose basiert auf verschiedenen Faktoren:
- Persönlichkeit des Täters
- Vorleben
- Umstände der Tat
- Verhalten nach der Tat
- Lebensverhältnisse
- Wirkungen der Strafaussetzung
Wenn Sie beispielsweise eine stabile Arbeitssituation haben, in geordneten Familienverhältnissen leben und die Tat ein einmaliger Ausrutscher war, kann dies für eine positive Prognose sprechen.
Abstufungen nach Strafhöhe
Je nach Höhe der Freiheitsstrafe gelten unterschiedliche Anforderungen:
- Bis zu 6 Monate: Die Aussetzung zur Bewährung ist der Regelfall, es sei denn, die Vollstreckung ist zur Verteidigung der Rechtsordnung geboten.
- 6 Monate bis 1 Jahr: Eine Aussetzung erfolgt, wenn eine positive Sozialprognose vorliegt und die Verteidigung der Rechtsordnung nicht entgegensteht.
- 1 Jahr bis 2 Jahre: Neben der positiven Sozialprognose müssen besondere Umstände vorliegen, die eine Aussetzung rechtfertigen.
Verteidigung der Rechtsordnung
In manchen Fällen kann die Vollstreckung der Strafe trotz positiver Prognose erforderlich sein, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtsordnung zu wahren. Dies kann etwa bei besonders schweren oder öffentlichkeitswirksamen Taten der Fall sein.
Einwilligung des Verurteilten
Stellen Sie sich vor, Sie werden zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In diesem Fall müssen Sie der Strafaussetzung zur Bewährung zustimmen. Ohne Ihre Einwilligung kann das Gericht die Strafe nicht zur Bewährung aussetzen.
Was passiert, wenn die Bewährungsauflagen nicht eingehalten werden?
Bei Nichteinhaltung von Bewährungsauflagen drohen rechtliche Konsequenzen, die bis zum Widerruf der Bewährung reichen können. Das Gericht hat verschiedene Möglichkeiten, auf Verstöße zu reagieren:
Leichte Verstöße
Bei geringfügigen Verstößen kann das Gericht zunächst eine Verwarnung aussprechen. Es besteht auch die Option, die bestehenden Auflagen zu verschärfen oder die Bewährungszeit zu verlängern. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Auflage, sich monatlich bei der Bewährungshilfe zu melden, und versäumen einen Termin. In diesem Fall könnte das Gericht Sie ermahnen und zusätzlich anordnen, dass Sie sich künftig zweimal monatlich melden müssen.
Schwerwiegende Verstöße
Bei gravierenden oder wiederholten Verstößen droht der Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung. Dies bedeutet, dass die ursprünglich verhängte Freiheitsstrafe vollstreckt wird und Sie diese im Gefängnis verbüßen müssen. Ein schwerwiegender Verstoß wäre beispielsweise, wenn Sie die Auflage haben, sich einer Suchttherapie zu unterziehen, diese aber eigenmächtig abbrechen.
Erneute Straffälligkeit
Besonders kritisch ist es, wenn Sie während der Bewährungszeit erneut straffällig werden. Dies kann als klarer Hinweis gewertet werden, dass die Erwartung einer straffreien Führung nicht erfüllt wurde. In solchen Fällen ist ein Widerruf der Bewährung sehr wahrscheinlich.
Entscheidungsprozess des Gerichts
Das Gericht muss bei der Entscheidung über die Folgen eines Verstoßes mehrere Faktoren berücksichtigen:
- Schwere und Häufigkeit der Verstöße
- Bisherige Bewährungsführung
- Persönliche Situation des Verurteilten
- Gründe für den Verstoß
Wenn Sie beispielsweise aufgrund einer schweren Erkrankung eine Therapieauflage nicht einhalten konnten, wird das Gericht dies anders bewerten als eine mutwillige Missachtung der Auflagen.
Rechtliches Gehör und Verteidigungsmöglichkeiten
Bevor das Gericht eine Entscheidung trifft, haben Sie das Recht auf rechtliches Gehör. Sie können Ihre Sicht der Dinge darlegen und Gründe für den Verstoß erklären. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um Ihre Situation zu erläutern und gegebenenfalls Nachweise für entlastende Umstände vorzulegen.
Gesetzliche Grundlage
Die rechtlichen Konsequenzen bei Verstößen gegen Bewährungsauflagen sind in § 56f StGB geregelt. Dieser Paragraph legt fest, unter welchen Umständen das Gericht die Strafaussetzung widerrufen kann und welche Alternativen zum Widerruf bestehen.
Beachten Sie, dass die Einhaltung der Bewährungsauflagen in Ihrem eigenen Interesse liegt. Durch regelkonformes Verhalten während der Bewährungszeit können Sie zeigen, dass Sie die Chance auf ein straffreies Leben nutzen und so den endgültigen Straferlass nach § 56g StGB erreichen.
Kann man gegen die Aufhebung der Bewährung vorgehen, und wenn ja, wie?
Ja, Sie können gegen die Aufhebung (den Widerruf) der Bewährung vorgehen. Das wichtigste Rechtsmittel hierfür ist die sofortige Beschwerde.
Frist und Einlegung der sofortigen Beschwerde
Die sofortige Beschwerde müssen Sie innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des Widerrufsbeschlusses einlegen. Wenn Sie den Beschluss per Post erhalten haben, beginnt die Frist am dritten Tag nach dem Absendedatum. Die Beschwerde können Sie schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des Gerichts einlegen, das den Widerruf angeordnet hat.
Begründung der Beschwerde
In Ihrer Beschwerde sollten Sie darlegen, warum der Widerruf Ihrer Meinung nach nicht gerechtfertigt ist. Mögliche Argumente könnten sein:
- Der angebliche Verstoß gegen Bewährungsauflagen hat nicht stattgefunden.
- Der Verstoß war nicht so schwerwiegend, dass er einen Widerruf rechtfertigt.
- Es gab besondere Umstände, die den Verstoß entschuldigen.
- Sie haben sich seit dem Vorfall gebessert und positive Entwicklungen gemacht.
Prüfung durch das Beschwerdegericht
Das Beschwerdegericht prüft den Fall erneut. Es kann den Widerrufsbeschluss aufheben, abändern oder bestätigen. Wenn die sofortige Beschwerde erfolgreich ist, bleibt Ihre Bewährung bestehen. Das Gericht kann stattdessen auch mildere Maßnahmen anordnen, wie etwa eine Verlängerung der Bewährungszeit oder zusätzliche Auflagen.
Verfassungsbeschwerde als letztes Mittel
Sollte die sofortige Beschwerde erfolglos bleiben, können Sie in bestimmten Fällen noch Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen. Dies kommt aber nur in Betracht, wenn Sie eine Verletzung Ihrer Grundrechte geltend machen können, etwa weil das Gericht Ihr rechtliches Gehör verletzt hat.
Wenn Sie mit einem Bewährungswiderruf konfrontiert sind, ist schnelles Handeln geboten. Die kurze Beschwerdefrist von einer Woche erfordert, dass Sie umgehend aktiv werden, um Ihre Chancen auf einen Erhalt der Bewährung zu wahren.
Was bedeutet die „Verteidigung der Rechtsordnung“ im Zusammenhang mit der Bewährungsstrafe?
Die „Verteidigung der Rechtsordnung“ ist ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung über die Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung. Es handelt sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der in § 56 Abs. 3 StGB verankert ist.
Bedeutung des Begriffs
Die „Verteidigung der Rechtsordnung“ zielt darauf ab, das Vertrauen der Bevölkerung in die Geltung und Durchsetzung des Rechts zu bewahren. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Straftat besonders schwerwiegend oder gesellschaftlich beunruhigend ist, kann es notwendig sein, die Strafe tatsächlich zu vollstrecken, um die Rechtsordnung zu verteidigen.
Anwendung durch die Gerichte
Bei der Bewertung dieses Aspekts berücksichtigen Gerichte verschiedene Faktoren:
- Die Schwere der Tat
- Die Art und Weise der Tatbegehung
- Die Folgen für das Opfer und die Gesellschaft
- Die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Tat
Stellen Sie sich vor, ein Täter hat eine besonders brutale oder öffentlichkeitswirksame Straftat begangen. In einem solchen Fall könnte das Gericht zu dem Schluss kommen, dass eine Aussetzung zur Bewährung das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtsordnung erschüttern würde.
Abwägung mit anderen Faktoren
Die „Verteidigung der Rechtsordnung“ ist nur eines von mehreren Kriterien, die das Gericht bei der Entscheidung über eine Bewährungsstrafe berücksichtigt. Es muss immer eine Abwägung mit anderen Faktoren wie der Resozialisierung des Täters und der individuellen Prognose stattfinden.
Rechtliche Grundlage
Die gesetzliche Verankerung findet sich in § 56 Abs. 3 StGB:
„Bei der Verurteilung zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wird die Vollstreckung nicht ausgesetzt, wenn die Verteidigung der Rechtsordnung sie gebietet.“
Diese Regelung verdeutlicht, dass die „Verteidigung der Rechtsordnung“ ein Hindernis für die Strafaussetzung zur Bewährung darstellen kann. Wenn Sie als Angeklagter mit einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten konfrontiert sind, spielt dieser Aspekt eine wichtige Rolle bei der gerichtlichen Entscheidung über eine mögliche Bewährung.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Strafaussetzung: Dies ist ein Verfahren, bei dem die Vollstreckung einer verhängten Freiheitsstrafe unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt wird. Dies bedeutet, dass der verurteilte Täter seine Strafe nicht sofort im Gefängnis absitzen muss, sondern die Möglichkeit hat, sich in der Gesellschaft zu rehabilitieren. Die Idee dahinter ist, dem Täter zu ermöglichen, sein Verhalten zu verbessern und seine Lebensumstände zu verändern, ohne dass eine sofortige lästige Haftstrafe verhängt wird. Wenn der Täter sich während der Bewährungszeit bewährt, kann die Strafe ganz oder teilweise erlassen werden.
- Resozialisierung: Dies bezieht sich auf den Prozess, durch den Straftäter wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden sollen, nachdem sie eine Strafe verbüßt oder eine Bewährungsstrafe erhalten haben. Ziel der Resozialisierung ist es, Rückfälligkeit zu verhindern, indem den Tätern die Möglichkeit gegeben wird, ein straffreies Leben zu führen und Verantwortung zu übernehmen. Hierbei können verschiedene Maßnahmen wie Therapie, berufliche Ausbildungen oder soziale Unterstützung eine Rolle spielen. Resozialisierung ist ein zentraler Aspekt des Strafrechts, da es dem sozialen Frieden und der Sicherheit dient.
- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Dies bedeutet, dass jemand aktiv versucht, die Arbeit von Polizei oder anderen Beamten, die ein Gesetz durchsetzen oder eine gesetzliche Aufgabe erfüllen, zu behindern oder zu verhindern. Dieser Widerstand ist im deutschen Recht besonders streng geregelt und wird hart bestraft, weil er das Vertrauen in die öffentliche Ordnung und Sicherheit untergräbt. Ein Beispiel wäre, einen Polizisten bei einer Festnahme körperlich anzugreifen oder verbal mit Drohungen zu attackieren.
- Erhebliche Bedenken: Dieser Begriff beschreibt einen Zustand, in dem ein Gericht ernsthafte Zweifel daran hat, dass eine Bewährungsstrafe gerechtfertigt ist. Dies kann auf die Schwere der begangenen Straftaten, auf die Persönlichkeit des Täters oder auf frühere Straftaten hinweisen. Wenn ein Gericht erhebliche Bedenken äußert, wird in der Regel erwartet, dass der Täter seine Strafe im Gefängnis absitzt, um der Gesellschaft Schutz zu bieten und die Rechtsordnung zu wahren.
- Verteidigung der Rechtsordnung: Dies bezieht sich auf die Notwendigkeit, die Gesetze und Normen einer Gesellschaft aufrechtzuerhalten. In bestimmten Fällen, insbesondere bei Gewalt gegen Polizisten oder anderen schwerwiegenden Delikten, kann es notwendig sein, dass das Gericht eine Freiheitsstrafe verhängt, um die Integrität der Rechtsordnung zu schützen. Diese Idee gründet sich auf der Annahme, dass es wichtig ist, der Gesellschaft zu zeigen, dass schwerwiegende Straftaten nicht toleriert werden, um von möglichen zukünftigen Straftaten abzuschrecken.
- Positive Prognose: Bei der Verhängung einer Bewährungsstrafe müssen die Gerichte die Wahrscheinlichkeit bewerten, dass der Täter in der Zukunft straffrei bleibt. Eine positive Prognose bedeutet, dass das Gericht glaubt, der Täter wird sich in der Gemeinde bewähren und keine weiteren Kriminaldelikte begehen. Faktoren wie Reue, Therapieerfolge oder vorangegangene Erfahrungen mit der Straffreiheit können in diese Bewertung einfließen. Fehlt eine positive Prognose, ist die Bewährungsstrafe unwahrscheinlich.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 223 StGB (Körperverletzung): Diese Vorschrift bestraft die absichtliche körperliche Misshandlung oder die Gesundheitsschädigung einer anderen Person. Es ist ein zentraler Paragraph im deutschen Strafrecht, der die Grenze zwischen erlaubtem und verbotenem Verhalten im Umgang mit anderen Menschen festlegt. Im vorliegenden Fall wurden die Angeklagten unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt, da sie den Geschädigten brutal angegriffen und erheblich verletzt haben.
- § 240 StGB (Nötigung): Dieser Paragraph behandelt die Nötigung, also das widerrechtliche Zwingen einer Person zu einem bestimmten Verhalten oder Unterlassen durch Gewalt oder Drohung. Im Kontext des Falls zeigt sich, dass der Angriff der Angeklagten auf das Opfer auch Elemente der Nötigung beinhaltet, weil sie dessen Verhalten durch körperliche Übergriffe beeinflussen wollten. Diese Handlung diente nicht nur der Körperverletzung, sondern auch dazu, das Opfer in eine hilflose Lage zu versetzen.
- § 113 StGB (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte): Diese Norm stellt den Widerstand gegen Beamte, die in Ausübung ihres Amtes handeln, unter Strafe. Der Fall behandelt jedoch nicht nur die Körperverletzung, sondern auch den Widerstand der Angeklagten gegen die Polizei bei der Festnahme. Der Angeklagte K. wurde dafür verurteilt, was zeigt, dass solche Taten gegen die Rechtsordnung besonders scharf geahndet werden.
- § 263 StGB (Betrug): Obwohl in diesem Fall nicht direkt erwähnt, steht dieser Paragraph im Kontext des Deliktsvorwurfs, da eine der Fragen bei der Verurteilung auch die Motivation und die Umstände des Übergriffs umfasst. Hier könnte von einer Situation ausgegangen werden, in der der Täter in berechnender Weise handelte, um sich einen Vorteil zu verschaffen, was für die Gesamtschau des Täters von Bedeutung ist. Im vorliegenden Kontext könnte es relevant sein, wenn das Verhalten der Täter als gemeinschaftliches Handeln mit betrügerischer Absicht interpretiert wird.
- § 46 StGB (Besonderheiten der Strafzumessung): Diese Vorschrift gibt einen Rahmen für die Strafzumessung und berücksichtigt die Umstände und das Verhalten des Täters. Im vorliegenden Fall spielt § 46 eine Rolle, da das Gericht die Strafe der Angeklagten unter Berücksichtigung der Schwere der Taten, der Persönlichkeit der Angeklagten und der Notwendigkeit von Resozialisierungsmaßnahmen bemessen muss. Die Tatsache, dass die Gesamtfreiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, zeigt, dass das Gericht diese Aspekte abgewogen hat.
Das vorliegende Urteil
OLG Braunschweig – Az.: 1 Ss 40/22 – Urteil vom 22.03.2023
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.