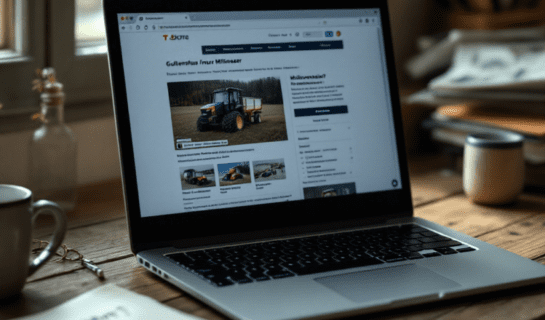Ein 16-jähriger Pkw-Dieb erhielt eine Jugendstrafe, obwohl er nicht vorbestraft war – das Gericht stützte sich auf die Begründung der Jugendstrafe bei schädlichen Neigungen. Das Urteil wurde nun komplett aufgehoben, da die Vorinstanz die Mängel lediglich aus der Schwere der Tat ableitete.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Jugendstrafe wegen „schädlicher Neigungen“: Warum eine oberflächliche Begründung nicht ausreicht
- Was genau war passiert?
- Welche Gesetze spielten hier die entscheidende Rolle?
- Warum entschied das OLG Hamm so – und nicht anders?
- Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Experten Kommentar
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wann gilt mein Kind im Jugendstrafrecht als jugendlicher Straftäter mit schädlichen Neigungen?
- Zählt schlechte Schulleistung oder Arbeitslosigkeit als Beweis für schädliche Neigungen?
- Wie muss der Richter eine Jugendstrafe begründen, damit sie revisionssicher ist?
- Was bedeutet der Erziehungsgedanke, wenn die Jugendstrafe wegen einer schweren Tat droht?
- Wie kann ich mich erfolgreich gegen die richterliche Diagnose schädlicher Neigungen verteidigen?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 4 ORs 107/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht Hamm
- Datum: 21.08.2025
- Aktenzeichen: 4 ORs 107/25
- Verfahren: Revision im Jugendstrafrecht
- Rechtsbereiche: Jugendstrafrecht, Strafverfahrensrecht
- Das Problem: Ein verurteilter Jugendlicher legte Revision gegen die Höhe der gegen ihn verhängten Jugendstrafe ein. Er rügte, dass das Amtsgericht die Notwendigkeit dieser Strafe nicht ausreichend begründet hatte.
- Die Rechtsfrage: War die Begründung für die Verhängung der Jugendstrafe und deren genaue Höhe rechtlich fehlerhaft, weil der vorrangige Erziehungsgedanke nicht genügend berücksichtigt wurde?
- Die Antwort: Ja. Das Oberlandesgericht stellte schwere Begründungsmängel fest. Der Teil des Urteils, der die Strafe festlegte, wurde aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung an eine andere Abteilung des Amtsgerichts zurückverwiesen.
- Die Bedeutung: Gerichte müssen die Verhängung einer Jugendstrafe detailliert begründen. Typische Lebensumstände eines Jugendlichen reichen nicht als Beleg für Schädliche Neigungen aus. Der Erziehungsgedanke muss bei der Bemessung der Jugendstrafe Vorrang vor allgemeinen Strafgründen haben.
Jugendstrafe wegen „schädlicher Neigungen“: Warum eine oberflächliche Begründung nicht ausreicht
Ein Urteil im Jugendstrafrecht ist mehr als nur eine Reaktion auf eine Straftat. Es ist eine Weichenstellung für einen jungen Menschen. Doch wann ist eine Tat nur ein jugendlicher Fehltritt und wann ist sie Symptom einer tiefgreifenden Fehlentwicklung, die eine intensive erzieherische Maßnahme wie eine Jugendstrafe erfordert? Genau diese kritische Abgrenzung stand im Mittelpunkt eines Beschlusses des Oberlandesgerichts Hamm vom 21. August 2025 (Az. 4 ORs 107/25). Der Fall zeigt eindrücklich, dass Richter die schwerwiegende Diagnose „schädlicher Neigungen“ nicht pauschal stellen dürfen, sondern mit akribischer Sorgfalt begründen müssen.
Was genau war passiert?
Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Polen reiste nach Deutschland, um ein Auto zu stehlen. Er war nicht allein, sondern hatte einen Mittäter angeworben. Mit einem sogenannten Funkstreckenwellenverlängerer, einem technischen Gerät zum Überlisten der schlüssellosen Zugangssysteme moderner Fahrzeuge, entwendeten sie einen Pkw. Die Flucht endete abrupt, als der vom Jugendlichen rekrutierte Fahrer bei dem Versuch, einer Polizeikontrolle auf der Autobahn zu entkommen, einen Unfall baute.
Vor dem Amtsgericht Lippstadt, fast ein Jahr nach der Tat, zeigte sich der inzwischen 17-Jährige geständig. Er war nicht vorbestraft und befand sich seit etwa zweieinhalb Monaten in Untersuchungshaft – eine Zeit, die für ihn aufgrund der Sprachbarriere besonders belastend war. Das Amtsgericht verurteilte ihn wegen gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Die Begründung für diese gravierende Rechtsfolge: Bei dem Jugendlichen lägen „schädliche Neigungen“ vor. Das Gericht stützte diese Annahme auf seine Lebensumstände – er hatte kein eigenes Einkommen, lebte bei den Eltern und hatte einmal die Berufsschule gewechselt – sowie auf seinen Tatbeitrag, insbesondere das Anwerben eines Mittäters.
Doch der Verteidiger des Jugendlichen sah hier einen entscheidenden Fehler. Er legte Revision ein, ein Rechtsmittel, das ein Urteil auf Rechtsfehler überprüft. Sein Angriffsziel war nicht der Schuldspruch an sich, sondern ausschließlich die verhängte Strafe. Er argumentierte, das Amtsgericht habe die Annahme schädlicher Neigungen nicht ausreichend begründet und den Erziehungsgedanken bei der Strafhöhe vernachlässigt.
Welche Gesetze spielten hier die entscheidende Rolle?
Das Jugendstrafrecht unterscheidet sich fundamental vom Erwachsenenstrafrecht. Sein oberstes Ziel ist nicht die Sühne, sondern die Erziehung. Im Zentrum dieses Falles stehen zwei zentrale Vorschriften aus dem Jugendgerichtsgesetz (JGG).
Die entscheidende Hürde für die Verhängung einer Jugendstrafe ist § 17 Abs. 2 JGG. Dieses Gesetz erlaubt eine Freiheitsstrafe nur dann, wenn entweder die Schwere der Schuld sie erfordert oder – wie hier vom Amtsgericht angenommen – beim Jugendlichen sogenannte schädliche Neigungen vorliegen. Der Begriff der „schädlichen Neigungen“ ist dabei keine vage moralische Bewertung. Das Gesetz definiert ihn als erhebliche Anlage- oder Erziehungsmängel, die so tief sitzen, dass ohne eine längere, gezielte erzieherische Einwirkung die Gefahr weiterer Straftaten besteht. Es geht also um eine negative Zukunftsprognose, die auf einer fundierten Analyse der Persönlichkeit des Jugendlichen beruhen muss.
Ist diese hohe Hürde genommen, regelt § 18 Abs. 2 JGG die Bemessung der Strafhöhe. Auch hier dominiert der Erziehungsgedanke. Das Gericht muss abwägen, welche Strafdauer notwendig ist, um erzieherisch auf den Jugendlichen einzuwirken, und welche Folgen die Strafe für seine weitere Entwicklung haben wird. Allgemeine Strafzumessungsgründe aus dem Strafgesetzbuch, wie etwa die Schwere des verursachten Schadens (§ 46 StGB), treten in den Hintergrund. Sie dürfen berücksichtigt werden, aber niemals den Erziehungszweck verdrängen.
Warum entschied das OLG Hamm so – und nicht anders?
Das Oberlandesgericht Hamm überprüfte das Urteil des Amtsgerichts Lippstadt und gab der Revision des Jugendlichen statt. Es hob die verhängte Jugendstrafe auf und verwies den Fall zur Neuverhandlung an eine andere Abteilung des Amtsgerichts zurück. Die Richter am OLG sahen in der Begründung des ersten Urteils gleich mehrere gravierende Rechtsfehler. Ihre Entscheidung folgte einer klaren und nachvollziehbaren Logik.
Warum die schwere Tat allein nicht ausreicht

Das Amtsgericht hatte aus der professionellen Tatausführung und dem Anwerben eines Komplizen auf eine hohe kriminelle Energie und damit auf schädliche Neigungen geschlossen. Das OLG Hamm stellte klar, dass dieser Schluss zu kurz greift. Schädliche Neigungen setzen laut ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs voraus, dass bereits vor der Tat erhebliche Persönlichkeitsmängel bestanden haben. Die Tat ist dann oft nur der sichtbare Ausdruck dieser tieferliegenden Probleme.
Das Amtsgericht hatte es aber versäumt, nach solchen Mängeln in der Vorgeschichte des Jugendlichen zu suchen und diese konkret festzustellen. Die Tatsache, dass der Jugendliche nicht vorbestraft war, sprach sogar eher gegen eine bereits verfestigte kriminelle Haltung. Allein aus einer einzelnen, wenn auch schwerwiegenden Straftat auf einen dauerhaft fehlerhaften Charakter zu schließen, ist nach Ansicht des OLG unzulässig. Es fehlt die Brücke zwischen der Tat und der Persönlichkeit.
Wenn typisches Jugendverhalten fälschlich als Mangel interpretiert wird
Besonders kritisch sahen die Hammer Richter die Argumente, die das Amtsgericht aus den Lebensumständen des Jugendlichen zog. Kein eigenes Einkommen zu haben, bei den Eltern zu wohnen und einmal die Berufsschule gewechselt zu haben, seien für einen 16- oder 17-Jährigen völlig normale Umstände. Ohne weitere Details, etwa zu den Gründen des Schulwechsels, lassen sich daraus keine erheblichen Erziehungsmängel ableiten. Das OLG monierte, dass hier typische Aspekte einer jugendlichen Biografie ohne nähere Begründung zu negativen Persönlichkeitsmerkmalen umgedeutet wurden.
Wurde die Entwicklung des Jugendlichen seit der Tat ignoriert?
Ein weiterer zentraler Punkt im Jugendstrafrecht ist der Blick nach vorn. Die Prognose über schädliche Neigungen muss zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung noch zutreffen. Im vorliegenden Fall lagen zwischen der Tat und der Verhandlung fast elf Monate. In dieser Zeit war der Jugendliche zwei Monate in Untersuchungshaft. Das OLG kritisierte, dass das Amtsgericht sich mit dieser Zeitspanne und den potenziellen erzieherischen Wirkungen der Haft überhaupt nicht auseinandergesetzt hatte. Es hätte prüfen müssen, ob eventuell vorhandene Mängel durch die einschneidende Hafterfahrung oder den normalen Reifungsprozess nicht bereits abgebaut waren. Diese Prüfung fand nicht statt.
Warum die Strafe nicht nur bestrafen, sondern erziehen muss
Schließlich bemängelte das OLG die Bemessung der Strafhöhe. Die Begründung des Amtsgerichts las sich eher wie ein Urteil gegen einen Erwachsenen. Sie zählte Faktoren wie das Geständnis (strafmildernd) und den „erheblichen Schaden“ (strafschärfend) auf. Der entscheidende Erziehungsgedanke nach § 18 Abs. 2 JGG wurde nur mit einer formelhaften Floskel erwähnt.
Die Richter in Hamm machten deutlich, dass dies nicht genügt. Ein Jugendgericht muss nachvollziehbar darlegen, warum es genau diese Strafhöhe für erzieherisch notwendig hält. Zudem blieb im Urteil des Amtsgerichts unklar, worin der „erhebliche Schaden“ genau bestand und ob dieser dem Angeklagten überhaupt zuzurechnen war. War der Wert des gestohlenen Autos gemeint oder der Schaden aus dem Unfall, den der Mittäter verursacht hatte? Diese fehlende Präzision machte die Strafzumessung für das OLG unüberprüfbar und damit rechtsfehlerhaft.
Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?
Der Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm ist mehr als eine Korrektur eines Einzelfalls. Er schärft den Blick für die fundamentalen Prinzipien des Jugendstrafrechts und verdeutlicht die hohen Anforderungen an die richterliche Arbeit in diesem sensiblen Bereich.
Die erste zentrale Lehre ist die strikte Trennung zwischen der Tat und der Persönlichkeit des Täters. Eine Jugendstrafe wegen schädlicher Neigungen bestraft nicht primär die Tat, sondern reagiert auf eine diagnostizierte Fehlentwicklung des Jugendlichen. Diese Diagnose muss auf einer soliden Faktenbasis stehen, die über die Tat hinausgeht. Ein Gericht muss die Lebensgeschichte, das soziale Umfeld und die Entwicklung des jungen Menschen beleuchten, um zu belegen, dass die Straftat kein einmaliger Ausrutscher, sondern das Symptom eines tieferen Problems ist. Pauschale Annahmen oder die bloße Schwere der Tat genügen dafür nicht.
Zweitens unterstreicht die Entscheidung den unbedingten Vorrang des Erziehungsgedankens. Jede strafrechtliche Maßnahme gegen einen Jugendlichen muss sich an der Frage messen lassen: Dient sie seiner künftigen Entwicklung? Das gilt insbesondere für die Bemessung der Strafhöhe. Ein Gericht muss konkret erklären, warum eine bestimmte Dauer einer Jugendstrafe aus pädagogischer Sicht geboten ist. Eine Begründung, die sich in den Kriterien des Erwachsenenstrafrechts erschöpft und den Erziehungszweck nur am Rande erwähnt, ist unzureichend und angreifbar.
Drittens zeigt der Fall, wie entscheidend eine lückenlose und nachvollziehbare Urteilsbegründung ist. Das Revisionsgericht prüft nicht, ob es selbst anders entschieden hätte, sondern nur, ob die Entscheidung der Vorinstanz auf Rechtsfehlern beruht. Eine unklare, pauschale oder widersprüchliche Begründung ist ein solcher Rechtsfehler. Der Fall aus Hamm ist somit auch ein Plädoyer für richterliche Sorgfalt. Sie ist der wichtigste Schutzmechanismus, um sicherzustellen, dass einschneidende Maßnahmen wie eine Jugendstrafe nur dann verhängt werden, wenn sie gesetzlich zwingend geboten und in jeder Hinsicht sauber begründet sind.
Die Urteilslogik
Die Verhängung einer Jugendstrafe erfordert stets eine akribische, auf die Persönlichkeit bezogene Begründung, die weit über die bloße Beurteilung der Straftat hinausgeht.
- [Diagnose der Persönlichkeit]: Die Schwere eines Delikts beweist keine schädlichen Neigungen des Jugendlichen; Gerichte müssen vielmehr nachweisen, dass die Straftat den Ausdruck bereits vor der Tat bestehender, tiefgreifender Anlage- oder Erziehungsmängel bildet.
- [Vorrang der Pädagogik]: Jugendgerichte leiten die Dauer einer Freiheitsstrafe dezidiert aus der erzieherischen Notwendigkeit ab und vermeiden es strikt, den gesetzlich verankerten Erziehungszweck hinter allgemeinen Kriterien der Strafzumessung zurücktreten zu lassen.
- [Vermeidung pauschaler Mängeldiagnosen]: Richter analysieren typische Aspekte einer jugendlichen Biografie, wie den Wohnsitz bei den Eltern oder einen Schulwechsel, spezifisch und dürfen sie nicht ohne weitere fundierte Details als Symptome schwerwiegender Erziehungsmängel umdeuten.
Der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit verlangt, dass einschneidende Maßnahmen im Jugendstrafrecht auf einer lückenlosen Begründung beruhen, welche die gesamte Entwicklung des Verurteilten umfassend würdigt.
Benötigen Sie Hilfe?
Fehlt in Ihrem Fall die ausreichende Begründung für die Jugendstrafe? Erhalten Sie eine fundierte rechtliche Einschätzung Ihrer Aktenlage.
Experten Kommentar
Manche Richter ziehen vorschnell den Schluss, eine schlimme Tat müsse zwingend auf einem schlechten Charakter beruhen. Dieses Urteil ist ein klares Stoppzeichen: Eine Jugendstrafe wegen schädlicher Neigungen verlangt eine saubere, diagnostische Begründung, die über die bloße Schwere des Diebstahls oder der Tatausführung hinausgeht. Normale jugendliche Umstände wie ein Schulwechsel oder das Wohnen bei den Eltern reichen keinesfalls aus, um eine tiefgreifende Fehlentwicklung zu bejahen. Jugendgerichte müssen konsequent darlegen, warum die gewählte Strafhöhe pädagogisch notwendig ist, anstatt sich in den üblichen Kriterien des Erwachsenenstrafrechts zu verlieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wann gilt mein Kind im Jugendstrafrecht als jugendlicher Straftäter mit schädlichen Neigungen?
Die Verhängung einer Jugendstrafe wegen schädlicher Neigungen (§ 17 Abs. 2 JGG) setzt voraus, dass erhebliche Anlage- oder Erziehungsmängel bereits vor der eigentlichen Straftat existierten. Diese Mängel müssen so tief verwurzelt sein, dass ohne längere, gezielte erzieherische Einwirkung die Gefahr weiterer Straftaten besteht. Die Straftat ist demnach lediglich ein sichtbares Symptom dieses tieferliegenden Problems und nicht dessen alleiniger Beweis.
Die richterliche Diagnose stützt sich auf eine negative Zukunftsprognose, die eine fundierte Analyse der gesamten Persönlichkeit erfordert. Richter dürfen nicht allein die Schwere der begangenen Tat oder eine professionelle Tatausführung als Beweis für eine kriminelle Anlage heranziehen. Stattdessen müssen die Mängel konkret in der Lebensgeschichte und im sozialen Umfeld des Jugendlichen festgestellt werden. Eine grundsätzlich stabile Sozialisation oder fehlende Vorstrafen sprechen stark gegen eine bereits verfestigte kriminelle Haltung.
Die Gerichte müssen eine klare Brücke zwischen der Tat und den vorgängigen Persönlichkeitsmängeln schlagen. Es ist unzulässig, allein aus der im Rahmen der Tat gezeigten kriminellen Energie, etwa dem Anwerben eines Komplizen, auf einen dauerhaft fehlerhaften Charakter zu schließen. Wenn diese Mängel in der Vorgeschichte nicht präzise belegt werden, ist die Feststellung der schädlichen Neigungen juristisch fehlerhaft.
Erstellen Sie umgehend eine detaillierte Liste aller positiven Entwicklungen und stabilen Phasen des Jugendlichen in den zwölf Monaten vor der Tat, um die Annahme tiefgreifender Mängel zu widerlegen.
Zählt schlechte Schulleistung oder Arbeitslosigkeit als Beweis für schädliche Neigungen?
Nein, Umstände wie fehlendes eigenes Einkommen, Wohnen bei den Eltern oder ein Berufsschulwechsel gelten nicht automatisch als Beweis für schädliche Neigungen. Das Oberlandesgericht Hamm stellte klar, dass diese Aspekte für Jugendliche völlig normal sind. Gerichte begehen einen Rechtsfehler, wenn sie typische Jugendbiografien pauschal als tiefe Erziehungsmängel interpretieren, um eine Jugendstrafe zu begründen. Die Richter müssen Sorgfalt beweisen und dürfen aus allgemeinen Lebensumständen nicht einfach auf eine negative Zukunftsprognose schließen.
Die Richter dürfen normale Entwicklungsmerkmale nicht ohne nähere Begründung zu negativen Persönlichkeitsmerkmalen umdeuten. Eine Jugendstrafe setzt immer voraus, dass tief sitzende Mängel vorliegen, die bereits vor der Tat bestanden haben. Für die Verhängung einer Jugendstrafe muss eine lückenlose Kausalkette zwischen den festgestellten Mängeln und der Gefahr weiterer Straftaten existieren. Das Gericht muss akribisch nachweisen, warum gerade der Wechsel der Berufsschule oder das Fehlen eines festen Jobs auf eine tiefgreifende Fehlentwicklung hindeutet.
Fehlende Arbeit oder mangelnde schulische Konstanz sind häufig Symptome von altersgemäßen Orientierungsproblemen. Jugendliche benötigen Zeit, um ihren beruflichen oder schulischen Weg zu finden und umzustrukturieren. Wird ein Schulwechsel beispielsweise als Zeichen fehlender Disziplin interpretiert, ohne die wahren Gründe wie familiäre Probleme oder Umorientierung zu prüfen, liegt ein fehlerhafter Schluss vor. Solche Umstände dürfen nicht ohne detaillierte Begründung zu Lasten des Jugendlichen verwendet werden.
Sammeln Sie sofort Zeugenaussagen von Jugendpflegern oder Lehrern, um darzulegen, dass die Umstände auf externe Faktoren oder altersgemäße Umorientierung zurückzuführen waren.
Wie muss der Richter eine Jugendstrafe begründen, damit sie revisionssicher ist?
Ein Urteil im Jugendstrafrecht ist nur revisionssicher, wenn es die Verhängung einer Jugendstrafe akribisch und nachvollziehbar begründet. Richter müssen eine lückenlose Brücke zwischen den festgestellten Fehlentwicklungen und der Notwendigkeit der Strafe als erzieherisches Mittel schlagen. Entscheidend ist, dass die Begründung der Jugendstrafe den Erziehungsgedanken dominant behandelt und nicht die Kriterien des Erwachsenenstrafrechts in den Vordergrund stellt.
Die Richter müssen zunächst lückenlos belegen, dass schädliche Neigungen (§ 17 Abs. 2 JGG) tatsächlich vorlagen und dass sie über die Schwere der Tat hinausgehen. Die bloße Planmäßigkeit eines Diebstahls oder das Anwerben eines Komplizen reicht dafür nicht aus. Das Gericht muss die Lebensgeschichte des Jugendlichen analysieren, konkrete Erziehungsmängel feststellen und darlegen, warum ohne längere, intensive erzieherische Einwirkung die Gefahr weiterer Straftaten droht.
Ein zentraler Fehler in Urteilen liegt oft in der Strafzumessung. Diese darf nicht nur allgemeine Faktoren des Erwachsenenstrafrechts (wie ein Geständnis oder Schadenshöhe) auflisten. Stattdessen muss das Gericht erklären, warum genau die verhängte Dauer erzieherisch notwendig ist (§ 18 Abs. 2 JGG). Zudem muss die Entwicklung des Jugendlichen seit der Tat, etwa die positive Wirkung einer Untersuchungshaft oder der natürliche Reifungsprozess, aktiv geprüft und in die Prognose einbezogen werden.
Markieren Sie sofort jede Stelle im Urteil, in der unklar bleibt, worin der Schaden genau besteht oder ob die Strafhöhe nur mit einer formelhaften Floskel begründet wird.
Was bedeutet der Erziehungsgedanke, wenn die Jugendstrafe wegen einer schweren Tat droht?
Selbst bei brutalen oder schweren Straftaten verliert der Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht niemals seine Vorrangstellung. Im Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht darf die Strafe nicht primär zur Vergeltung dienen. Das Gericht muss das Strafmaß ausschließlich danach ausrichten, welche Dauer für die notwendige erzieherische Einwirkung erforderlich ist.
Dieser Vorrang der Erziehung ist in § 18 Abs. 2 JGG festgeschrieben. Das bedeutet, die Sühne des begangenen Unrechts hat im Vergleich zur zukünftigen positiven Entwicklung des Jugendlichen eine nachrangige Bedeutung. Das Jugendgericht muss eine Prognoseentscheidung treffen, welche pädagogische Maßnahme die künftige Straffreiheit des jungen Menschen am besten gewährleistet. Die bloße Schwere der Tat oder der entstandene Schaden dürfen daher nicht der Hauptgrund für die Bemessung der Strafhöhe sein.
Richter dürfen allgemeine Strafzumessungsgründe, wie die Schwere des verursachten Schadens nach § 46 StGB, nicht dominieren lassen. Das Gericht begeht einen Rechtsfehler, wenn es sich bei der Strafhöhe hauptsächlich auf Schadenshöhe oder Vergeltung stützt und dadurch den Erziehungszweck verdrängt. Das Gericht muss vielmehr detailliert begründen, warum genau die verhängte Dauer pädagogisch geboten ist. Fehlt diese spezifische Begründung, wird das Urteil in der Revision angreifbar, weil der zentrale Erziehungsgedanke missachtet wurde.
Prüfen Sie Urteile auf die Verwendung von Begriffen wie „Sühne“ oder „Vergeltung“ und fordern Sie stets den Nachweis der erzieherischen Notwendigkeit der Dauer.
Wie kann ich mich erfolgreich gegen die richterliche Diagnose schädlicher Neigungen verteidigen?
Die wichtigste Strategie gegen die Diagnose schädlicher Neigungen liegt im Nachweis einer positiven Persönlichkeitsentwicklung seit dem Tattag. Verteidiger müssen aktiv belegen, dass die Straftat ein einmaliger Fehltritt war und keine tief verwurzelte kriminelle Anlage manifestiert. Sie widerlegen die richterliche Argumentation, indem sie soziale Stabilität und die Abwesenheit erheblicher Erziehungsmängel vor der Tat dokumentieren.
Richter müssen aktiv feststellen, ob die negative Zukunftsprognose zum Zeitpunkt des Urteils überhaupt noch zutrifft. Entscheidend ist hier die sogenannte Hafrissprobe. Das Gericht muss belegen, dass weder der natürliche Reifungsprozess noch die erzieherischen Wirkungen einer Untersuchungshaft die vermuteten Mängel bereits beseitigt haben. Die Verteidigung verlangt, dass die positive Entwicklung des Jugendlichen seit der Tat umfassend in die Beurteilung einfließt.
Sie greifen fehlerhafte richterliche Interpretationen normaler Lebensumstände gezielt an. Konkret: Merkmale wie fehlendes eigenes Einkommen oder ein Berufsschulwechsel dürfen nicht pauschal als tiefe Mängel gewertet werden. Das Gericht begeht einen Rechtsfehler, wenn es nicht detailliert begründet, warum diese Umstände auf eine verfestigte Fehlentwicklung hinweisen. Betonen Sie, dass die Straftat ein isolierter Fehltritt bleibt, solange die kausale Verbindung zu tiefgreifenden Erziehungsmängeln fehlt.
Fordern Sie umgehend alle aktuellen Berichte über das Verhalten und die Sozialisierung des Jugendlichen von Jugendamt und JVA an, um die positive Entwicklung als zentralen Gegenbeweis zu nutzen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Erziehungsgedanke
Der Erziehungsgedanke ist das oberste Prinzip im gesamten Jugendstrafrecht und stellt die zukünftige positive Entwicklung des jungen Täters über die bloße Sühne der begangenen Tat. Das Gesetz (§ 18 Abs. 2 JGG) zielt darauf ab, die Strafmaßnahme ausschließlich danach auszurichten, welche Dauer oder Intensität notwendig ist, um erzieherisch auf den Jugendlichen einzuwirken und künftige Straftaten zu verhindern.
Beispiel: Das Oberlandesgericht Hamm monierte, dass das Amtsgericht den entscheidenden Erziehungsgedanken nur mit einer formelhaften Floskel erwähnte, anstatt ihn in den Mittelpunkt der Strafzumessung zu stellen.
Hafrissprobe
Juristen nennen die Hafrissprobe die zwingende Prüfung, ob die erzieherischen Wirkungen einer Untersuchungshaft oder der natürliche Reifungsprozess die zuvor festgestellten schädlichen Neigungen bereits abgebaut haben. Dieses Verfahren stellt sicher, dass die negative Zukunftsprognose nicht auf veralteten Annahmen beruht, sondern zum Zeitpunkt des Urteils noch zutrifft, da eine Jugendstrafe nur bei akuter Gefahr weiterer Straftaten zulässig ist.
Beispiel: Im vorliegenden Fall kritisierte das OLG Hamm, dass das Amtsgericht die Hafrissprobe völlig ignorierte und die einschneidende Wirkung der zweimonatigen Untersuchungshaft nicht in seine Prognose über schädliche Neigungen einbezog.
Jugendstrafe
Eine Jugendstrafe ist die schwerwiegendste Sanktion im Jugendstrafrecht, bei der eine Freiheitsstrafe nur verhängt werden darf, wenn die Schwere der Schuld sie erfordert oder wenn sogenannte schädliche Neigungen vorliegen. Die Vorschrift in § 17 Abs. 2 JGG setzt eine extrem hohe Hürde für eine solche Strafe, denn sie dient primär der erzieherischen Einwirkung und darf keinesfalls eine reine Vergeltung (Sühne) für die begangene Straftat darstellen.
Beispiel: Das Amtsgericht verurteilte den jugendlichen Autodieb zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung, weil es annahm, dass die professionelle Tat auf tief sitzende schädliche Neigungen zurückzuführen war.
Revisionssicher
Ein Urteil gilt als revisionssicher, wenn es keine formellen oder materiellen Rechtsfehler aufweist, die eine Überprüfung durch ein höheres Gericht (wie das OLG oder den BGH) zur Aufhebung oder Änderung führen würden. Die Revisionssicherheit erzwingt eine akribische und lückenlose Begründung der Entscheidung durch das erstinstanzliche Gericht, insbesondere im sensiblen Jugendstrafrecht, wo der Erziehungsgedanke dominieren muss.
Beispiel: Da das Amtsgericht die Annahme schädlicher Neigungen nicht ausreichend begründet hatte und der Erziehungsgedanke fehlte, war das Urteil gegen den Jugendlichen nicht revisionssicher und wurde vom OLG Hamm aufgehoben.
Schädliche Neigungen
Schädliche Neigungen sind juristisch definiert als erhebliche Anlage- oder Erziehungsmängel, die bereits vor der Tat bestanden haben und so tiefgreifend sind, dass ohne längere, gezielte Einwirkung die Gefahr weiterer Straftaten besteht. Diese Diagnose nach § 17 Abs. 2 JGG ist der entscheidende Gradmesser dafür, ob ein jugendlicher Fehltritt eine intensive erzieherische Maßnahme wie die Jugendstrafe erfordert oder ob andere, mildere Mittel ausreichen.
Beispiel: Die Richter in Hamm stellten klar, dass das Amtsgericht nicht allein aus dem Anwerben eines Mittäters auf schädliche Neigungen schließen durfte, da dafür konkrete Persönlichkeitsmängel in der Vorgeschichte des Jugendlichen hätten belegt werden müssen.
Das vorliegende Urteil
Oberlandesgericht Hamm – Az.: 4 ORs 107/25 – Beschluss vom 21.08.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.