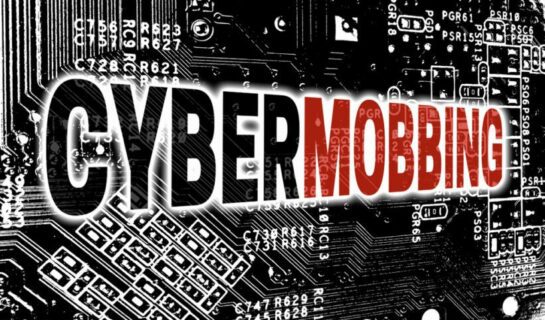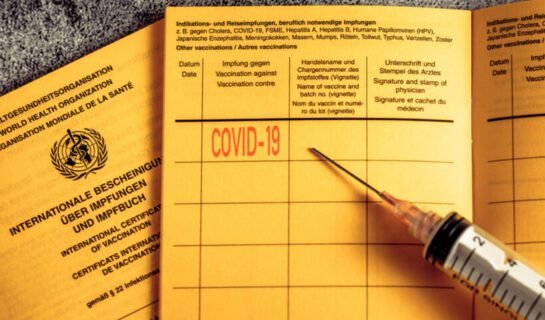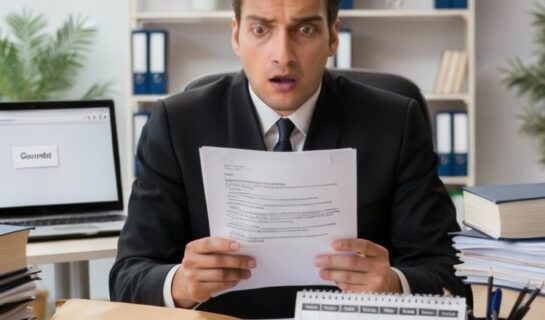Ein verurteilter Straftäter beantragte die Zurückstellung der Strafvollstreckung für eine stationäre Drogentherapie, doch die Justizbehörden verweigerten die Zustimmung pauschal. Nun muss geprüft werden, ob diese mangelhafte Begründung ausreicht, um die gesamte Haftstrafe unterbrechen zu lassen.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Warum ist die Zurückstellung der Strafvollstreckung für eine Drogentherapie mehr als nur ein Gnadenakt?
- Was genau war passiert?
- Welche Gesetze spielten hier die entscheidende Rolle?
- Warum entschied das Gericht so – und nicht anders?
- Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Experten Kommentar
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wie lange darf meine Haftstrafe maximal sein für die Zurückstellung zur Drogentherapie?
- Welche konkreten Dokumente brauche ich, um meine Therapiewilligkeit nach § 35 BtMG zu beweisen?
- Was ist ein Ermessensfehler und wann ist die Ablehnung meines Therapieantrags rechtswidrig?
- Was kann ich tun, wenn die Staatsanwaltschaft meinen Antrag nur formal ablehnt?
- Welche Rechtsmittel gibt es gegen die Verweigerung der gerichtlichen Zustimmung zur Therapie?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 203 VAs 198/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Bayer Oberstes Landesgericht
- Datum: 23.09.2025
- Aktenzeichen: 203 VAs 198/25
- Verfahren: Gerichtliche Entscheidung über Zurückstellung der Strafvollstreckung
- Rechtsbereiche: Strafvollstreckung; Drogentherapie; Verfahrenskontrolle
- Das Problem: Ein verurteilter Straftäter wollte seine Haftstrafe zugunsten einer qualifizierten Drogentherapie unterbrechen. Die zuständige Staatsanwaltschaft und das Landgericht lehnten diesen Antrag ab. Der Verurteilte legte Beschwerde beim Obersten Landesgericht ein, um die Ablehnung überprüfen zu lassen.
- Die Rechtsfrage: Darf die Haftstrafe für eine Drogentherapie aufgeschoben werden, wenn die Justizbehörden die Ablehnung nicht ausreichend begründen? Hat das Gericht den Fall vollständig und korrekt geprüft?
- Die Antwort: Ja. Die vorherigen Entscheidungen, welche die Therapie-Zurückstellung ablehnten, waren fehlerhaft und wurden aufgehoben. Die Ablehnung durch das Landgericht war nicht ausreichend begründet und zeigte Ermessensfehler. Die Justiz muss den Antrag nun unter Beachtung der Rechtsauffassung des Obersten Landesgerichts neu entscheiden.
- Die Bedeutung: Justizbehörden dürfen Anträge auf Zurückstellung der Haftstrafe zugunsten einer Drogentherapie nicht pauschal ablehnen. Sie müssen den aktuellen Sachverhalt vollständig ermitteln und eine Ablehnung detailliert begründen. Die Therapiewilligkeit und -fähigkeit des Antragstellers müssen berücksichtigt werden.
Warum ist die Zurückstellung der Strafvollstreckung für eine Drogentherapie mehr als nur ein Gnadenakt?
Das Prinzip „Therapie statt Strafe“ ist eine der humansten und pragmatischsten Errungenschaften des deutschen Betäubungsmittelrechts. Es erkennt an, dass Sucht eine Krankheit ist und die Kriminalität, die aus ihr erwächst, oft nur ein Symptom.
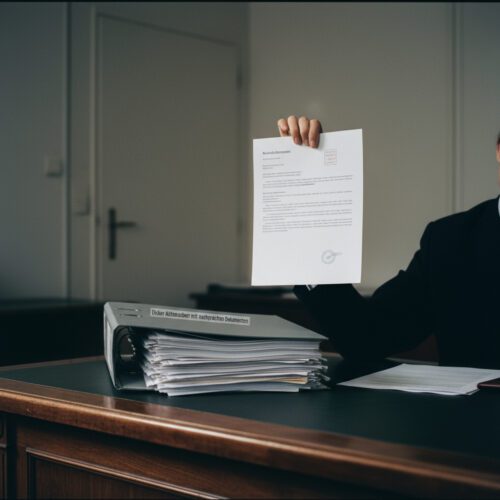
Doch was geschieht, wenn ein Verurteilter diesen Weg beschreiten will, die Justiz ihm aber die Tür versperrt? An welchem Punkt wird die Ablehnung eines Therapieantrags zu einer rechtswidrigen Ermessensüberschreitung? Ein Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts (BayObLG) vom 23. September 2025 (Az. 203 VAs 198/25) beleuchtet eindrucksvoll die strengen Anforderungen, die an die Begründung einer solchen Ablehnung zu stellen sind. Er erzählt die Geschichte eines Kampfes um eine zweite Chance und definiert die Grenzen der richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Entscheidungsmacht.
Was genau war passiert?
Ein Mann wurde wegen verschiedener Betäubungsmitteldelikte rechtskräftig zu mehreren Freiheitsstrafen verurteilt. Die Gerichte stellten in beiden Urteilen fest, dass seine Taten auf eine Drogenabhängigkeit zurückzuführen waren. Seit März 2025 verbüßte er die erste Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Direkt im Anschluss sollte er eine Reststrafe aus einer früheren Verurteilung antreten, sodass sein voraussichtliches Haftende auf August 2028 datiert war.
Fest entschlossen, seine Sucht zu überwinden, stellte der Verurteilte über seinen Verteidiger Anträge auf Zurückstellung der Strafvollstreckung nach § 35 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG). Sein Ziel: die Haftstrafe zu unterbrechen, um eine stationäre Drogentherapie anzutreten. Doch sein Antrag stieß auf eine Wand des Widerstands. Die zuständige Staatsanwaltschaft lehnte ab. Die Begründung war formaler Natur: Das für die Zustimmung zuständige Gericht – in diesem Fall das Landgericht Bayreuth – habe sein Einverständnis verweigert. Ohne diese Zustimmung könne die Staatsanwaltschaft nicht handeln.
Der Verurteilte legte Beschwerde ein. Diese wurde vom Generalstaatsanwalt zurückgewiesen. In seiner Begründung führte dieser an, dass dem Mann die Therapiefähigkeit fehle. Der Kampf ging in die nächste Instanz. Der Mann beantragte beim Bayerischen Obersten Landesgericht eine gerichtliche Entscheidung, welche die fehlende Zustimmung ersetzen und den Weg in die Therapie ebnen sollte. Während dieses Verfahrens lief, arbeitete sein Verteidiger unermüdlich weiter. Er legte Schriftsätze vor, die die Therapiewilligkeit und -fähigkeit seines Mandanten untermauerten, und schaffte es schließlich, die entscheidenden Dokumente nachzureichen: eine Zusage für einen Therapieplatz in einer Fachklinik und die Bestätigung der Kostenübernahme durch die Krankenkasse, beide datiert auf den 12. September 2025. Damit lag der Fall nun vollständig auf dem Tisch des höchsten bayerischen Gerichts.
Welche Gesetze spielten hier die entscheidende Rolle?
Um die Entscheidung des Gerichts nachzuvollziehen, muss man das Zusammenspiel zweier zentraler rechtlicher Regelwerke verstehen.
Das Herzstück des Falles ist § 35 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG). Diese Vorschrift ermöglicht es, die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren zurückzustellen, wenn die Tat aufgrund einer Betäubungsmittelabhängigkeit begangen wurde. Der Verurteilte muss sich dann einer Behandlung seiner Sucht unterziehen. Der Gedanke dahinter ist, die Ursache der Kriminalität – die Sucht – zu bekämpfen, anstatt nur ihre Symptome – die Straftaten – zu bestrafen. Die Entscheidung trifft die Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde, sie benötigt jedoch die Zustimmung des Gerichts, das die ursprüngliche Verurteilung ausgesprochen hat (§ 35 Abs. 2 BtMG).
Da der Verurteilte mit den Entscheidungen der Staatsanwaltschaft und des Generalstaatsanwalts nicht einverstanden war, kam das Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG) ins Spiel. Die Paragraphen 23 ff. EGGVG geben Bürgern ein mächtiges Werkzeug an die Hand: Sie können damit bestimmte Maßnahmen der Justizverwaltung – wie hier die Ablehnung der Strafzurückstellung – von einem höheren Gericht auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen lassen. Dieses Verfahren dient als rechtsstaatliche Kontrolle und sichert ab, dass Behördenentscheidungen nicht willkürlich ergehen. Das BayObLG prüfte also nicht, ob der Mann ein „guter“ oder „schlechter“ Kandidat für eine Therapie ist, sondern ausschließlich, ob die Ablehnung durch die unteren Instanzen auf einer sauberen rechtlichen und tatsächlichen Grundlage beruhte.
Warum entschied das Gericht so – und nicht anders?
Der Senat des Bayerischen Obersten Landesgerichts hob die ablehnenden Entscheidungen auf und wies den Fall zur erneuten Prüfung an die Vorinstanzen zurück. Die Richter ersetzten die Entscheidung nicht selbst, sondern fungierten als Kontrollinstanz, die den Entscheidungsprozess auf schwere Fehler überprüfte – und fündig wurde. Die Begründung des Gerichts lässt sich in drei Kernargumente zerlegen.
Die pauschale Ablehnung: Ein unzureichend begründeter Ermessensfehler
Das Landgericht Bayreuth hatte seine Zustimmung zur Therapie mit einem einzigen Satz verweigert: Der weitere Vollzug der Freiheitsstrafe sei „in der Gesamtschau aller Umstände geboten“. Für das BayObLG war diese Begründung in keiner Weise ausreichend. Eine solch pauschale Floskel lässt nicht erkennen, welche konkreten Umstände das Gericht überhaupt geprüft und gegeneinander abgewogen hat. Hat es die positive Entwicklung des Verurteilten in der Haft berücksichtigt? Welche Prognose hat es für den Therapieerfolg gestellt? Warum wog das Interesse an der sofortigen Strafvollstreckung schwerer als die Chance auf eine erfolgreiche Resozialisierung durch eine Therapie?
Indem das Landgericht seine Abwägung nicht offenlegte, beging es einen Ermessensfehler. Die Entscheidung war nicht nachvollziehbar und damit für eine höhere Instanz nicht überprüfbar. Nach § 28 Abs. 3 EGGVG ist eine solche auf einem unvollständig ermittelten Sachverhalt oder einer mangelhaften Begründung basierende Entscheidung rechtswidrig. Sie verletzt den Antragsteller in seinen Rechten.
Die formale Haltung der Staatsanwaltschaft: Kein Schutzschild bei fehlerhafter Grundlage
Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Ablehnung damit begründet, dass die notwendige gerichtliche Zustimmung fehle. Auf den ersten Blick scheint dies logisch und formal korrekt. Das BayObLG stellte jedoch klar, dass sich eine Behörde nicht hinter einer offensichtlich fehlerhaften Gerichtsentscheidung verstecken kann. Wenn die Grundlage – hier die unzureichend begründete Verweigerung der Zustimmung durch das Landgericht – mangelhaft ist, dann ist auch die darauf aufbauende Entscheidung der Staatsanwaltschaft fehlerhaft. Die Staatsanwaltschaft hätte die Mängel der gerichtlichen Entscheidung erkennen und auf eine heilbare, nachvollziehbare Begründung hinwirken müssen, anstatt den Antrag allein aus formalen Gründen abzulehnen.
Die entkräfteten Gegenargumente: Wie sich die Faktenlage im Verfahren änderte
Die Generalstaatsanwaltschaft hatte im Laufe des Verfahrens verschiedene inhaltliche Argumente gegen eine Therapie vorgebracht. Zunächst wurde die generelle Therapiefähigkeit des Mannes in Zweifel gezogen. Später wurde argumentiert, der Antrag sei ohnehin unbegründet, da keine konkrete Therapieplatz- und Kostenzusage vorliege.
Genau hier zeigte sich die Hartnäckigkeit des Verurteilten und seines Verteidigers als entscheidend. Durch das Nachreichen der Klinikzusage und der Kostenübernahmeerklärung der Krankenkasse war das letzte Argument der Generalstaatsanwaltschaft schlicht vom Tisch. Die Faktenlage hatte sich zugunsten des Antragstellers verändert. Das Gericht machte deutlich, dass Entscheidungen über eine Therapie auf der aktuellen Sachlage basieren müssen. Einwände, die durch neue Entwicklungen widerlegt werden, können eine Ablehnung nicht mehr tragen. Eine pauschale „Hilfsüberlegung“ der Generalstaatsanwaltschaft, die auf eine frühere Maßregel im Vollzug abzielte, wurde ebenfalls als unzureichend verworfen, da sie die jüngste Entwicklung des Antragstellers völlig außer Acht ließ.
Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?
Dieser Fall ist weit mehr als eine Einzelfallentscheidung. Er formuliert grundlegende Prinzipien für den Umgang der Justiz mit dem Anspruch auf „Therapie statt Strafe“ und verdeutlicht die Rechte von Verurteilten in diesem Prozess.
Die erste und wichtigste Lehre ist die unbedingte Notwendigkeit einer transparenten und nachvollziehbaren Begründung. Wenn ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft eine existenzielle Entscheidung wie die Ablehnung einer Therapie trifft, muss sie ihre Gedankengänge offenlegen. Pauschale Floskeln und nicht belegte Behauptungen reichen nicht aus. Diese strenge Begründungspflicht ist kein Formalismus, sondern ein Kernstück des Rechtsstaats. Sie schützt den Einzelnen vor Willkür und stellt sicher, dass die Behörden ihren Beurteilungsspielraum nicht überschreiten, sondern auf der Grundlage sorgfältig ermittelter Fakten entscheiden.
Zweitens zeigt der Beschluss, dass der Weg zur Therapie ein dynamischer Prozess ist. Ein „Nein“ ist nicht zwangsläufig das letzte Wort. Die Argumente der Justiz, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht noch stichhaltig waren, können durch neue Entwicklungen entkräftet werden. Wer als Antragsteller aktiv bleibt, Nachweise erbringt und seine Therapiewilligkeit und -fähigkeit konkret belegt – wie hier durch die Organisation eines Therapieplatzes und der Kostenzusage –, kann die Faktenlage entscheidend zu seinen Gunsten verändern. Die Justiz ist verpflichtet, diese neuen Tatsachen in ihre Entscheidung einzubeziehen.
Schließlich unterstreicht das Urteil die Bedeutung der gerichtlichen Kontrolle als letztes Korrektiv. Selbst wenn sich Staatsanwaltschaft und Gerichte in ihrer ablehnenden Haltung einig sind, bietet das Verfahren nach dem EGGVG eine wirksame Möglichkeit, diesen Konsens aufzubrechen und die Entscheidungen auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Es sichert den Anspruch des Einzelnen, dass nicht nur eine Entscheidung getroffen wird, sondern eine, die den strengen Maßstäben des Gesetzes und den Grundsätzen eines fairen Verfahrens genügt.
Die Urteilslogik
Die Anwendung des Grundsatzes „Therapie statt Strafe“ erfordert von der Justiz eine lückenlose Darlegung der Entscheidungsgründe und verbietet jede pauschale Ablehnung.
- Transparenz schützt vor Willkür: Justizbehörden müssen ihre Ermessensentscheidung detailliert begründen und exakt darlegen, welche konkreten Umstände das Interesse an sofortiger Strafvollstreckung schwerer wiegen lassen als die Resozialisierungschance durch eine Entziehungsbehandlung.
- Fakten schaffen neue Rechtslagen: Ein Verurteilter widerlegt Ablehnungsgründe aktiv, indem er seine Therapiewilligkeit durch konkrete Zusage eines Therapieplatzes und gesicherte Kostenübernahme beweist; die Justiz hat diese neuen Tatsachen zwingend in ihre Entscheidung einzubeziehen.
- Kontrolle verhindert Fehlerketten: Eine Vollstreckungsbehörde darf sich nicht hinter einer formal unzureichend begründeten Gerichtsentscheidung verschanzen, sondern muss die Mangelhaftigkeit der Grundlage erkennen und auf eine rechtmäßige, nachvollziehbare Begründung hinwirken.
Der Rechtsstaat sichert durch strenge Begründungspflichten und gerichtliche Kontrollmechanismen ab, dass behördliche Entscheidungen über existenzielle Rechte nicht willkürlich erfolgen dürfen.
Benötigen Sie Hilfe?
Wurde die Zurückstellung der Strafvollstreckung für eine Therapie fehlerhaft abgelehnt? Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche erste Klärung Ihres Falles.
Experten Kommentar
Der Grundsatz „Therapie statt Strafe“ ist juristisch oft nur so stark, wie die Begründung, mit der er abgelehnt wird. Das BayObLG zieht hier eine klare rote Linie und stellt klar: Die Justiz darf einen Antrag nach § 35 BtMG nicht einfach mit einer pauschalen Floskel abtun; sie muss nachvollziehbar darlegen, warum die sofortige Strafe schwerer wiegt als die Chance auf Resozialisierung. Für Verurteilte bedeutet das Urteil eine strategische Vorgabe: Wer aktiv bleibt, aktuelle Nachweise für Therapieplatz und Kostenübernahme liefert, kann die Argumente der Behörden entkräften und sie zur Neubewertung auf Basis der aktuellen Faktenlage zwingen. Es ist eine konsequente Absage an willkürliche oder nur formale Ablehnungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie lange darf meine Haftstrafe maximal sein für die Zurückstellung zur Drogentherapie?
Die gesetzlich festgelegte Obergrenze für die Zurückstellung der Strafvollstreckung zugunsten einer Drogentherapie beträgt zwei Jahre Freiheitsstrafe, basierend auf § 35 Abs. 1 BtMG. Diese Höchstgrenze bezieht sich ausschließlich auf Strafen, deren zugrundeliegende Taten nachweislich kausal auf Ihre Betäubungsmittelabhängigkeit zurückzuführen sind. Die Addition Ihrer gesamten theoretischen Haftzeit, inklusive alter oder nicht-suchtbedingter Urteile, ist für diese Berechnung nicht relevant.
Die Regel dient dem Prinzip „Therapie statt Strafe“, um eine erfolgreiche Resozialisierung zu ermöglichen. Wurden Sie wegen mehrerer Taten in verschiedenen Verfahren verurteilt, muss Ihr Verteidiger genau prüfen, welche Einzelstrafen für die Therapie zurückgestellt werden können. Eine Gesamtfreiheitsstrafe, die nominell über der Zwei-Jahres-Grenze liegt, schließt die Zurückstellung nicht automatisch aus, wenn die Strafe aus mehreren, voneinander abgrenzbaren Urteilen oder Strafteilen besteht. Der Fokus liegt stets auf der strafbaren Handlung, die durch die Sucht verursacht wurde.
Konkret: Wenn Sie etwa 25 Monate Haft verbüßen müssen, diese aber aus einer suchtspezifischen Strafe von 20 Monaten und einer nicht suchtspezifischen Reststrafe bestehen, kann die Vollstreckung der 20 Monate dennoch zurückgestellt werden. Die Therapiechance entfällt nur, wenn das Gericht wegen der Schwere des Delikts eine besondere Sicherung der Allgemeinheit für dringend notwendig hält. Diese Abwägung muss die Justiz transparent begründen.
Sichten Sie die rechtskräftigen Urteile und lassen Sie präzise ermitteln, welcher Teil der Gesamtstrafe im Urteil explizit der Suchtmittelabhängigkeit zugeordnet wurde.
Welche konkreten Dokumente brauche ich, um meine Therapiewilligkeit nach § 35 BtMG zu beweisen?
Die bloße Absichtserklärung, eine Therapie beginnen zu wollen, reicht der Justiz selten aus, um die Strafvollstreckung nach § 35 BtMG zurückzustellen. Um die Zweifel der Behörden an Ihrer Therapiewilligkeit zu beseitigen, müssen Sie physisch existierende, verbindliche Nachweise vorlegen. Konkret benötigen Sie zwei entscheidende Dokumente, die die Machbarkeit des Vorhabens garantieren.
Der erste und wichtigste Nachweis ist die konkrete Zusage eines Therapieplatzes durch eine anerkannte Fachklinik. Diese muss zwingend ein voraussichtliches Aufnahmedatum enthalten; eine vage Wartelisten-Position oder ein allgemeines Interesse genügen den Anforderungen nicht. Die Generalstaatsanwaltschaft nutzt fehlende Konkretion oft, um den Antrag als unbegründet abzuweisen. Sie müssen die zeitnahe Durchführbarkeit des Therapievorhabens belegen und die Aufnahmebereitschaft der Klinik dokumentieren.
Als zweites Dokument benötigen Sie die verbindliche Erklärung der Kostenübernahme von Ihrem zuständigen Träger, meist der Kranken- oder Rentenversicherung. Nur damit stellen Sie sicher, dass die Therapie nicht aus finanziellen Gründen scheitert. Die strategische Nutzung dieser Unterlagen ist entscheidend. Selbst wenn die Behörden Ihren Antrag bereits abgelehnt haben, können Sie diese Nachweise im Beschwerdeverfahren nachreichen, um die Faktenlage nachträglich zu ändern.
Rufen Sie sofort Ihre Fachklinik an und bitten Sie um eine schriftliche Bestätigung, die das konkrete Aufnahmedatum explizit vermerkt.
Was ist ein Ermessensfehler und wann ist die Ablehnung meines Therapieantrags rechtswidrig?
Wenn Ihr Therapieantrag abgelehnt wird, weil die Entscheidung nicht nachvollziehbar ist, liegt möglicherweise ein Ermessensfehler vor. Dieser Fehler entsteht, wenn das Gericht seinen Entscheidungsspielraum überschreitet oder entscheidungserhebliche Fakten ignoriert. Eine Entscheidung wird rechtswidrig, wenn das Gericht die Abwägung zwischen Ihrer Resozialisierungschance und dem Interesse an sofortiger Strafvollstreckung nicht transparent offenlegt. Pauschale Begründungen wie „in der Gesamtschau geboten“ sind dafür unzureichend.
Ein Gericht verfügt bei der Entscheidung über die Zurückstellung der Strafe nach § 35 BtMG über einen gewissen Beurteilungsspielraum, das sogenannte Ermessen. Dieses Ermessen ist jedoch nicht grenzenlos, sondern muss gesetzlichen Anforderungen genügen. Das Gericht muss alle relevanten Umstände umfassend prüfen, etwa Ihre positive Entwicklung während der Haft oder die konkrete Therapieplatz-Zusage. Versäumt das Gericht diese notwendige Abwägung oder unterlässt es die Begründung gänzlich, überschreitet es seine Befugnisse. Nur wenn die Begründung fehlt, können höhere Instanzen die Entscheidung nicht auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen.
Die Konsequenz eines solchen Verfahrensfehlers ist juristisch klar definiert. Nach dem § 28 Abs. 3 EGGVG gilt eine gerichtliche Entscheidung als rechtswidrig, sofern sie auf einem unvollständig ermittelten Sachverhalt basiert oder eine mangelhafte Begründung aufweist. Konkret bedeutet das: Das Gericht muss detailliert darlegen, warum die Fortsetzung der Haft schwerer wiegt als Ihr nachgewiesener Therapieerfolg. Wenn stattdessen nur pauschale Floskeln verwendet werden, verletzt die Justiz Sie in Ihren Rechten als Antragsteller.
Analysieren Sie den Ablehnungsbeschluss genau auf solche pauschalen Phrasen und weisen Sie Ihren Anwalt an, diesen Mangel als primären Verfahrensfehler nach § 28 Abs. 3 EGGVG anzugreifen.
Was kann ich tun, wenn die Staatsanwaltschaft meinen Antrag nur formal ablehnt?
Die Staatsanwaltschaft (STA) darf sich nicht hinter einer formalen Ablehnung verstecken, wenn diese auf einer mangelhaften gerichtlichen Entscheidung beruht. Sie handelt nicht als reiner Befehlsempfänger, sondern als Vollstreckungsbehörde. Diese ist verpflichtet, die juristische Qualität ihrer Entscheidungsgrundlage zu prüfen und Mängel zu erkennen. Wenn die STA den Antrag nur mit Verweis auf die fehlende gerichtliche Zustimmung abblockt, ohne die Mängel dieser Zustimmung zu berücksichtigen, ist auch ihre Ablehnung fehlerhaft.
Wenn das Landgericht seine Zustimmung zur Therapie unzureichend oder gar nicht begründet, schafft dies eine Kette von Fehlern. Die darauf aufbauende formale Ablehnung der Staatsanwaltschaft ist damit ebenfalls fehlerhaft. Die Behörde muss die Fehlerhaftigkeit des gerichtlichen Beschlusses erkennen. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung darf sich eine Behörde nicht hinter einer offensichtlich fehlerhaften Gerichtsentscheidung verstecken, um eine inhaltliche Prüfung zu verweigern.
Für Ihre Beschwerde bedeutet dies die Notwendigkeit einer gezielten Angriffsstrategie. Sie dürfen nicht nur die formelle Ablehnung der Staatsanwaltschaft anfechten. Sie müssen vielmehr gleichzeitig den kausalen Fehler des Landgerichts benennen, wie die unzureichende Begründung oder die Missachtung entscheidender Fakten. Nur durch diesen doppelten Angriff durchbrechen Sie die formale Blockade und erzwingen eine inhaltliche Prüfung in der nächsthöheren Instanz.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Anwalt in der Begründung der Beschwerde dezidiert diesen juristischen Grundsatz zitiert, um die formale Blockade aufzuheben.
Welche Rechtsmittel gibt es gegen die Verweigerung der gerichtlichen Zustimmung zur Therapie?
Wenn die Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwalt die Zurückstellung der Strafvollstreckung zur Drogentherapie ablehnen, ist der Kampf nicht verloren. Das maßgebliche Rechtsinstrument in dieser Phase ist der Antrag auf gerichtliche Entscheidung. Dieser ist in den Paragraphen 23 ff. des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG) geregelt. Dieses Verfahren ermöglicht die Überprüfung der behördlichen Entscheidung durch ein übergeordnetes Gericht, das als letztes Korrektiv fungiert.
Nachdem die unteren Justizbehörden den Antrag zurückgewiesen haben, dient das EGGVG als letzte Kontrollinstanz. Das Obergericht, beispielsweise ein Oberlandesgericht oder das Bayerische Oberste Landesgericht, prüft dabei nicht inhaltlich Ihre Therapiefähigkeit. Es konzentriert sich ausschließlich auf die Rechtmäßigkeit der vorangegangenen Ablehnung. Die Richter kontrollieren, ob die Vorinstanzen ihre Entscheidung auf einer vollständig ermittelten Tatsachengrundlage getroffen haben oder ob ein Ermessensfehler vorliegt, etwa eine unzureichende Begründung.
Nutzen Sie dieses Verfahren strategisch, um die Ablehnung aktiv anzugreifen und nicht nur alte Argumente zu wiederholen. Das EGGVG-Verfahren ist die letzte juristische Möglichkeit, neue und entscheidende Fakten vorzulegen. Da die Justiz verpflichtet ist, nach der „aktuellen Sachlage“ zu entscheiden, müssen Sie zeitnah Beweise wie die konkrete Zusage eines Therapieplatzes einbringen. Diese Dynamik ermöglicht es, Argumente, die zur ursprünglichen Ablehnung führten, durch nachgereichte Dokumente zu entkräften.
Weisen Sie Ihren Verteidiger an, alle neuen Nachweise und Zusagen explizit als Teil des EGGVG-Antrags zu kennzeichnen, damit das höhere Gericht die aktuelle Sachlage prüfen muss.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Antrag auf gerichtliche Entscheidung
Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist das spezifische Rechtsmittel gegen bestimmte behördliche Entscheidungen der Justizverwaltung, wenn man der Meinung ist, in seinen Rechten verletzt worden zu sein. Dieses Verfahren, geregelt im EGGVG, ermöglicht die Überprüfung, ob behördliche Maßnahmen wie die Ablehnung einer Therapie rechtmäßig getroffen wurden, und dient somit als wichtige Kontrollinstanz.
Beispiel: Nachdem die Staatsanwaltschaft den Antrag auf Zurückstellung der Strafvollstreckung ablehnte, beantragte der Verurteilte beim Bayerischen Obersten Landesgericht eine gerichtliche Entscheidung, um die formale Blockade aufzuheben.
Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG)
Das Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG) enthält die zentralen Vorschriften, die bestimmen, wie Justizverwaltungsakte – also Entscheidungen, die nicht direkt Urteile sind – von einem höheren Gericht auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft werden. Die Paragraphen 23 ff. EGGVG geben Bürgern das nötige Werkzeug an die Hand, um behördliche Willkür zu verhindern; es stellt sicher, dass Entscheidungen der Staatsanwaltschaft oder Gerichte auf einer sauberen rechtlichen Basis stehen.
Beispiel: Das Bayerische Oberste Landesgericht musste gemäß den Vorschriften des EGGVG prüfen, ob die Ablehnung der Strafzurückstellung durch das Landgericht den strengen Anforderungen an eine nachvollziehbare, rechtsstaatliche Begründung genügte.
Ermessensfehler
Juristen nennen das einen Ermessensfehler, wenn eine Behörde oder ein Gericht ihren gesetzlich gewährten Entscheidungsspielraum fehlerhaft nutzt, indem sie etwa entscheidungserhebliche Fakten ignoriert oder die Abwägung nicht nachvollziehbar begründet. Dieser Fehler führt zur Rechtswidrigkeit der Entscheidung, weil das Gesetz die Justiz dazu verpflichtet, alle relevanten Umstände umfassend und transparent gegeneinander abzuwägen.
Beispiel: Das Landgericht Bayreuth beging einen klaren Ermessensfehler, weil es die Verweigerung der gerichtlichen Zustimmung zur Therapie lediglich pauschal mit der Floskel „in der Gesamtschau aller Umstände geboten“ begründete.
§ 35 Betäubungsmittelgesetz (BtMG)
§ 35 BtMG ist die zentrale Vorschrift im deutschen Betäubungsmittelrecht, die unter bestimmten Voraussetzungen die Zurückstellung der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren zugunsten einer Drogentherapie erlaubt. Der Gesetzgeber verfolgt mit dieser Regelung das pragmatische Prinzip „Therapie statt Strafe“, um die Suchtursache der Kriminalität zu bekämpfen, anstatt nur ihre Symptome zu bestrafen.
Beispiel: Nur weil die dem Urteil zugrundeliegenden Taten des Mannes eindeutig auf seine Betäubungsmittelabhängigkeit zurückzuführen waren, konnte sein Verteidiger überhaupt den Antrag auf Zurückstellung der Strafvollstreckung nach § 35 BtMG stellen.
Vollstreckungsbehörde
Die Vollstreckungsbehörde ist in Deutschland in der Regel die Staatsanwaltschaft, welche die Aufgabe hat, die von den Gerichten verhängten Strafen wie Freiheitsstrafen oder Geldstrafen tatsächlich zu vollziehen und deren formellen Ablauf zu organisieren. Obwohl die Vollstreckungsbehörde formal handelt, muss sie die juristische Qualität ihrer Entscheidungsgrundlage prüfen und darf sich nicht hinter fehlerhaften oder unzureichend begründeten Entscheidungen anderer Instanzen verstecken.
Beispiel: Die zuständige Staatsanwaltschaft lehnte den Therapieantrag zunächst ab, weil sie die fehlende gerichtliche Zustimmung als formale Hürde ansah, obwohl sie als Vollstreckungsbehörde die Mängel in der Begründung des Gerichts hätte erkennen müssen.
Das vorliegende Urteil
BayObLG – Az.: 203 VAs 198/25 – Beschluss v. 23.09.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.