Wenn Ihnen mehrere Straftaten vorgeworfen werden, herrscht oft große Unsicherheit. Genau hier setzt die sogenannte Konkurrenzlehre im Strafrecht an: Sie ist das entscheidende Regelwerk, das über das wahre Ausmaß der Strafe entscheidet. Wenn ein Täter mit nur einer Handlung oder einem Lebenssachverhalt gleich mehrere Gesetze bricht, stellt sich die entscheidende Frage: Handelt es sich um eine Tat oder viele? Diese juristische Weichenstellung hat immense Auswirkungen auf die mögliche Strafe und die Rechtsfolgen. Doch wie wird konkret unterschieden, ob Tateinheit oder Tatmehrheit vorliegt und welche Konsequenzen drohen dann?
Übersicht
- Auf einen Blick
- Eine Tat oder viele? Warum die Einordnung alles entscheidet
- Tateinheit, Tatmehrheit & Co: Was bedeutet das?
- Was genau bedeutet Tateinheit (§ 52 StGB)?
- Wann spricht man von Tatmehrheit (§ 53 StGB)?
- Was sind schwierige Fälle bei der Abgrenzung?
- Wie wirkt sich die Einordnung auf die Strafe aus?
- Fazit: Warum die Konkurrenzlehre so wichtig ist
- Die Grundregeln
- Experten-Einblick
- Benötigen Sie Hilfe?
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was passiert, wenn ich mehrere Straftaten gleichzeitig begehe – wie wird meine Strafe dann bestimmt?
- Zählt mein gesamtes Verhalten als eine einzige Tat, oder werden mehrere Vergehen daraus?
- Wie entscheidet das Gericht, ob mein Handeln als eine oder mehrere Taten gewertet wird?
- Was sind die größten Auswirkungen für meine mögliche Strafe, wenn Tatmehrheit festgestellt wird?
- Gibt es Situationen, in denen die Abgrenzung von Taten besonders schwierig ist und mein Fall kompliziert macht?

Auf einen Blick
- Worum es geht: Es geht darum, wie Gerichte jemanden bestrafen, der mit seinem Verhalten mehrere Gesetze bricht. Zum Beispiel, wenn jemand stiehlt und dabei auch fremdes Eigentum beschädigt. Es regelt, ob all diese Vergehen als eine Tat oder als mehrere gezählt werden, um eine gerechte Gesamtstrafe zu finden.
- Das größte Risiko: Das größte Risiko ist eine deutlich härtere Strafe. Je nachdem, ob die verschiedenen Vergehen als eine oder als mehrere Taten gewertet werden, kann die Freiheitsstrafe oder Geldstrafe viel höher ausfallen. Das beeinflusst die Dauer einer Haftstrafe oder die Höhe der Geldstrafe stark.
- Die wichtigste Regel: Die wichtigste Regel ist, dass das Gericht genau prüft, ob alle Vergehen aus einem einzigen Entschluss entstanden sind oder ob es sich um mehrere voneinander unabhängige Taten handelt. Diese Unterscheidung ist entscheidend dafür, wie die Schuld bewertet und die endgültige Strafe berechnet wird.
- Typische Situationen: Häufig relevant wird das Thema, wenn jemand zum Beispiel in ein Haus einbricht, dabei stiehlt und möglicherweise auch etwas beschädigt. Oder wenn ein Autofahrer betrunken einen Unfall verursacht und dabei jemanden verletzt. Auch das wiederholte Stehlen kleinerer Beträge aus einer Kasse fällt hierunter.
- Erste Schritte: Wenn Sie mit dem Vorwurf konfrontiert sind, mehrere Gesetze gebrochen zu haben, suchen Sie unbedingt sofort rechtlichen Rat. Ein Anwalt kann beurteilen, wie Ihre Handlungen rechtlich eingeordnet werden und welche Strafe droht. Das ist entscheidend für Ihre Verteidigung.
- Häufiger Irrtum: Ein häufiger Irrtum ist, dass man denkt, bei mehreren Vergehen werden die Strafen einfach alle zusammengezählt. Das stimmt nicht, denn das Gesetz hat spezielle Regeln, die entweder zu einer milderen Gesamtstrafe führen können oder aber auch eine deutlich härtere Strafe zur Folge haben.
Eine Tat oder viele? Warum die Einordnung alles entscheidet
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Eine Person bricht nachts in ein Haus ein, stiehlt Schmuck und flieht anschließend betrunken mit dem Auto. Sie hat damit mindestens drei Gesetze gebrochen: schwerer Diebstahl, Hausfriedensbruch und Trunkenheit im Verkehr. Doch wie bestraft das Gericht diese Person nun? Addiert es einfach die Strafen für alle drei Delikte? Oder fasst es sie zu einer einzigen Strafe zusammen? Und wenn ja, nach welchen Regeln?
Diese Fragen führen direkt ins Zentrum eines der komplexesten Gebiete des deutschen Strafrechts: der Konkurrenzlehre. Sie ist das Regelwerk, das bestimmt, wie der Staat reagiert, wenn ein Täter durch sein Verhalten gleich mehrere Gesetze bricht. Es geht um die zentrale Frage der Gerechtigkeit: Stellt das Recht sicher, dass die finale Strafe das gesamte begangene Unrecht widerspiegelt, ohne den Täter für dieselbe Schuld mehrfach zu bestrafen? Das Verbot der Doppelbestrafung (ne bis in idem) verbietet zwar, jemanden für eine bereits abgeurteilte Tat erneut vor Gericht zu stellen. Die Konkurrenzlehre löst jedoch ein anderes Problem: Sie klärt, wie mehrere Straftaten innerhalb eines einzigen Verfahrens zu einer gerechten Gesamtstrafe zusammengeführt werden.
Sie entscheidet also über den wichtigsten Teil des Urteils: das Strafmaß. Ob eine Handlung als eine Tat oder als mehrere selbstständige Taten gewertet wird, hat immense Auswirkungen auf die Strafzumessung, die Verjährung und sogar auf prozessuale Fragen. Die Konkurrenzlehre ist keine trockene akademische Übung – sie ist das entscheidende Instrument, das am Ende über die Höhe einer Freiheitsstrafe entscheidet.
Welche Rolle spielt die Verjährung bei der Einordnung?
Eine oft übersehene, aber entscheidende Folge dieser Einordnung betrifft die Verjährung: die Frage, ob eine Tat überhaupt noch bestraft werden kann. Die Frage, ob eine Tat noch verfolgt werden kann, hängt direkt davon ab, ob Tateinheit oder Tatmehrheit vorliegt:
Bei Tateinheit (§ 52 StGB) gilt
Entgegen einer verbreiteten Annahme gilt bei Tateinheit nicht pauschal die Verjährungsfrist des schwersten Delikts für die gesamte Tat. Stattdessen läuft nach ständiger Rechtsprechung für jede tateinheitlich verwirklichte Gesetzesverletzung eine eigene, separate Verjährungsfrist. Die gesamte Tat kann daher erst dann nicht mehr verfolgt werden, wenn auch das letzte der verwirklichten Delikte für sich betrachtet verjährt ist.
Bei Tatmehrheit (§ 53 StGB) gilt
Da jede Handlung eine eigenständige Tat darstellt, beginnt für jede Tat eine eigene, separate Verjährungsfrist zu laufen. Dies war der entscheidende Grund, warum der BGH die Figur der „fortgesetzten Tat“ aufgab. Bei einer Serie von Diebstählen über Monate hinweg kann es also sein, dass die früheren Taten bereits verjährt sind, während die späteren noch verfolgbar sind.
Konsequenzen der Rechtsprechungsänderung 2024
Die Änderung bei Vereinigungsdelikten wirkt sich ebenfalls auf die Verjährung aus. Wird eine Vielzahl von Einzeltaten nun als eine einzige tatbestandliche Handlungseinheit bewertet, beginnt die Verjährungsfrist für das gesamte Geschehen erst mit der letzten Beteiligungshandlung. Dies war einer der Gründe, warum der BGH ursprünglich 2015 eine restriktivere Linie eingeschlagen hatte. Mit dieser neueren Rechtsprechung legt der BGH mehr Wert auf eine einheitliche rechtliche Bewertung als auf mögliche Probleme bei der Verjährung.
Praktisches Beispiel: Ein Täter begeht am 01.01. einen Betrug (Verjährung 5 Jahre) und im selben Zuge eine Urkundenfälschung (Verjährung ebenfalls 5 Jahre). Bewertet das Gericht dies als Tateinheit, müssen beide Delikte einzeln betrachtet werden; die Tat als Ganzes ist erst verjährt, wenn beide Delikte verjährt sind (also nach 5 Jahren). Begeht er den Betrug aber am 01.01. und die Urkundenfälschung als separate Handlung am 01.06., liegt Tatmehrheit vor. Der Betrug verjährt dann bereits fünf Monate vor der Urkundenfälschung. Für die Verteidigung ist diese Unterscheidung daher entscheidend.
Tateinheit, Tatmehrheit & Co: Was bedeutet das?

Um diesen Unterschied sofort greifbar zu machen, stellen Sie sich zwei Arten von Einkäufen vor:
- Tateinheit (entspricht einem Einkauf): Sie gehen durch den Supermarkt, legen fünf verschiedene Dinge in Ihren Wagen und bezahlen alles zusammen an der Kasse. Rechtlich gesehen war das ein Kaufvorgang.
- Tatmehrheit (entspricht mehreren Einkäufen): Sie kaufen eine Flasche Wasser und bezahlen. Draußen bemerken Sie, dass Sie Brot vergessen haben, gehen wieder hinein und bezahlen das Brot in einem zweiten, getrennten Vorgang. Das waren zwei Kaufvorgänge.
Behalten Sie dieses simple Bild im Kopf. Die Konkurrenzlehre unterscheidet nach demselben Prinzip, ob ein Täter rechtlich gesehen „einmal oder zweimal an der Kasse war“.
Der Begriff „Konkurrenz“ beschreibt im Strafrecht die Situation, in der ein Täter durch sein Verhalten gegen mehrere Strafgesetze verstößt. Der Gesetzgeber hat dafür eine grundlegende Unterscheidung geschaffen, die das gesamte System trägt: die zwischen Tateinheit (§ 52 StGB) und Tatmehrheit (§ 53 StGB).
Was ist Gesetzeskonkurrenz und welche Formen gibt es?
Vor der Prüfung von Tateinheit und Tatmehrheit muss jedoch immer geklärt werden, ob nicht ein Gesetz ein anderes verdrängt. Diese sogenannte Gesetzeskonkurrenz ist eine Vorstufe und führt dazu, dass nur ein Tatbestand zur Anwendung kommt. Die drei wichtigsten Formen sind:
- Spezialität: Das speziellere Gesetz verdrängt das allgemeinere. Der schwere Raub (§ 250 StGB) enthält alle Merkmale des einfachen Raubes (§ 249 StGB) und zusätzlich ein strafverschärfendes Detail (wie das Mitführen einer Waffe). Der Täter wird daher nur wegen schweren Raubes verurteilt.
- Subsidiarität: Ein Gesetz tritt nur dann zurück, wenn ein anderes, schwerwiegenderes Gesetz eingreift. Dies ist oft ausdrücklich im Gesetz vermerkt (formelle Subsidiarität) oder ergibt sich aus dem Sinn und Zweck der Normen (materielle Subsidiarität). So ist der Versuch immer subsidiär zur vollendeten Tat. Wer einen Diebstahl vollendet, wird nicht zusätzlich wegen des Versuchs bestraft.
- Konsumtion: Ein Delikt wird durch ein anderes „mitverzehrt“, weil es typischerweise bei dessen Begehung mitverwirklicht wird und das Unrecht dieser Nebentat im Vergleich zur Haupttat kaum noch eine Rolle spielt. Der klassische Fall ist die Sachbeschädigung an einem Fenster beim Einbruchdiebstahl. Der Unrechtsgehalt des aufgehebelten Fensters wird durch die Verurteilung wegen des schweren Diebstahls bereits miterfasst und abgegolten.
Nur wenn nach dieser Prüfung mehrere Delikte übrigbleiben, die durch eine natürliche Handlungseinheit verbunden sind, liegt echte Tateinheit vor.
Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Formen folgt einem zentralen Gedanken des Strafrechts, dem Schuldprinzip. Die Strafe soll die individuelle Schuld des Täters widerspiegeln. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es einen Unterschied macht, ob jemand aus einem einzigen Willensentschluss heraus handelt und dabei zufällig mehrere Gesetze verletzt, oder ob er sich mehrfach hintereinander bewusst dazu entschließt, kriminell zu handeln. Wer sich mehrmals zu einer Straftat entschließt, zeigt eine größere kriminelle Entschlossenheit und wird daher härter bestraft. Tateinheit und Tatmehrheit sind die Werkzeuge, um diese unterschiedliche Schuld in ein gerechtes Strafmaß umzurechnen.
Was genau bedeutet Tateinheit (§ 52 StGB)?
Die Tateinheit, geregelt in § 52 StGB, ist der Fall, in dem der Täter „durch dieselbe Handlung“ mehrere Strafgesetze verletzt oder dasselbe Strafgesetz mehrfach bricht. Der Täter handelt nur einmal, erzielt aber sozusagen mehrere strafrechtliche Treffer.
Was ist das Kriterium für eine „Handlungseinheit“?
Der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Abgrenzung ist der Begriff der „Handlung“. Was genau ist „dieselbe Handlung“? Die Gerichte haben hierfür das Konzept der natürlichen Handlungseinheit entwickelt. Gerichte bewerten ein Verhalten dann als eine einzige Handlung, wenn alle Teilschritte auf einem einzigen Entschluss beruhen. Für Außenstehende muss das gesamte Geschehen wie eine einzige, zusammenhängende Aktion aussehen.
Ein Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht und dabei einen Menschen verletzt, begeht mit einer einzigen Handlung – der Fahrt – zwei Delikte: Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB) und fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB). Er wird nicht für beides getrennt bestraft. Stattdessen stehen die Delikte in Tateinheit.
Damit Gerichte von einer einzigen Handlung ausgehen, müssen mehrere Kriterien erfüllt sein:
- enger zeitlicher Zusammenhang: Die Taten passieren kurz nacheinander.
- enger räumlicher Zusammenhang: Die Taten finden am selben oder an nahegelegenen Orten statt.
- innerer Zusammenhang: Alle Handlungen basieren auf demselben Plan oder Entschluss.
So sah der Bundesgerichtshof (BGH) den Anbau von Cannabis und die anschließende Verarbeitung zu Marihuana als natürliche Handlungseinheit an, weil alles Teil eines einheitlichen, von Anfang an geplanten Produktionsprozesses war (BGH, 2 StR 204/24).
Wann spricht man von Tatmehrheit (§ 53 StGB)?
Die Tatmehrheit, geregelt in § 53 StGB, ist das genaue Gegenteil der Tateinheit. Hier verwirklicht der Täter durch mehrere voneinander unabhängige Handlungen mehrere Straftatbestände. Jede dieser Handlungen stellt ein eigenes kriminelles Kapitel dar.
Die Abgrenzung zur Tateinheit verläuft genau entlang der Frage, ob eine natürliche Handlungseinheit vorliegt oder nicht. Fehlt der enge zeitliche, räumliche und willentliche Zusammenhang, der die Taten zu einer Einheit verklammert, liegen getrennte Taten vor. Der entscheidende Faktor ist oft eine klare Unterbrechung (juristisch „Zäsur“ genannt), die den Zusammenhang zwischen den Taten für einen Moment aufhebt. Fährt ein Betrunkener mit dem Auto, parkt, geht für eine Stunde in eine Bar und fährt dann weiter, liegen zwei getrennte Trunkenheitsfahrten und damit Tatmehrheit vor. Das Parken und der Barbesuch sind eine klare Zäsur.
Was war die „fortgesetzte Tat“ und gilt sie heute noch?
Früher gab es im deutschen Recht eine umstrittene Zwischenfigur: die fortgesetzte Tat. Sie sollte Serienstraftaten – etwa wenn ein Kassierer über Monate hinweg immer wieder kleine Beträge aus der Kasse stiehlt – zu einer einzigen Tat zusammenfassen, wenn alle Einzelakte auf einem einheitlichen Tatentschluss beruhten. Diese Regelung war praktisch, führte aber zu erheblichen rechtlichen Widersprüchen, die schwer zu begründen waren – insbesondere bei der Verjährung, die für die gesamte Serie erst mit dem letzten Diebstahl zu laufen begann.
Im Jahr 1994 zog der Große Senat für Strafsachen des BGH – aus meiner Sicht völlig zu Recht – die Reißleine (GSSt 2/93). Er schaffte die Figur der fortgesetzten Tat weitgehend ab, weil sie keine Grundlage im Gesetz hat und dem Grundsatz widerspricht, dass jeder neue Entschluss zu einer Straftat auch als eine neue, eigenständige Tat gewertet werden muss. Heute werden solche Serienstraftaten daher konsequent als Tatmehrheit behandelt. Jede einzelne Wegnahme ist eine eigenständige Tat, die für sich allein steht und auch für sich allein verjährt.
Was sind schwierige Fälle bei der Abgrenzung?

Ganz ehrlich? In der Praxis ist die Trennung selbst für Juristen oft nicht so einfach. Gerade bei komplexen und lang andauernden Straftaten wird die Abgrenzung zur juristischen Feinarbeit.
Natürliche vs. tatbestandliche Handlungseinheit?
Neben der natürlichen Handlungseinheit, bei der Handlungen für Außenstehende als einheitliches Geschehen wirken, kennt die Rechtsprechung einen zweiten Weg, um Einzelakte zu einer Tat zu verbinden: die tatbestandliche Handlungseinheit.
Von einer tatbestandlichen Handlungseinheit spricht man, wenn bereits der Gesetzestatbestand selbst mehrere, eigentlich getrennte Handlungen zu einer einzigen Tat zusammenfasst, die dann auch so bewertet wird. Die wichtigsten Fälle sind:
- Zusammengesetzte Delikte: Der Raub (§ 249 StGB) ist das klassische Beispiel. Er verbindet zwei separate Handlungen (eine Nötigung und eine Wegnahme) zu einer einzigen Tat. Der Täter wird nur wegen Raubes verurteilt, nicht zusätzlich wegen Nötigung und Diebstahl.
- Mehraktige Delikte: Manche Tatbestände erfordern von vornherein mehrere Akte, wie z.B. die wiederholte Nachstellung beim Stalking (§ 238 StGB). Jeder einzelne Akt ist Teil einer einzigen Tat.
- Dauerdelikte: Delikte wie die Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) bestehen aus dem Herbeiführen eines Zustands und dessen Aufrechterhaltung. Jeder Moment des Festhaltens ist Teil derselben einen Tat.
Diese Unterscheidung ist entscheidend, weil die tatbestandliche Handlungseinheit eine noch stärkere Verbindung schafft als die natürliche. Sie wirkt wie eine gesetzliche „Klammer“ und ist die Grundlage für das Verständnis komplexer Fälle, wie eben der sogenannten „Klammerwirkung“.
Was bedeutet die „Klammerwirkung“ bei Dauerdelikten?
Eine besondere Herausforderung stellen die Dauerdelikte dar, bei denen eine strafbare Handlung über einen längeren Zeitraum andauert, wie bei der Freiheitsberaubung (§ 239 StGB). Begeht der Täter während der andauernden Freiheitsberaubung weitere Delikte (z.B. eine Körperverletzung am Opfer), werden diese oft durch das Dauerdelikt zu einer einzigen Tat im Sinne der Tateinheit verklammert. Man spricht hier von einer Klammerwirkung: Das Dauerdelikt umspannt die einzelnen, während seiner Dauer begangenen Taten und fasst sie zu einer Tateinheit zusammen.
Änderung 2024: Was ist neu bei der Klammerwirkung?
Die Rechtsprechung zur Klammerwirkung bei Vereinigungsdelikten hat sich 2024 grundlegend gewandelt. Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat mit seinem Urteil vom 14. November 2024 (3 StR 189/24) eine fast zehn Jahre währende Rechtsprechungslinie aufgegeben und kehrt zu einer großzügigeren Handhabung der tatbestandlichen Handlungseinheit zurück.
Die alte Rechtsprechung (2015-2024): Seit einem Beschluss aus dem Jahr 2015 (BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – 3 StR 537/14) vertrat der BGH die Auffassung, dass bei der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung (§ 129 und § 129a StGB) nur solche Einzelakte eine tatbestandliche Handlungseinheit bilden, die im Übrigen straflos wären. Beging ein Mitglied im Rahmen seiner Vereinigungstätigkeit jedoch zusätzlich eigenständige Straftaten – etwa einen Raub oder eine Körperverletzung –, sollten diese in Tatmehrheit zum Vereinigungsdelikt stehen. Der BGH begründete dies damit, dass nur „gleichwertige“ Handlungen zusammengefasst werden dürften. Straftaten mit eigenem Unrechtsgehalt seien nicht mehr gleichwertig mit der bloßen Mitgliedschaft.
Die Kehrtwende 2024: Mit der Entscheidung vom 14. November 2024 hat der 3. Strafsenat diese Rechtsprechung ausdrücklich aufgegeben. Der Tatbestand der mitgliedschaftlichen Beteiligung verbindet nun grundsätzlich alle Betätigungen des Mitglieds für die terroristische oder kriminelle Vereinigung rechtlich gesehen zu einer einzigen Tat. Diese eine Tat umfasst dann alles, was das Mitglied für die Vereinigung tut – egal, ob diese Handlungen für sich allein genommen strafbar wären oder nicht. Die anderen Delikte werden durch die mitgliedschaftliche Beteiligung zu Tateinheit verklammert.
Die neue Ausnahme: Eine Ausnahme gibt es nur in seltenen Fällen: Begeht ein Mitglied für die Vereinigung mindestens zwei weitere, besonders schwere Straftaten (z.B. einen Mord und einen schweren Raub), können diese beiden Taten untereinander als separate Taten (Tatmehrheit) gewertet werden. Das Gericht prüft hier, ob das Unrecht dieser Einzeltaten das Unrecht der reinen Mitgliedschaft bei Weitem übersteigt. Die Beweislast dafür liegt deutlich höher als zuvor.
Praktische Bedeutung: Diese Rechtsprechungsänderung hat erhebliche Auswirkungen auf die Strafzumessung in Terrorismus- und Organisierte-Kriminalität-Verfahren. Wo früher mehrere Einzelstrafen zu einer Gesamtstrafe zusammengeführt wurden (mit entsprechend höherer Strafe), kommt nun häufiger das mildere Absorptionsprinzip zur Anwendung. Für die Verteidigung eröffnet dies neue Argumentationslinien, während die Strafverfolgung ihre strategische Anklagegestaltung überdenken muss.
Anklage vs. Urteil: Was ist die prozessuale „Tat“?
Wichtig ist auch, die Konkurrenzlehre vom prozessualen Begriff der ‚Tat“ zu unterscheiden, wie er in der Anklageschrift verwendet wird (§ 264 StPO). Im Prozess meint ‚die Tat‘ den gesamten Vorfall oder Geschehensablauf, der in der Anklageschrift beschrieben wird. Dieser prozessuale Tatbegriff kann weiter sein als der materielle. So kann ein Lebenssachverhalt, der prozessual eine einzige Tat darstellt, materiell-rechtlich durchaus mehrere Taten in Tatmehrheit enthalten.
Wie wirkt sich die Einordnung auf die Strafe aus?
Die korrekte Einordnung als Tateinheit oder Tatmehrheit ist kein Selbstzweck. Sie hat direkte und gravierende Folgen für die Höhe der Strafe.
Strafe bei Tateinheit: Das Absorptionsprinzip
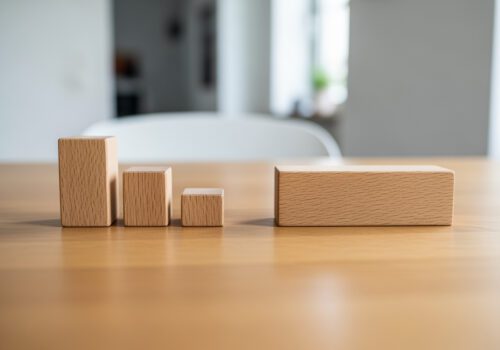
Liegt Tateinheit vor, bildet das Gericht keine Summe aus den Einzelstrafen. Stattdessen wendet es das sogenannte Absorptionsprinzip an (§ 52 Abs. 2 StGB). Das Gericht prüft, welches der verletzten Gesetze die höchste Strafdrohung hat. Nur aus diesem Strafrahmen wird die Strafe entnommen. Das bedeutet: Nur die Strafandrohung des schwersten Delikts wird als Rahmen für die Strafe genutzt. Die anderen, leichteren Delikte werden aber nicht ignoriert, sondern erhöhen die Strafe innerhalb dieses Rahmens.
Beispiel: Der Täter verwirklicht eine gefährliche Körperverletzung (Strafrahmen: 6 Monate bis 10 Jahre) und eine Beleidigung (Strafrahmen: bis zu 1 Jahr). Das Gericht darf die Strafe nur aus dem Strafrahmen der Körperverletzung entnehmen, also zwischen 6 Monaten und 10 Jahren. Die zusätzliche Beleidigung wird es aber dazu bewegen, die Strafe innerhalb dieses Rahmens höher anzusetzen, als es dies bei einer reinen Körperverletzung getan hätte.
Strafe bei Tatmehrheit: Die Gesamtstrafe bilden
Liegt Tatmehrheit vor, ist das Verfahren komplizierter und die Strafe fällt für den Täter in der Regel härter aus. Hier bildet das Gericht eine sogenannte Gesamtstrafe. Dabei werden die Strafen nicht einfach addiert, sondern nach einem besonderen Verschärfungsprinzip (juristisch: Asperationsprinzip) zusammengefügt.
Das funktioniert in drei Schritten:
- Einzelstrafen festlegen: Zuerst bestimmt das Gericht für jede einzelne Tat eine angemessene Strafe, so als würde sie allein verhandelt.
- Höchste Strafe als Basis nehmen: Die höchste dieser Einzelstrafen wird zur Grundlage der weiteren Berechnung.
- Erhöhung der Einsatzstrafe: Die Einsatzstrafe wird nun „angemessen erhöht“, um die anderen Taten zu berücksichtigen. Die Erhöhung muss die weiteren Taten spürbar ahnden, darf aber nicht schematisch erfolgen. Die Gesamtstrafe muss am Ende niedriger sein als die Summe aller Einzelstrafen, aber höher als die Einsatzstrafe.
Dieses System stellt sicher, dass jede einzelne Tat bestraft wird, der Täter aber gleichzeitig einen „Mengenrabatt“ erhält, um eine uferlose Addition von Strafen zu vermeiden.
Wie sieht ein Rechenbeispiel für die Gesamtstrafe aus?
Die abstrakten Schritte der Gesamtstrafenbildung werden an einem Beispiel greifbarer. Stellen Sie sich vor, ein Täter wird für drei voneinander unabhängige Taten (Tatmehrheit) verurteilt:
- Tat 1: Ein Betrug mit einer fiktiven Einzelstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten Freiheitsstrafe.
- Tat 2: Eine Urkundenfälschung mit einer fiktiven Einzelstrafe von 10 Monaten Freiheitsstrafe.
- Tat 3: Eine weitere, minder schwere Urkundenfälschung mit 6 Monaten Freiheitsstrafe.
Die Berechnung der Gesamtstrafe durch das Gericht folgt nun diesen Schritten:
- Einsatzstrafe bestimmen: Die höchste Einzelstrafe ist die für den Betrug. Die Einsatzstrafe beträgt also 1 Jahr und 6 Monate. Dies ist die absolute Untergrenze der zu bildenden Gesamtstrafe.
- Obergrenze berechnen: Die Summe aller Einzelstrafen darf nicht erreicht werden (§ 54 Abs. 2 StGB). Die Summe beträgt: 18 Monate + 10 Monate + 6 Monate = 34 Monate (2 Jahre und 10 Monate). Die Gesamtstrafe muss also zwingend unter diesem Wert liegen.
- Angemessene Erhöhung (Asperation): Nun werden die übrigen Strafen (hier: 10 Monate und 6 Monate) berücksichtigt, indem die Basisstrafe erhöht wird. Es gibt keine feste Formel, aber das Gericht schlägt einen Teil der übrigen Strafen auf die Basisstrafe auf, um dem gesamten Unrecht gerecht zu werden. Der BGH verbietet zwar eine rein schematische Berechnung, in der Praxis orientieren sich Gerichte aber an solchen Werten. Das Gericht könnte hier die 1 Jahr und 6 Monate zum Beispiel um weitere 8 Monate erhöhen, um den anderen Taten gerecht zu werden.
Das Ergebnis wäre eine Gesamtstrafe von 2 Jahren und 2 Monaten. Sie sehen: Dieser Wert liegt deutlich über der höchsten Einzelstrafe, aber spürbar unter der reinen Summe. Genau das ist das Ziel der Gesamtstrafe – eine faire, aber angemessen harte Reaktion auf das gesamte Unrecht.
Checkliste: Was tun bei dem Vorwurf mehrerer Straftaten?
Wenn Sie mit diesem komplexen Vorwurf konfrontiert sind, kann eine strukturierte Vorgehensweise entscheidend sein. Hier sind die wichtigsten Schritte, die auf dem Wissen aus diesem Artikel basieren:
- Schritt 1: Sofort handeln & Schweigen. Machen Sie keine Aussagen zur Sache, bevor Sie nicht mit einem Anwalt gesprochen haben. Suchen Sie umgehend professionellen Rechtsrat.
- Schritt 2: Eine detaillierte Chronologie erstellen. Bereiten Sie sich auf das Gespräch mit Ihrem Anwalt vor. Schreiben Sie den exakten zeitlichen Ablauf aller Handlungen auf, inklusive Ihrer Beweggründe für jeden einzelnen Schritt.
- Schritt 3: Die Kernfrage klären lassen. Bitten Sie Ihren Anwalt um eine explizite Einschätzung, ob in Ihrem Fall eher Tateinheit oder Tatmehrheit vorliegt und warum. Dies ist die entscheidende Weiche für Ihre Verteidigung.
- Schritt 4: Mögliche Strafrahmen besprechen. Fragen Sie Ihren Anwalt gezielt nach der potenziellen Bandbreite der Strafe für beide Szenarien (Tateinheit vs. Tatmehrheit), um die Konsequenzen realistisch einschätzen zu können.
Fazit: Warum die Konkurrenzlehre so wichtig ist
In der Praxis ist sie ein unverzichtbares Werkzeug, um dem Schuldprinzip Geltung zu verschaffen und eine gerechte Strafe zu finden. Sie sorgt dafür, dass die moralische Bewertung einer Tat – also wie schlimm das Verhalten wirklich war – in ein konkretes, faires Strafmaß umgerechnet wird.
Die Kernunterscheidung bleibt dabei bestechend einfach: Entstand alles Unrecht aus einem einzigen Entschluss, oder hat sich der Täter immer wieder neu dazu entschieden, eine Straftat zu begehen? Die Antwort auf diese Frage entscheidet über Absorption oder Gesamtstrafenbildung und damit oft über Jahre der Freiheit. Kritiker bemängeln zwar, dass die Gerichte die Unterschiede zwischen den beiden Formen manchmal zu stark einebnen. Doch gerade diese fortwährende Auseinandersetzung der Gerichte mit den Grauzonen zeigt, wie lebendig und relevant diese Lehre ist. Für jeden, der im Strafrecht tätig ist, bleibt das Verständnis der Konkurrenzlehre daher keine Option, sondern eine zwingende Notwendigkeit. Sie ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie aus Tat und Schuld am Ende eine konkrete, gerechte Strafe wird.
Die Grundregeln
Das deutsche Strafrecht bestimmt die finale Sanktion eines Täters entscheidend danach, ob sein Verhalten eine oder mehrere selbstständige Straftaten darstellt.
- Die grundlegende Bewertung des Unrechts: Ein Gericht beurteilt das Verhalten eines Täters als eine Einheit, wenn ein einziger Willensentschluss die Handlungen eng verbindet und sie für einen Beobachter als zusammengehörig erscheinen; andernfalls betrachtet es mehrere voneinander unabhängige Taten.
- Die Anwendungshierarchie der Gesetze: Vor der eigentlichen Einordnung mehrerer Gesetzesverstöße klärt das Recht stets, ob speziellere oder gewichtigere Normen andere Tatbestände in ihrer Geltung überlagern oder verdrängen.
- Die Konsequenzen für die Strafzumessung: Erfüllt eine Handlung mehrere Straftatbestände als Einheit, bildet das Gericht die Strafe nach dem Absorptionsprinzip aus dem schwersten Delikt, während es bei mehreren unabhängigen Taten Einzelstrafen zu einer angemessen erhöhten Gesamtstrafe zusammenführt.
Diese differenzierte Betrachtung des Tatgeschehens gewährleistet, dass die Strafjustiz der individuellen Schuld gerecht wird und eine verhältnismäßige Ahndung erfolgt.
Experten-Einblick
Die entscheidende Weichenstellung im Strafverfahren ist oft nicht, welche Delikte verwirklicht wurden, sondern ob sie als eine Tat oder mehrere Taten gewertet werden. Diese Einordnung bestimmt, ob nach dem milderen Absorptionsprinzip nur eine Strafe gebildet oder eine schärfere Gesamtstrafe verhängt wird. Letztlich übersetzt diese juristische Abgrenzung die Frage nach der zugrundeliegenden kriminellen Energie – ein einziger Impuls versus eine Serie neuer Entschlüsse – direkt in die Höhe der finalen Strafe.
Benötigen Sie Hilfe?
Sind Sie unsicher, wie Konkurrenzen im Strafrecht Ihre Falllösung beeinflussen oder welche Rechtsfolgen daraus erwachsen? Für eine weitergehende Bewertung Ihres konkreten Falles können Sie eine unverbindliche Ersteinschätzung anfragen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was passiert, wenn ich mehrere Straftaten gleichzeitig begehe – wie wird meine Strafe dann bestimmt?
Ihre Strafe wird nicht einfach addiert. Das Gericht entscheidet stattdessen mittels der Konkurrenzlehre, ob Ihr Verhalten eine oder mehrere Taten darstellt. Dies führt entweder zur Bildung einer Gesamtstrafe nach dem Asperationsprinzip oder dazu, dass die Strafe nur aus dem Rahmen des schwersten Delikts entnommen wird.
Das deutsche Strafrecht unterscheidet bei mehreren Delikten zwischen Tateinheit (§ 52 StGB) und Tatmehrheit (§ 53 StGB). Bei Tateinheit liegt nur eine Handlung vor, die jedoch mehrere Gesetze verletzt. Hier wendet das Gericht das Absorptionsprinzip an: Es entnimmt die Strafe aus dem Delikt mit der höchsten Strafdrohung. Die anderen Taten wirken dann strafschärfend innerhalb dieses Rahmens.
Bei Tatmehrheit liegen hingegen mehrere unabhängige Handlungen vor. In diesem Fall bildet das Gericht eine Gesamtstrafe nach dem Asperationsprinzip. Die höchste Einzelstrafe dient dabei als Basis und wird angemessen erhöht, um die weiteren Taten zu berücksichtigen. Dies führt in der Regel zu einer deutlich höheren Strafe als bei Tateinheit.
Bitten Sie Ihren Anwalt daher um eine genaue juristische Einordnung Ihrer Taten (als Tateinheit oder Tatmehrheit), um zu verstehen, welcher Strafrahmen Ihnen droht.
Zählt mein gesamtes Verhalten als eine einzige Tat, oder werden mehrere Vergehen daraus?
Ihr Verhalten wird juristisch als eine einzige Tat oder mehrere Vergehen gewertet, je nachdem, ob eine natürliche Handlungseinheit oder eine Zäsur vorliegt. Eine vorherige Prüfung der Gesetzeskonkurrenz entscheidet, welche Straftatbestände überhaupt zur Anwendung kommen. Diese Einordnung beeinflusst maßgeblich Ihre rechtliche Situation.
Bevor die eigentliche Einordnung stattfindet, prüft das Gericht immer die Gesetzeskonkurrenz. Dies bedeutet, dass ein spezielleres Gesetz ein allgemeineres verdrängen kann, sodass nur ein Tatbestand zur Anwendung kommt. Verbleiben danach mehrere anwendbare Strafgesetze, unterscheidet das deutsche Strafrecht zwischen Tateinheit (§ 52 StGB) und Tatmehrheit (§ 53 StGB). Eine einzige Tat liegt dann vor, wenn Ihre Willensbetätigungen durch einen einheitlichen Willen eng verbunden sind und für Außenstehende als zusammengehöriges Geschehen erscheinen.
Es werden mehrere Vergehen angenommen, wenn voneinander unabhängige Handlungen separate Straftatbestände erfüllen und der enge Zusammenhang fehlt. Eine klare Zäsur, also eine Unterbrechung im Geschehen, trennt hier die Handlungen. Nehmen wir an: Eine Fahrt unter Alkoholeinfluss, gefolgt von einem kurzen Barbesuch und einer weiteren Fahrt, gilt juristisch nicht als eine einzige Tat. Der Barbesuch bildet eine relevante Unterbrechung, die zwei separate Trunkenheitsfahrten begründet, ungeachtet Ihres subjektiven Empfindens.
Erstellen Sie eine detaillierte chronologische Aufstellung aller Handlungen für Ihren Anwalt, um die korrekte Einordnung zu prüfen.
Wie entscheidet das Gericht, ob mein Handeln als eine oder mehrere Taten gewertet wird?
Das Gericht beurteilt Ihr Handeln zunächst nach einer möglichen Gesetzeskonkurrenz, um zu klären, ob ein Delikt ein anderes verdrängt. Sind mehrere Gesetze anwendbar, entscheidet die natürliche Handlungseinheit, also ein enger zeitlicher, räumlicher und willentlicher Zusammenhang der Taten. Fehlt dieser oder liegt eine Zäsur vor, zählen die Handlungen als mehrere separate Taten.
Zuerst prüft das Gericht die sogenannte Gesetzeskonkurrenz. Hierbei können Prinzipien wie Spezialität, Subsidiarität oder Konsumtion bewirken, dass ein spezielleres, schwerwiegenderes oder mitverzehrtes Gesetz ein anderes verdrängt. Nur ein relevanter Tatbestand kommt dann zur Anwendung. Diese Vorprüfung stellt sicher, dass keine Doppelbestrafung für dasselbe Unrecht erfolgt und die Strafe die individuelle Schuld widerspiegelt.
Entscheidend für die Abgrenzung ist die natürliche Handlungseinheit, also ein enger zeitlicher, räumlicher und willentlicher Zusammenhang. Konkret: Fährt jemand betrunken Auto, parkt, verbringt eine Stunde in einer Bar und fährt dann weiter, gilt dies als zwei separate Trunkenheitsfahrten. Die bewusste Unterbrechung in der Bar stellt eine klare Zäsur dar. Eine solche Zäsur zerstört den einheitlichen Charakter der Handlungen. Dies indiziert rechtlich eine höhere kriminelle Energie und führt zu mehreren Taten.
Fertigen Sie eine detaillierte Zeitleiste Ihrer Handlungen samt Beweggründen an, um Ihrem Verteidiger spezifische Argumente für oder gegen eine Zäsur zu liefern.
Was sind die größten Auswirkungen für meine mögliche Strafe, wenn Tatmehrheit festgestellt wird?
Wird Tatmehrheit festgestellt, führt dies zu einer deutlich härteren Bestrafung als bei Tateinheit. Das Gericht bildet eine Gesamtstrafe nach dem Asperationsprinzip, wobei es Einzelstrafen für jede Ihrer Taten festlegt und diese dann zu einer übergeordneten Strafe zusammenführt. Diese Strafe liegt stets über der höchsten Einzelstrafe, aber unter der Summe aller Einzelstrafen.
Die Bildung der Gesamtstrafe erfolgt nach § 53 und § 54 StGB, dem sogenannten Asperationsprinzip. Zuerst ermittelt das Gericht fiktive Einzelstrafen für jede selbstständige Tat. Die höchste dieser Einzelstrafen wird zur Einsatzstrafe. Anschließend erhöht das Gericht diese Einsatzstrafe „angemessen“, um die anderen Taten spürbar zu berücksichtigen. Damit wird die höhere kriminelle Entschlossenheit bestraft, die sich in mehreren einzelnen Taten zeigt.
Diese Gesamtstrafe muss immer unter der Summe aller Einzelstrafen liegen, um einen „Mengenrabatt“ zu gewähren und eine uferlose Addition zu vermeiden. Gleichzeitig muss sie aber höher sein als die höchste Einzelstrafe, damit jede begangene Tat auch geahndet wird. Eine solche Feststellung kann Ihre Freiheitsstrafe erheblich verlängern, was die Notwendigkeit einer starken Verteidigung unterstreicht.
Rechnen Sie daher mit Ihrem Anwalt die potenzielle Bandbreite einer Gesamtstrafe durch, um Ihre Situation realistisch einzuschätzen.
Gibt es Situationen, in denen die Abgrenzung von Taten besonders schwierig ist und mein Fall kompliziert macht?
Ja, die Abgrenzung von Taten wird besonders schwierig bei Dauerdelikten, die eine ‚Klammerwirkung‘ entfalten und weitere Taten zu einer Einheit verbinden können. Ebenso kompliziert wird es bei Serienstraftaten, die früher als ‚fortgesetzte Tat‘ behandelt wurden und heute konsequent als Tatmehrheit gelten. Eine Verwechslung des materiellen und prozessualen Tatbegriffs kann ebenfalls zu Verwirrung führen.
Dauerdelikte, wie die Freiheitsberaubung nach § 239 StGB, stellen eine besondere Herausforderung dar, da sie einen rechtswidrigen Zustand über längere Zeit aufrechterhalten. Begeht der Täter währenddessen weitere Delikte, können diese durch die sogenannte ‚Klammerwirkung‘ des Dauerdelikts zu einer einzigen Tat im Sinne der Tateinheit verklammert werden. Dies macht die Abgrenzung extrem komplex, wie sich auch bei den Vereinigungsdelikten zeigt. Zudem kann die Unterscheidung zwischen dem materiellen Konkurrenzbegriff und dem prozessualen Tatbegriff der Strafprozessordnung zu Missverständnissen führen, da ein prozessualer Tat durchaus materiell mehrere Taten umfassen kann.
Die umstrittene Figur der ‚fortgesetzten Tat‘, die Serienstraftaten wie wiederholten Kassendiebstahl zusammenfassen sollte, wurde 1994 vom Bundesgerichtshof weitgehend abgeschafft. Solche Handlungen werden heute konsequent als Tatmehrheit behandelt. Das verschärft die strafrechtlichen Folgen jeder einzelnen Handlung, da jede Tat separat bewertet und geahndet wird. Dies bedeutet auch, dass keine übergreifende Verjährung für die gesamte Serie eintritt. Gehen Sie daher bei langwierigen oder wiederkehrenden Straftaten nicht von einer fortgesetzten Tat aus, um eine massive Unterschätzung der Gesamtstrafe zu vermeiden.
Falls Ihr Fall Merkmale eines Dauerdelikts oder wiederholter, ähnlicher Handlungen aufweist, fordern Sie von Ihrem Verteidiger eine explizite Bewertung der ‚Klammerwirkung‘ oder der Einordnung als ‚fortgesetzte Tat‘ versus ‚Tatmehrheit‘ an.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.








