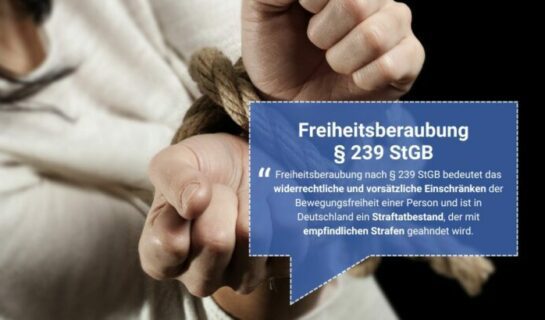Trotz Sicherstellung im Rahmen eines Vermögensarrests ordnete die Staatsanwaltschaft die sofortige Notveräußerung gepfändeter Pkw an, darunter ein Ford Mustang und ein Mercedes GLC. Die Behörde konnte aber weder den dringenden Wertverlust der Fahrzeuge noch die Höhe der Lagerkosten schlüssig nachweisen.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Wann darf der Staat Ihr Auto verkaufen? Die Grenzen der Notveräußerung gepfändeter Pkw
- Was genau war passiert?
- Welche Gesetze spielten hier die entscheidende Rolle?
- Warum entschied das OLG Hamm so – und nicht anders?
- Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Experten Kommentar
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wann darf die Staatsanwaltschaft mein gepfändetes Auto vorzeitig verkaufen (Notveräußerung)?
- Welche Voraussetzungen müssen für einen „erheblichen Wertverlust“ meines gepfändeten Eigentums erfüllt sein?
- Wie kann ich mich gegen die richterliche Anordnung zur Notveräußerung erfolgreich wehren?
- Ab wann gelten Aufbewahrungs- oder Standkosten für mein beschlagnahmtes Auto als „erheblich“?
- Bekomme ich Entschädigung, wenn mein Eigentum zu Unrecht notveräußert wurde, und wann kann ich diese beantragen?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 3 Ws 241/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht Hamm
- Datum: 17.07.2025
- Aktenzeichen: 3 Ws 241/25
- Verfahren: Beschwerdeverfahren
- Rechtsbereiche: Strafprozessrecht, Einziehungsrecht, Eigentumsschutz
- Das Problem: Ein Angeklagter wehrte sich gegen die erzwungene Notveräußerung seiner gepfändeten Autos. Das Landgericht hatte den Verkauf wegen angeblich drohenden Wertverlusts und zu hoher Lagerkosten angeordnet. Der Verkauf fand bereits während des Beschwerdeverfahrens statt.
- Die Rechtsfrage: Durfte das Gericht die gepfändeten Fahrzeuge wirklich schnell verkaufen lassen? Waren die Lagerkosten oder der Wertverlust dafür hoch genug, um den Zwang zu rechtfertigen?
- Die Antwort: Nein, die Anordnung zur Notveräußerung war rechtswidrig. Das Landgericht stützte sich auf pauschale Annahmen, die keine konkrete Gefahr eines erheblichen Wertverlusts belegten. Die angefallenen Lagerkosten waren im Verhältnis zum Wert der Autos nicht hoch genug.
- Die Bedeutung: Behörden dürfen gepfändete Gegenstände nicht vorschnell verkaufen. Sie müssen konkret und nachweisbar belegen, dass ein erheblicher Schaden oder unverhältnismäßig hohe Kosten drohen.
Wann darf der Staat Ihr Auto verkaufen? Die Grenzen der Notveräußerung gepfändeter Pkw
Wenn die Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens Vermögenswerte beschlagnahmt, stellt sich oft eine heikle Frage: Was geschieht mit Dingen, die an Wert verlieren oder deren Aufbewahrung teuer ist? Ein Ford Mustang und ein Mercedes-Benz GLC, gepfändet bei einem Mann unter Betrugsverdacht, wurden zum Kern eines Rechtsstreits, der genau diese Frage beleuchtet. Das Oberlandesgericht Hamm musste am 17. Juli 2025 unter dem Aktenzeichen 3 Ws 241/25 klären, ob der Staat diese Fahrzeuge vor einem rechtskräftigen Urteil verkaufen durfte. Die Entscheidung zeichnet ein präzises Bild davon, wann eine solche „Notveräußerung“ rechtmäßig ist – und wann sie eine unzulässige Vorverurteilung von Eigentum darstellt.
Was genau war passiert?

Die Geschichte beginnt mit schweren Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft klagte einen Mann wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in zahlreichen Fällen an. Um mögliche spätere Entschädigungsansprüche zu sichern, erwirkte sie im November 2023 einen sogenannten Vermögensarrest über mehr als eine Million Euro. Dieser Arrest ist ein Instrument, das es dem Staat erlaubt, das Vermögen eines Beschuldigten einzufrieren, um zu verhindern, dass es vor einem Urteil verschwindet.
Bei der Vollstreckung dieses Arrests pfändeten Polizeibeamte unter anderem einen Ford Mustang und einen Mercedes-Benz GLC. Die Fahrzeuge wurden zu einer Verwahrfirma gebracht, wo sie fortan standen – und Kosten verursachten. Pro Tag und Fahrzeug fielen 1,50 € Standgebühren an, zusätzlich zu einer einmaligen Sicherstellungsgebühr.
Einige Monate später, im April 2024, schätzte die Oberfinanzdirektion den Wert der Autos: 16.500 € für den Mustang, 19.500 € für den Mercedes. Die Gutachten erwähnten beiläufig, dass bereits Standschäden wertmindernd wirkten, ohne dies jedoch genauer zu beziffern. Für die Staatsanwaltschaft war dies der Anlass zu handeln. Sie sah die Gefahr, dass die laufenden Standgebühren und drohende weitere Schäden den Wert der Fahrzeuge unverhältnismäßig schmälern würden. Sie beantragte daher eine Notveräußerung, also einen vorzeitigen Verkauf.
Das Landgericht Essen gab dem Antrag am 6. März 2025 statt. Die Richter argumentierten, dass die Kombination aus laufenden Kosten und dem allgemein bekannten Risiko von Standschäden bei langer Parkdauer – wie leere Batterien oder festsitzende Bremsen – den Verkauf rechtfertige. Ein wirtschaftlich denkender Eigentümer, so die Kammer, würde sich ebenfalls für einen Verkauf entscheiden.
Der Angeklagte sah das anders. Über seinen Verteidiger legte er Beschwerde ein. Er argumentierte, dass die Voraussetzungen für eine solch drastische Maßnahme nicht vorlägen. Ein Erheblicher Wertverlust sei nicht konkret dargelegt und die Standgebühren seien im Verhältnis zum Fahrzeugwert gering. Während dieses Beschwerdeverfahren noch lief, schuf die Staatsanwaltschaft Fakten: Sie verkaufte die beiden Autos und erzielte Erlöse von 17.400 € für den Ford und 18.800 € für den Mercedes. Nun lag der Fall beim Oberlandesgericht Hamm zur endgültigen Entscheidung.
Welche Gesetze spielten hier die entscheidende Rolle?
Das Herzstück dieses Falles ist eine einzige Vorschrift: der § 111p der Strafprozessordnung (StPO). Dieser Paragraph regelt die „Notveräußerung“ und ist eine Ausnahme vom Grundsatz, dass gepfändetes Eigentum bis zum Abschluss eines Verfahrens unangetastet bleibt. Das Gesetz schützt das Eigentum des Beschuldigten, das durch Art. 14 des Grundgesetzes (GG) verfassungsrechtlich garantiert ist.
Eine Notveräußerung ist nur unter drei strengen und klar definierten Bedingungen zulässig:
- Der Gegenstand droht zu verderben. Dies betrifft vor allem verderbliche Waren wie Lebensmittel.
- Ein baldiger, erheblicher Wertverlust droht. Dies könnte bei Saisonartikeln oder schnell veraltender Technik der Fall sein.
- Die Aufbewahrung, Pflege oder Erhaltung ist mit erheblichen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden.
Das Gericht muss prüfen, ob eine dieser drei Alternativen zweifelsfrei vorliegt. Es handelt sich um eine einschneidende Maßnahme, denn sie verwandelt das konkrete Eigentum an einer Sache – hier den Autos – unwiderruflich in einen Geldbetrag. Für den Beschuldigten macht es einen großen Unterschied, ob er am Ende eines Freispruchs seine Autos zurückbekommt oder nur deren Verkaufserlös.
Warum entschied das OLG Hamm so – und nicht anders?
Obwohl die Fahrzeuge bereits verkauft waren, erklärte das Oberlandesgericht Hamm die Anordnung des Landgerichts für rechtswidrig. Die Richter stellten klar, dass der Verkauf die Beschwerde nicht bedeutungslos machte. Der Eingriff in das Eigentumsrecht des Angeklagten wirkte fort, und er hatte ein Anrecht darauf, die Rechtmäßigkeit der Maßnahme klären zu lassen. In der Sache selbst zerlegte der Senat die Argumentation des Landgerichts und der Staatsanwaltschaft Punkt für Punkt.
Fehlende Beweise für einen drohenden Wertverlust
Das Landgericht hatte seine Entscheidung maßgeblich auf die Gefahr weiterer Standschäden gestützt. Das OLG Hamm befand diese Begründung für nicht tragfähig. Zwar sei es allgemein bekannt, dass lange Standzeiten einem Auto nicht guttun, doch pauschale, „gerichtsbekannte“ Erwägungen reichen für eine so gravierende Entscheidung nicht aus.
Die Richter bemängelten, dass die vorliegenden Wertgutachten keine konkrete Prognose enthielten. Die Gutachter hatten zwar bereits vorhandene Standschäden berücksichtigt, aber keine Aussage darüber getroffen, welche zusätzlichen Schäden in welchem Umfang und in welchem Zeitraum zu erwarten wären. Ohne eine solche quantifizierte, fachliche Prognose, so das Gericht, könne man einen „erheblichen“ Wertverlust im Sinne des § 111p StPO nicht seriös annehmen. Es fehlte schlicht die Tatsachengrundlage für die Annahme der Staatsanwaltschaft.
Aufbewahrungskosten waren nicht „erheblich“
Auch das zweite zentrale Argument – die hohen Aufbewahrungskosten – hielt der Prüfung durch das OLG nicht stand. Die Richter nahmen sich die Zahlen der Verwahrfirma vor und rechneten nach. Zum Zeitpunkt der Entscheidung des Landgerichts beliefen sich die angefallenen Kosten (Standgeld plus einmalige Gebühren) auf etwa 5,0 % des Wertes des Ford Mustang und 4,3 % des Wertes des Mercedes.
Das Gericht ging sogar noch einen Schritt weiter und erstellte eine Prognose. Selbst wenn man eine sehr lange Verfahrensdauer bis zum April 2026 annähme, würden die Gesamtkosten nur auf 7,7 % bzw. 6,6 % des Fahrzeugwertes ansteigen. Nach Ansicht des Senats stellt ein solcher Anteil keine „erheblichen Kosten“ dar, die den sofortigen Verkauf zweier werthaltiger Fahrzeuge rechtfertigen würden. Die Relation zwischen Wert und Kosten war schlicht nicht dramatisch genug.
Gegenargumente der Staatsanwaltschaft überzeugten nicht
Das Gericht setzte sich auch explizit mit den Einwänden der Anklagebehörde auseinander. Das Argument, der nachträglich erzielte gute Verkaufserlös zeige, dass die Veräußerung wirtschaftlich sinnvoll war, wies der Senat zurück. Die Rechtmäßigkeit einer Anordnung bemisst sich ausschließlich nach den Fakten und Prognosen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung vorlagen. Ein glücklicher Verkauf heilt keine fehlerhafte rechtliche Grundlage.
Auch die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft während des laufenden Beschwerdeverfahrens die Autos verkauft hatte, wurde zwar zur Kenntnis genommen, war für die materielle Entscheidung aber nicht mehr ausschlaggebend. Da die Anordnung selbst bereits aus inhaltlichen Gründen rechtswidrig war, musste das Gericht nicht mehr vertieft prüfen, ob durch den schnellen Verkauf auch das Recht des Angeklagten auf rechtliches Gehör (Art. 103 GG) verletzt wurde.
Kein Schnellverfahren für Entschädigungsansprüche
Der Angeklagte hatte nach dem Verkauf der Autos zusätzlich beantragt, das Gericht möge feststellen, dass ihm nun eine Entschädigung nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) zustehe. Diesen Antrag wies das OLG Hamm jedoch zurück. Die Richter begründeten dies damit, dass über solche Entschädigungsansprüche erst am Ende des gesamten Strafverfahrens entschieden werden kann. Eine solche Entscheidung hängt vom finalen Urteil ab – also davon, ob der Angeklagte verurteilt oder freigesprochen wird. Eine isolierte Feststellung in einem vorgeschalteten Beschwerdeverfahren ist prozessual nicht vorgesehen.
Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm ist mehr als nur ein Einzelfall. Sie verdeutlicht zwei grundlegende Prinzipien des Rechtsstaats im Umgang mit beschlagnahmtem Eigentum.
Die erste Lehre ist das Gebot der konkreten Tatsachengrundlage. Der Staat darf nicht auf Basis von Vermutungen, allgemeinen Annahmen oder „gerichtsbekanntem“ Wissen in das Eigentum eines Bürgers eingreifen, der noch nicht rechtskräftig verurteilt ist. Wenn er einen erheblichen Wertverlust oder erhebliche Kosten als Grund für eine Notveräußerung anführt, muss er dies mit konkreten, nachvollziehbaren und quantifizierten Fakten belegen. Die Beweislast liegt hier klar bei der Staatsanwaltschaft, und die Gerichte sind verpflichtet, diese Grundlage rigoros zu prüfen. Pauschale Begründungen genügen dem hohen Schutz des Eigentumsrechts nicht.
Die zweite Lehre betrifft die Bedeutung des Rechtsschutzes. Selbst wenn die Fakten geschaffen sind und die Autos verkauft wurden, ist der Rechtsweg nicht abgeschnitten. Das Gericht hat die Maßnahme nachträglich für rechtswidrig erklärt. Diese Feststellung ist von großer Bedeutung. Sie stellt zwar nicht den ursprünglichen Zustand wieder her, bildet aber die essenzielle Grundlage für mögliche spätere Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche des Betroffenen. Sie demonstriert, dass staatliches Handeln auch dann noch einer gerichtlichen Kontrolle unterliegt, wenn es unumkehrbar scheint.
Die Urteilslogik
Der Staat darf beschlagnahmtes Eigentum nur unter strengsten Auflagen und niemals auf Basis vager Vermutungen vorzeitig verkaufen.
- Beweislast für den Wertverlust: Gerichte dürfen einen erheblichen Wertverlust nicht auf allgemeine Lebenserfahrung oder pauschale Standschäden stützen, sondern müssen eine quantifizierte, fachliche Prognose über den konkret drohenden Schaden verlangen.
- Verhältnismäßigkeit der Lagerkosten: Aufbewahrungskosten gelten erst dann als „erheblich“ im Sinne einer Notveräußerung, wenn ihr Verhältnis zum Gesamtwert des gepfändeten Gegenstands dramatisch ist und nicht nur einen geringen Prozentsatz ausmacht.
- Nachträgliche Kontrolle staatlichen Handelns: Die Rechtmäßigkeit einer Verkaufsanordnung beurteilt sich ausschließlich nach den Fakten zum Zeitpunkt der Entscheidung; ein nachträglich guter Verkaufserlös heilt die ursprüngliche Rechtswidrigkeit nicht.
Der Schutz des Eigentums verlangt von den Strafverfolgungsbehörden eine rigorose Belegpflicht, bevor sie irreversibel in private Vermögenswerte eingreifen.
Benötigen Sie Hilfe?
Droht Ihren gepfändeten Gegenständen eine voreilige Notveräußerung?
Kontaktieren Sie uns, um eine erste rechtliche Einschätzung Ihrer Lage zu erhalten.
Experten Kommentar
Wenn der Staat ein hochwertiges Auto pfändet, kostet die Lagerung natürlich Geld. Aber dieses Urteil macht unmissverständlich klar: Die bloße Annahme allgemeiner Standschäden oder Lagerkosten im niedrigen einstelligen Prozentbereich sind kein Freibrief für einen schnellen Notverkauf. Das Gericht zieht eine klare rote Linie und verpflichtet die Staatsanwaltschaft, den drohenden „erheblichen Wertverlust“ künftig wasserdicht, quantifiziert und mithilfe eines konkreten Gutachtens zu belegen. Damit wird das Eigentumsrecht des Beschuldigten – selbst wenn ihm schwere Straftaten vorgeworfen werden – bis zum rechtskräftigen Urteil konsequent geschützt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wann darf die Staatsanwaltschaft mein gepfändetes Auto vorzeitig verkaufen (Notveräußerung)?
Die Notveräußerung Ihres Eigentums ist eine strenge Ausnahme vom Grundsatz, dass gepfändete Gegenstände bis zum Urteil unangetastet bleiben. Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn die Sache selbst verdirbt, ein baldiger und erheblicher Wertverlust droht oder die Aufbewahrung unverhältnismäßige Kosten verursacht. Pauschale Annahmen über Standschäden oder allgemeine Risiken reichen dabei niemals aus, um den Verkauf zu rechtfertigen.
Diese Regelung findet sich in § 111p der Strafprozessordnung. Das Gesetz schützt Ihr Eigentumsrecht, welches durch Artikel 14 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich garantiert ist. Der Staat darf dieses Recht nur bei Vorliegen einer der drei zwingenden Alternativen antasten. Weil der Verkauf das konkrete Eigentum unwiderruflich in einen Geldbetrag umwandelt, faktisch also eine Vorverurteilung des Vermögens darstellt, muss die Justiz die Voraussetzungen rigoros prüfen.
Die Beweislast für die Notwendigkeit des Verkaufs liegt vollständig bei der Staatsanwaltschaft. Die Behörde muss die Gefahr des Wertverlusts oder die Erheblichkeit der Kosten konkret und quantifiziert belegen. Vage Erwägungen, beispielsweise dass langes Stehen dem Auto generell schadet, sind unzulässig und wurden von Gerichten explizit zurückgewiesen. Es ist eine fachliche Prognose notwendig, die den drohenden Schaden genau beziffert und keine bloße Vermutung darstellt.
Fordern Sie über Ihren Anwalt sofort eine schriftliche Begründung und die dazugehörigen Wertgutachten an, um die quantifizierte Prognose des Wertverlusts prüfen zu lassen.
Welche Voraussetzungen müssen für einen „erheblichen Wertverlust“ meines gepfändeten Eigentums erfüllt sein?
Der Begriff des „erheblichen Wertverlusts“ wird von Gerichten sehr streng ausgelegt. Die Staatsanwaltschaft darf Ihr Eigentum nicht aufgrund von Vermutungen oder allgemeinen Lebenserfahrungen verkaufen. Entscheidend ist eine konkrete und quantifizierte Prognose des zukünftigen Schadens. Nur harte, finanzielle Fakten rechtfertigen diesen tiefgreifenden Eingriff in Ihr Eigentum, der Ihr spezifisches Eigentum in einen Geldbetrag umwandelt.
Die Beweislast für den drohenden Wertverlust liegt vollständig bei der Staatsanwaltschaft. Es reicht nicht aus, lediglich zu argumentieren, dass Standzeiten generell zu Schäden führen, etwa weil Batterien leer werden. Die Gutachter müssen exakt angeben, welche zusätzlichen Schäden in Euro oder als Prozentsatz des Gesamtwertes durch die weitere Aufbewahrung entstehen. Gerichte lehnen pauschale Annahmen über Standschäden, selbst wenn sie als „gerichtsbekannt“ gelten, rigoros ab, weil die notwendige Tatsachengrundlage fehlt.
Das Oberlandesgericht Hamm betonte diese strenge Anforderung in einem jüngeren Fall deutlich. Im dortigen Streit hatten die vorliegenden Wertgutachten zwar bereits vorhandene Standschäden erwähnt, aber keine Aussage über den zukünftigen Verlust bei längerer Standzeit getroffen. Ohne eine fachliche und bezifferte Prognose darf das Gericht die Annahme des erheblichen Wertverlusts nicht seriös treffen. Die Richter müssen die Prognose kritisch hinterfragen und eine konkrete Basis für die Annahme des Schadens fordern.
Prüfen Sie in den zugestellten Wertgutachten, ob explizit ein Abschnitt zur Prognose des Wertverlusts bei weiterer Standzeit enthalten ist – fehlt dieser, ist dies Ihr stärkster Anfechtungspunkt.
Wie kann ich mich gegen die richterliche Anordnung zur Notveräußerung erfolgreich wehren?
Selbst wenn die Staatsanwaltschaft Tatsachen geschaffen und Ihr Eigentum bereits verkauft hat, ist der Rechtsweg nicht abgeschnitten. Sie wehren sich sofort, indem Sie sofortige Beschwerde gegen die richterliche Anordnung einlegen. Diese Beschwerde richten Sie formell an das zuständige Oberlandesgericht (OLG). Der Staat kann sich dem verfassungsrechtlichen Rechtsschutz des Eigentums (Art. 14 GG) nicht durch einen vorschnellen Verkauf des beschlagnahmten Gegenstands entziehen.
Die Beschwerde ist von entscheidender Bedeutung, da sie die gerichtliche Überprüfung des massiven Eingriffs in Ihr Eigentum sicherstellt. Die nachträgliche Feststellung der Rechtswidrigkeit bleibt das zentrale Ziel des Verfahrens. Die Richter des OLG müssen die Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Anordnung zur Notveräußerung prüfen. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Sache physisch nicht mehr existiert, weil sie verkauft wurde. Dieses Vorgehen wahrt Ihre Rechte als Beschuldigter und verhindert, dass Sie Ihre Ansprüche vorschnell verlieren.
Konkret dient die erfolgreiche Beschwerde der Sicherung Ihrer Entschädigungsbasis. Stellt das OLG nachträglich fest, dass die Notveräußerung rechtswidrig war, schaffen Sie die unabdingbare Grundlage für spätere Schadensersatzansprüche. Das Oberlandesgericht Hamm erklärte die Verkaufsanordnung beispielsweise nachträglich für rechtswidrig, obwohl die Fahrzeuge bereits liquidiert waren. Diese Feststellung der Rechtswidrigkeit ist essenziell für einen späteren Entschädigungsantrag im Falle eines Freispruchs.
Beauftragen Sie Ihren Anwalt sofort damit, im Beschwerdeschriftsatz zu betonen, dass die Staatsanwaltschaft die Beweislast nicht erfüllt hat, und verlangen Sie die Feststellung der Rechtswidrigkeit.
Ab wann gelten Aufbewahrungs- oder Standkosten für mein beschlagnahmtes Auto als „erheblich“?
Aufbewahrungskosten für ein beschlagnahmtes Auto gelten nur dann als erheblich, wenn sie in einem dramatischen Missverhältnis zum aktuellen Fahrzeugwert stehen. Die Gerichte betrachten diese Kosten nicht isoliert, sondern prüfen immer den prozentualen Anteil an der Werthöhe. Das Oberlandesgericht Hamm stellte in einem maßgeblichen Fall klar, dass kumulierte Verwahrungskosten selbst bei einer langen Verfahrensdauer von bis zu 7,7 Prozent des Fahrzeugwerts nicht ausreichend sind, um einen sofortigen Verkauf zu rechtfertigen.
Entscheidend ist die juristische Relation. Es kommt nicht auf die absolute Höhe der täglichen Standgebühren an, also ob sie beispielsweise 1,50 Euro pro Tag betragen. Die Staatsanwaltschaft muss vielmehr prognostizieren, welche Gesamtkosten bis zum voraussichtlichen Ende des Strafverfahrens auflaufen werden. Diese kumulierten Aufwendungen werden dann ins Verhältnis zum geschätzten Marktwert des beschlagnahmten Gegenstands gesetzt. Nur wenn dieses Verhältnis „dramatisch“ ausfällt, kann eine Notveräußerung nach § 111p StPO gerechtfertigt werden.
Konkret legte das OLG Hamm fest, dass die Grenze für eine Erheblichkeit hoch liegt. Im zugrundeliegenden Fall prüften die Richter die Kosten von zwei werthaltigen Fahrzeugen, die zum Entscheidungszeitpunkt bei etwa 5 Prozent des Wertes lagen. Das Gericht erstellte eine Prognose: Selbst bei Annahme einer sehr langen Verfahrensdauer stiegen die geschätzten Gesamtkosten lediglich auf 7,7 Prozent an. Kosten, die demnach unter acht Prozent des gesamten Fahrzeugwerts bleiben, gelten in der Regel nicht als erheblich genug für einen vorzeitigen Verkauf.
Berechnen Sie den genauen Prozentsatz der Gebühren im Verhältnis zum Schätzwert Ihres Autos, um das Verhältnis im Beschwerdeverfahren erfolgreich als nichterheblich anzugreifen.
Bekomme ich Entschädigung, wenn mein Eigentum zu Unrecht notveräußert wurde, und wann kann ich diese beantragen?
Sie erhalten nur dann eine finanzielle Entschädigung für die zu Unrecht erfolgte Notveräußerung, wenn das gesamte Strafverfahren mit einem Freispruch endet. Der Anspruch nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) entsteht erst durch dieses finale Urteil. Sie können den Antrag auf Entschädigung nicht vorzeitig oder isoliert im Beschwerdeverfahren über die Notveräußerung stellen, da er vom Ausgang des Hauptverfahrens abhängt.
Die gerichtliche Feststellung der Rechtswidrigkeit der Notveräußerung ist von der eigentlichen Entschädigungsleistung strikt prozessual getrennt. Obwohl ein Oberlandesgericht die voreilige Maßnahme als rechtswidrig erachtet, löst dies keine sofortige Auszahlung des Differenzbetrags zwischen Erlös und Verkehrswert aus. Diese Trennung führt bei Betroffenen häufig zu Ungeduld, da der finanzielle Ausgleich trotz gerichtlichen Erfolgs noch in weiter Ferne liegt.
Konkret lehnten die Richter des OLG Hamm in einem ähnlichen Fall einen Antrag auf sofortige Entschädigungsfeststellung als unzulässig ab. Das Gericht stellte klar, dass die Frage des Entschädigungsanspruchs zwingend an den Ausgang des Hauptverfahrens geknüpft ist. Erst wenn die Unschuld bewiesen ist und der Beschuldigte freigesprochen wird, kann der Entschädigungsanspruch nach StrEG geltend gemacht werden.
Sichern Sie den Beschluss, der die Rechtswidrigkeit der Notveräußerung feststellt, als zentralen Beweis für Ihren späteren StrEG-Antrag im Falle eines Freispruchs.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Beschwerdeverfahren
Ein Beschwerdeverfahren ist der juristische Vorgang, mit dem ein Betroffener eine gegen ihn gerichtete gerichtliche Entscheidung, beispielsweise die Anordnung einer Notveräußerung, von einem höheren Gericht überprüfen lässt. Dieses Verfahren gewährt den rechtlichen Schutz und gewährleistet, dass jede behördliche oder richterliche Maßnahme, die in Grundrechte eingreift, einer gerichtlichen Kontrolle unterzogen wird.
Beispiel: Der Angeklagte legte über seinen Verteidiger sofortige Beschwerde gegen die Verkaufsanordnung des Landgerichts Essen ein, wodurch der Fall zur Entscheidung an das Oberlandesgericht Hamm gelangte.
Erheblicher Wertverlust
Juristen verstehen unter einem erheblichen Wertverlust eine drohende, quantifizierbare Minderung des Sachwerts, die im Verhältnis zur Gesamthöhe des Vermögensgegenstandes so gravierend ist, dass die Notveräußerung gerechtfertigt erscheint. Das Gesetz schützt das Eigentum und erlaubt einen vorzeitigen Verkauf nur dann, wenn das Abwarten des rechtskräftigen Urteils einen größeren finanziellen Schaden für den Beschuldigten selbst bedeuten würde.
Beispiel: Das OLG Hamm bemängelte, dass die Staatsanwaltschaft keine konkrete Prognose über den zukünftigen Schaden in Euro vorlegte und somit der Beweis für einen erheblichen Wertverlust fehlte.
Notveräußerung
Die Notveräußerung ist die gesetzlich geregelte Ausnahme nach § 111p StPO, die es Strafverfolgungsbehörden erlaubt, beschlagnahmtes Eigentum vor einem rechtskräftigen Urteil zwangsweise zu verkaufen. Diese einschneidende Maßnahme soll verhindern, dass Gegenstände verderben, sich durch Aufbewahrungskosten völlig entwerten oder durch schnelles Veralten nutzlos werden, schützt also den Vermögenswert an sich.
Beispiel: Obwohl die Notveräußerung der beiden Pkw bereits vollzogen war, erklärte das Oberlandesgericht Hamm die ursprüngliche Anordnung des Landgerichts nachträglich als rechtswidrig.
StrEG (Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen)
Das StrEG regelt, wann und in welcher Höhe Bürger Anspruch auf finanzielle Entschädigung haben, wenn sich eine behördliche Maßnahme, wie eine Notveräußerung, später als rechtswidrig herausstellt und das Strafverfahren mit einem Freispruch endet. Mit diesem Gesetz stellt der Staat sicher, dass unschuldige Bürger, die durch Maßnahmen der Strafverfolgung einen Schaden erlitten haben, einen finanziellen Ausgleich erhalten.
Beispiel: Der Antrag des Angeklagten auf sofortige Feststellung seines Entschädigungsanspruchs nach StrEG wurde abgewiesen, da über solche Forderungen erst nach dem Abschluss des gesamten Hauptverfahrens entschieden werden darf.
Vermögensarrest
Ein Vermögensarrest ist eine präventive gerichtliche Anordnung im Strafverfahren, die das gesamte Vermögen oder Teile davon einfriert und dessen Verfügungsmacht entzieht, um spätere Entschädigungsansprüche des Staates oder Geschädigter zu sichern. Dieses Instrument verhindert, dass der Beschuldigte Vermögenswerte vor dem Urteil beiseiteschafft oder verschwinden lässt, um eine spätere Vollstreckung oder Einziehung zu vereiteln.
Beispiel: Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Vermögensarrest über mehr als eine Million Euro, um zu gewährleisten, dass der Betrugsverdächtige mögliche Entschädigungen später zahlen kann.
Das vorliegende Urteil
Oberlandesgericht Hamm – Az.: 3 Ws 241/25 – Beschluss vom 17.07.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.