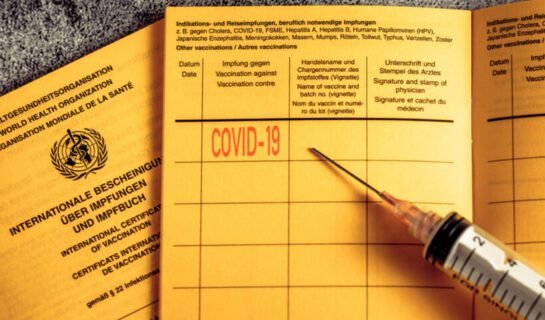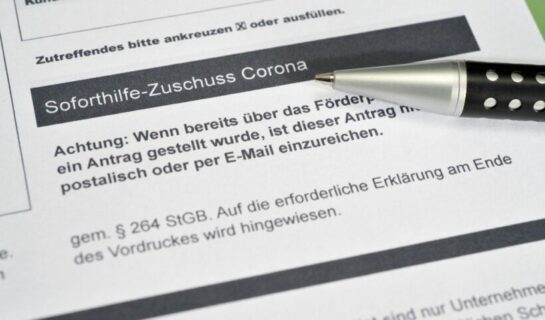Ein Anwalt forderte die volle Mittelgebühr nach einem Freispruch, doch das Landgericht setzte die Kürzung der Anwaltsgebühren im Strafverfahren an. Ausschlaggebend war nicht der Erfolg, sondern der geringe Umfang der Akte: Die Staatskasse berief sich auf eine strenge 20-Prozent-Grenze.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Warum kann die Staatskasse Anwaltsgebühren nach einem Freispruch kürzen?
- Was war der Auslöser des Gebührenstreits?
- Nach welchen Regeln bestimmt ein Anwalt sein Honorar?
- Warum stufte das Gericht die Forderung des Anwalts als unbillig ein?
- Was bedeutet das Urteil jetzt für Sie?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Experten Kommentar
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wer trägt die Anwaltskosten bei einem Freispruch und wann wird die Rechnung gekürzt?
- Wann gelten die Anwaltsgebühren nach einem Freispruch als „unbillig“ und wie hoch ist die Toleranzgrenze?
- Welcher Aktenumfang oder welche Verhandlungsdauer führt zur Kürzung der Anwaltsgebühren?
- Was kann ich tun, wenn die Staatskasse meine Anwaltsgebühren nach dem Freispruch kürzt?
- Wie muss der Anwalt die Mittelgebühr begründen, damit sie von der Staatskasse voll erstattet wird?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 12 Qs 34/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landgericht Nürnberg-Fürth
- Datum: 19.09.2025
- Aktenzeichen: 12 Qs 34/25
- Verfahren: Verfahren über Anwaltskosten (Einspruch gegen Festsetzung)
- Rechtsbereiche: Anwaltskosten, Strafrecht
- Das Problem: Ein Anwalt verlangte für seinen Mandanten nach einem Freispruch durchschnittliche Gebühren. Das Amtsgericht kürzte die verlangten Anwaltskosten für die Staatskasse. Der Anwalt legte Einspruch gegen diese Kostenkürzung ein.
- Die Rechtsfrage: Darf das Gericht die von einem Anwalt selbst festgelegten durchschnittlichen Gebühren kürzen, wenn es diese für unangemessen hält?
- Die Antwort: Ja, der Einspruch wurde zurückgewiesen. Die vom Anwalt verlangten Gebührensätze waren unangemessen hoch und Unbillig. Sie überschritten die zulässige Obergrenze der Fairness, da der Fall einfach und kurz war.
- Die Bedeutung: Anwälte dürfen ihre Gebühren nicht uneingeschränkt selbst festlegen, wenn die Staatskasse zahlt. Das Gericht prüft die Angemessenheit streng anhand der tatsächlichen Komplexität des Falles und der kurzen Verhandlungsdauer.
Warum kann die Staatskasse Anwaltsgebühren nach einem Freispruch kürzen?
Ein Freispruch ist für einen Strafverteidiger und seine Mandantin der bestmögliche Ausgang eines Verfahrens. Doch was passiert, wenn der eigentliche Kampf erst nach dem Urteil beginnt – und zwar um das Anwaltshonorar? Genau diese Frage musste das Landgericht Nürnberg-Fürth in einem Beschluss vom 19. September 2025 (Az. 12 Qs 34/25) klären. Der Fall zeigt eindrücklich, dass das Recht eines Anwalts, seine Gebühren festzulegen, klare Grenzen hat, sobald die Staatskasse die Rechnung begleichen muss.
Was war der Auslöser des Gebührenstreits?

Die Geschichte beginnt mit einem alltäglichen Nachbarschaftsstreit. Einer Frau wurde vorgeworfen, ihre Nachbarin beleidigt, geschüttelt und in den Bauch getreten zu haben. Es kam zur Anklage wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die Frau beauftragte einen Anwalt mit ihrer Verteidigung. Das Verfahren vor dem Amtsgericht Nürnberg zog sich über zwei Hauptverhandlungstermine, da die als Zeugin geladene Nachbarin beim ersten Termin nicht erschien und vorgeführt werden musste. Am Ende stand ein Erfolg für die Verteidigung: Die Angeklagte wurde freigesprochen.
Nach dem Freispruch ist die Staatskasse verpflichtet, die notwendigen Auslagen der freigesprochenen Person zu erstatten – dazu gehören auch die Kosten für den Anwalt. Der Verteidiger reichte daraufhin seine Kostenrechnung ein. Für seine grundlegende Einarbeitung (Grundgebühr) und seine Anwesenheit an den beiden Gerichtsterminen (Terminsgebühren) setzte er die sogenannte Mittelgebühr an. Dies ist ein in der Praxis üblicher Wert für durchschnittlich komplexe Fälle.
Doch das Amtsgericht Nürnberg war anderer Meinung. Nach Prüfung durch die Bezirksrevisorin, die als „Hüterin der Staatskasse“ fungiert, kürzte das Gericht die Rechnung. Es anerkannte zwar die vom Anwalt geforderte Gebühr für die allgemeine Verfahrensführung, setzte aber die Grundgebühr und die beiden Terminsgebühren deutlich unterhalb der Mittelgebühr fest. Der Anwalt legte dagegen Sofortige Beschwerde ein. Er war der Ansicht, sein Ermessen bei der Gebührenfestsetzung sei vom Gericht zu Unrecht beschnitten worden. Der Fall landete somit zur endgültigen Entscheidung beim Landgericht Nürnberg-Fürth.
Nach welchen Regeln bestimmt ein Anwalt sein Honorar?
Um die Entscheidung des Gerichts zu verstehen, müssen Sie das System der Anwaltsvergütung in Deutschland kennen. Die Gebühren sind im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) geregelt. Für viele Tätigkeiten, insbesondere im Strafrecht, gibt das Gesetz keinen festen Betrag vor, sondern einen Gebührenrahmen – also einen Mindest- und einen Höchstbetrag.
Der Anwalt muss seine Gebühr innerhalb dieses Rahmens nach bestem Wissen und Gewissen festlegen. Dabei muss er sich an den Kriterien des § 14 RVG orientieren. Dazu gehören unter anderem:
- Der Umfang und die Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit
- Die Bedeutung der Angelegenheit für den Mandanten
- Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Mandanten
- Ein eventuelles Haftungsrisiko für den Anwalt
Wenn ein Fall in all diesen Punkten durchschnittlich ist, gilt die Mittelgebühr – also der Betrag genau in der Mitte zwischen der Mindest- und Höchstgebühr – als angemessen. Der Anwalt übt hier ein sogenanntes „Leistungsbestimmungsrecht“ aus: Er bestimmt die Höhe der Gebühr. Diese Bestimmung ist für den Mandanten bindend, solange sie „billig“, also angemessen, ist.
Der entscheidende Punkt im vorliegenden Fall ist jedoch § 14 Abs. 1 Satz 4 RVG. Diese Vorschrift besagt: Wenn die Staatskasse die Kosten tragen muss, ist die Bestimmung des Anwalts nicht bindend, wenn sie unbillig ist. Das Gericht kann also überprüfen, ob die vom Anwalt angesetzte Gebühr angesichts der Kriterien des § 14 RVG fair ist.
Warum stufte das Gericht die Forderung des Anwalts als unbillig ein?
Das Landgericht Nürnberg-Fürth wies die Beschwerde des Anwalts als unbegründet zurück und bestätigte die Kürzung durch das Amtsgericht. Die Richter legten dabei einen strengen Maßstab an, der sich an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) orientiert. Eine vom Anwalt bestimmte Gebühr ist dann unbillig und für die Staatskasse nicht bindend, wenn sie die objektiv angemessene Gebühr um mehr als 20 % übersteigt.
Das Gericht analysierte akribisch jeden einzelnen Punkt der Gebührenrechnung und wog die Argumente des Verteidigers gegen die Fakten aus der Verfahrensakte ab.
Die Grundgebühr: Warum war der Fall unterdurchschnittlich?
Die Grundgebühr (Nr. 4100 VV RVG) soll die erstmalige Einarbeitung des Anwalts in den Fall abgelten. Der Verteidiger argumentierte, der Fall sei nicht geringfügig gewesen, er habe eine „Konfliktverteidigung“ führen müssen, und die Sprachprobleme seiner Mandantin hätten zusätzlichen Aufwand bedeutet.
Das Gericht folgte dem nicht. Es stellte fest, dass die Akte bei Mandatsübernahme nur 42 Blatt umfasste. In der Rechtsprechung gilt ein Umfang von bis zu 50 Seiten als klar unterdurchschnittlich und rechtfertigt keine Mittelgebühr. Auch die rechtliche Bewertung des Nachbarschaftsstreits sei nicht sonderlich schwierig gewesen. Der pauschale Hinweis auf eine „Konfliktverteidigung“ reiche nicht aus, um einen Mehraufwand zu belegen.
Besonders interessant ist die Auseinandersetzung mit den angeblichen Sprachproblemen. Das Gericht stellte fest, dass die Mandantin vor der Beauftragung des Anwalts selbst Schriftsätze in gut verständlichem Deutsch verfasst und sich auch in der Hauptverhandlung selbst geäußert hatte. Ein erhöhter Aufwand für den Anwalt war daher für das Gericht nicht ersichtlich. Schließlich berücksichtigten die Richter auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Mandantin – eine alleinerziehende Mutter in Umschulung. Da die Staatskasse nur die Kosten erstatten muss, die die Mandantin auch selbst hätte tragen müssen, wirkte sich ihre unterdurchschnittliche finanzielle Situation ebenfalls gebührenmindernd aus.
Die Rechnung des Gerichts war klar: Der vom Amtsgericht festgesetzte Betrag von 165 € sei angemessen. Ein Aufschlag von 20 % würde eine Obergrenze von 198 € ergeben. Die vom Anwalt geforderten 220 € lagen damit deutlich über der Toleranzgrenze und waren als unbillig einzustufen.
Die Terminsgebühren: Weshalb zählte die kurze Dauer der Verhandlung?
Auch bei den beiden Terminsgebühren (Nr. 4108 VV RVG) hielt das Gericht die Forderung des Anwalts für überzogen. Ein entscheidendes Kriterium für die Höhe dieser Gebühr ist die Dauer des Gerichtstermins. Im konkreten Fall dauerten die beiden Verhandlungen lediglich 21 und 29 Minuten.
Das Gericht bewertete diese Dauer als deutlich unterdurchschnittlich. Die Sache war überschaubar, eine aufwendige Zeugenbefragung fand nicht statt, und die Angeklagte konnte sich selbst verteidigen. Die vom Amtsgericht angesetzten 225 € pro Termin seien daher fair. Die vom Verteidiger geforderten 302,50 € überschritten auch hier die 20-%-Grenze (225 € + 20 % = 270 €) und waren somit ebenfalls unbillig.
Die Verfahrensgebühr: Warum wurden andere Tätigkeiten hier nicht berücksichtigt?
Der Verteidiger hatte zusätzlich argumentiert, er habe eine ausführliche schriftliche Stellungnahme eingereicht, umfangreiche Besprechungen geführt und sogar am Wochenende gearbeitet. Das Gericht wies diese Argumente zurück, aber mit einer wichtigen Begründung: All diese Tätigkeiten sind bereits durch eine andere Gebühr abgedeckt – die Verfahrensgebühr (Nr. 4106 VV RVG).
Diese Gebühr hatte das Amtsgericht in der vom Anwalt beantragten Höhe, die sogar leicht über der Mittelgebühr lag, anstandslos festgesetzt. Damit war die gesamte vorgerichtliche Tätigkeit, einschließlich Schriftsätzen und Mandantengesprächen, bereits honoriert. Diese Tätigkeiten konnten daher nicht noch einmal herangezogen werden, um eine Erhöhung der Grund- oder Terminsgebühren zu rechtfertigen.
Was bedeutet das Urteil jetzt für Sie?
Die Entscheidung des Landgerichts Nürnberg-Fürth ist eine klare Botschaft an die Anwaltschaft: Das Recht zur Gebührenbestimmung ist kein Freibrief, insbesondere wenn am Ende der Steuerzahler die Rechnung bezahlt. Für Mandanten, die nach einem Freispruch auf eine Kostenerstattung durch die Staatskasse hoffen, bedeutet das Urteil, dass nur objektiv notwendige und angemessene Kosten übernommen werden.
Checkliste: Wann die Staatskasse die Mittelgebühr kürzen darf
Die Gerichtsentscheidung liefert klare Kriterien, wann eine Kürzung der vom Anwalt angesetzten Mittelgebühr wahrscheinlich ist. Prüfen Sie diese Punkte, um eine realistische Einschätzung der erstattungsfähigen Kosten zu erhalten:
- Geringer Aktenumfang: Umfasst die Akte deutlich weniger als 100 Seiten (im Urteil wurden bis 50 Seiten als klar unterdurchschnittlich bewertet)?
- Kurze Verhandlungsdauer: Dauerten die Gerichtstermine jeweils deutlich unter einer Stunde?
- Einfache Rechtsfragen: Handelt es sich um einen rechtlich unkomplizierten Standardfall ohne juristische Besonderheiten?
- Überschaubarer Sachverhalt: Ist der Sachverhalt einfach und gibt es nur wenige Beweismittel (z.B. nur einen Zeugen)?
- Unterdurchschnittliche Einkommensverhältnisse: Verfügt der Mandant nur über ein geringes Einkommen? Dies kann die als „billig“ angesehene Gebühr reduzieren.
- Keine besonderen Schwierigkeiten: Lagen objektiv nachweisbare Hürden wie eine notwendige Übersetzung durch einen Dolmetscher oder eine extrem komplexe Beweisaufnahme vor? Allgemeine Behauptungen über eine „schwierige“ Verteidigung genügen nicht.
- Abgeltung durch andere Gebühren: Ist der geltend gemachte Mehraufwand (z.B. für Schriftsätze) bereits durch die (genehmigte) Verfahrensgebühr abgedeckt?
Die Urteilslogik
Wenn die Staatskasse die Kosten trägt, beurteilt das Gericht die Angemessenheit von Anwaltsgebühren anhand streng objektiver Kriterien und entbindet sich von der Bestimmung des Verteidigers.
- Grenze der Gebührenbestimmung: Die Festsetzung der Anwaltsgebühr bindet die Staatskasse nur, solange sie die objektiv angemessene Höhe nicht um mehr als 20 Prozent überschreitet; andernfalls gilt die Gebühr als unbillig und wird gekürzt.
- Beweislast der Durchschnittlichkeit: Die Annahme der Mittelgebühr setzt voraus, dass der Fall mindestens durchschnittliche Komplexität aufweist; geringer Aktenumfang, die einfache Rechtslage oder extrem kurze Verhandlungsdauern stufen die anwaltliche Tätigkeit als unterdurchschnittlich ein.
- Ausschluss der Doppelhonorierung: Spezifische Tätigkeiten, wie ausführliche Mandantengespräche oder Schriftsätze, rechtfertigen keine Erhöhung der Grund- oder Terminsgebühren, wenn die Verfahrensgebühr diesen gesamten Aufwand bereits vollständig abgilt.
Das Gericht überwacht die Billigkeit der Gebühren und schützt damit das Prinzip der Verhältnismäßigkeit öffentlicher Ausgaben.
Benötigen Sie Hilfe?
Müssen Sie eine Kürzung der Mittelgebühr nach dem Freispruch befürchten? Kontaktieren Sie uns für eine vertrauliche rechtliche Ersteinschätzung Ihrer Situation.
Experten Kommentar
Ein Freispruch fühlt sich für Mandant und Anwalt wie der volle Sieg an, doch dieser Beschluss zeigt, dass Erfolg und Kosten zwei verschiedene Dinge sind, sobald der Steuerzahler die Rechnung übernimmt. Dieses Urteil zieht eine klare rote Linie für Anwälte: Die Mittelgebühr ist kein Standard, sondern muss objektiv durch Aktenumfang und Verhandlungsdauer begründet werden. Für die Staatskasse zählt Härte vor Höflichkeit, und die 20-Prozent-Toleranzgrenze wird rigoros als Obergrenze des Erstattbaren angewandt. Besonders praxisrelevant: Wer die Kosten festsetzt, muss sogar die geringen Einkommensverhältnisse des Freigesprochenen berücksichtigen, was die als „billig“ angesehene Gebühr weiter reduziert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wer trägt die Anwaltskosten bei einem Freispruch und wann wird die Rechnung gekürzt?
Die Staatskasse (Bundeskasse oder Landeskasse) ist verpflichtet, die notwendigen Auslagen des Freigesprochenen zu erstatten. Dazu gehören die Kosten für den Strafverteidiger. Diese Zusage ist allerdings an eine wichtige Bedingung geknüpft. Die Staatskasse begleicht die Rechnung nur, wenn die angesetzten Anwaltsgebühren objektiv als billig, also angemessen, gelten.
Die Messlatte für die Staatskasse ist dabei strenger als in der direkten Abrechnung zwischen Anwalt und Mandant. Die Höhe der Anwaltsgebühr muss sich strikt nach objektiven Kriterien des § 14 RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) richten. Ist die Bestimmung des Anwalts unbillig, ist sie für die Staatskasse nicht bindend. Eine Kürzung ist zulässig, wenn die Forderung die objektiv angemessene Gebühr um mehr als 20 Prozent überschreitet.
Die Staatskasse kürzt die Rechnung, wenn objektive Faktoren im Fall fehlen, die eine höhere als die mittlere Gebühr rechtfertigen. Der Anwalt muss seinen Aufwand durch Kriterien wie den Aktenumfang, die Komplexität des Sachverhalts oder die Verhandlungsdauer belegen. Ein Freispruch allein berechtigt den Anwalt nicht, automatisch die Höchstgebühren anzusetzen. Wenn es sich um einen einfachen Fall mit geringem Aktenumfang oder kurzen Gerichtsterminen handelt, liegt der notwendige Aufwand oft unter dem Durchschnitt.
Prüfen Sie die Kostenrechnung Ihres Anwalts genau und fordern Sie die schriftliche Begründung der Bezirksrevisorin für die Kürzung der Gebührenpositionen an.
Wann gelten die Anwaltsgebühren nach einem Freispruch als „unbillig“ und wie hoch ist die Toleranzgrenze?
Die Staatskasse ist nur zur Erstattung der objektiv notwendigen und angemessenen Anwaltskosten verpflichtet. Eine Gebühr gilt gegenüber dem Staat als unbillig und ist damit nicht bindend, sobald sie die als angemessen erachtete Summe um mehr als 20 Prozent übersteigt. Diese feste Schwelle von 20 % ist die juristische Toleranzgrenze, die Gerichte zur Überprüfung des anwaltlichen Bestimmungsrechts heranziehen.
Die Regelung zur Unbilligkeit stützt sich auf § 14 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Anwälte müssen die Gebühren nach Faktoren wie Umfang, Schwierigkeit und Bedeutung des Falls festlegen. Errechnet das Gericht anhand dieser Kriterien eine objektiv angemessene Gebühr, darf der Anwalt davon nur um maximal 20 Prozent abweichen. Wird diese Toleranzgrenze überschritten, verliert die Staatskasse die Bindung an die anwaltliche Forderung und kürzt den überhöhten Betrag.
Dieses Vorgehen demonstrierte das Landgericht Nürnberg-Fürth in einem konkreten Fall. Das Gericht bestimmte 165 Euro als angemessenen Betrag für die Grundgebühr. Durch Hinzurechnung der 20 Prozent ergab sich eine Obergrenze von 198 Euro. Da der Anwalt jedoch 220 Euro forderte, lag seine Berechnung deutlich über der zulässigen Schwelle und wurde daher als unbillig eingestuft.
Um eine mögliche Kürzung einzuschätzen, rechnen Sie zur vom Gericht festgesetzten Gebühr 20 Prozent hinzu und vergleichen das Ergebnis mit der ursprünglichen Forderung Ihres Anwalts.
Welcher Aktenumfang oder welche Verhandlungsdauer führt zur Kürzung der Anwaltsgebühren?
Gerichte stützen Kürzungen der Anwaltsgebühren auf objektiv messbare Fakten des Verfahrens. Bei der Prüfung der Angemessenheit dienen quantifizierbare Schwellenwerte als klare Indikatoren für einen unterdurchschnittlichen Fall. Ein geringer Aktenumfang und eine kurze Verhandlungsdauer rechtfertigen in der Regel keine Ansetzung der Mittelgebühr gegenüber der Staatskasse.
Die Grundgebühr soll den Anwalt für die erstmalige Einarbeitung in den Sachverhalt entschädigen. Die Rechtsprechung betrachtet einen Fall als klar unterdurchschnittlich, wenn die Akte bei Mandatsübernahme nur etwa 50 Seiten oder weniger umfasst. Das Landgericht Nürnberg-Fürth stellte in einem Fall fest, dass nur 42 Blatt vorlagen. Dieser geringe Umfang belegte für die Richter einen niedrigen Einarbeitungsaufwand, sodass eine Kürzung der Grundgebühr unterhalb der Mittelgebühr zulässig war.
Auch die Terminsgebühr wird anhand der tatsächlichen Dauer des Gerichtstermins beurteilt. Wenn die Hauptverhandlung deutlich unter 30 Minuten liegt, bewerten Gerichte den Zeitaufwand oft als unterdurchschnittlich. Im genannten Fall führten Verhandlungszeiten von lediglich 21 beziehungsweise 29 Minuten pro Termin zu einer deutlichen Minderung der Terminsgebühren, weil kein überdurchschnittlicher Aufwand für Vernehmungen oder komplexe Erklärungen nötig war.
Lassen Sie sich die Seitenanzahl der Akte und die offizielle Protokolldauer der Hauptverhandlungstermine von Ihrem Anwalt mitteilen.
Was kann ich tun, wenn die Staatskasse meine Anwaltsgebühren nach dem Freispruch kürzt?
Die sofortige Beschwerde ist der korrekte juristische Rechtsbehelf gegen einen Kürzungsbeschluss der Staatskasse. Ihr Anwalt muss diese Beschwerde beim zuständigen Landgericht oder Oberlandesgericht einlegen. Die Erfolgsaussicht hängt stark davon ab, ob Ihr Anwalt einen objektiv messbaren Mehraufwand begründet. Entscheidend sind harte Fakten, die über die Normaltätigkeit des Anwalts hinausgehen.
Wenn das Gericht die Gebühren als unbillig (§ 14 RVG) eingestuft hat, muss die Beschwerde innerhalb einer kurzen Frist eingereicht werden. Der Anwalt muss dabei beweisen, dass die ursprüngliche Forderung die objektiv angemessene Gebühr nicht um mehr als 20 Prozent übersteigt. Gerichte lehnen pauschale Argumente wie allgemeiner Stress oder eine aggressive „Konfliktverteidigung“ in der Regel ab, da diese subjektiv sind und nicht auf den Fall zugeschnitten.
Der objektive Mehraufwand muss Kriterien erfüllen, die nicht bereits durch die Verfahrensgebühr abgedeckt sind. Eine erfolgreiche Beschwerde vermeidet Begründungen, die sich auf viele Besprechungen oder ausführliche Schriftsätze stützen, da diese Tätigkeiten bereits honoriert sind. Stattdessen zählen komplexe Sachverhalte, die Notwendigkeit eines Dolmetschers oder eine aufwendige Beweiserhebung als stichhaltige Argumente. Beachten Sie außerdem, dass Gerichte Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse prüfen, was die als „billig“ angesehene Maximalgebühr mindern kann.
Fordern Sie Ihren Anwalt auf, die Beschwerde primär mit dem Umfang und der Komplexität der Beweiserhebung zu untermauern, nicht mit der bloßen Aktenanzahl oder kurzen Verhandlungsterminen.
Wie muss der Anwalt die Mittelgebühr begründen, damit sie von der Staatskasse voll erstattet wird?
Die Staatskasse erstattet die Mittelgebühr nur, wenn der Anwalt objektiv beweist, dass der Fall überdurchschnittlich schwierig oder umfangreich war. Eine bloße Behauptung oder der Erfolg eines Freispruchs genügen nicht als Begründung. Die Argumentation muss zwingend auf den gesetzlichen Kriterien des § 14 RVG aufbauen. Der Anwalt muss strategisch dokumentieren, um Kürzungen durch die Bezirksrevisorin präventiv zu vermeiden.
Der Schlüssel liegt in der sauberen Trennung der einzelnen Gebührenpositionen. Richter prüfen streng, ob der geltend gemachte Mehraufwand nicht bereits durch eine andere Gebühr abgedeckt ist. Beispielsweise ist der gesamte Aufwand für umfangreiche Schriftsätze, Stellungnahmen oder Besprechungen bereits mit der Verfahrensgebühr (Nr. 4106 VV RVG) abgegolten. Diese Tätigkeiten dürfen daher nicht zur Erhöhung der Grundgebühr oder der Terminsgebühr herangezogen werden.
Für eine erfolgreiche Begründung der Mittelgebühr zählt nur der objektive Nachweis von Mehraufwand in Bezug auf Grund- und Terminsgebühren. Akzeptierte Gründe sind etwa die Notwendigkeit eines vereidigten Dolmetschers oder ein Aktenumfang von deutlich über 100 Seiten. Entscheidend ist auch die Bedeutung der Sache und die Wirtschaftslage des Mandanten: Bei unterdurchschnittlichem Einkommen muss der Anwalt oft eine geringere Gebühr ansetzen, da die Staatskasse nur Kosten erstattet, die der Mandant auch selbst hätte tragen müssen.
Lassen Sie sich bei Mandatserteilung die Kriterien für eine Mittelgebühr darlegen und fordern Sie Ihren Anwalt auf, erhöhten Aufwand von Anfang an spezifisch zu dokumentieren.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Bezirksrevisorin
Die Bezirksrevisorin ist eine speziell eingesetzte Beamtin oder ein Beamter der Justizverwaltung, die im Auftrag der Staatskasse die Kostenrechnungen von Anwälten prüft. Juristen nennen diese Funktion auch die „Hüterin der Staatskasse“, denn sie sorgt dafür, dass nur objektiv angemessene und notwendige Auslagen des Steuerzahlers erstattet werden.
Beispiel: Nach dem Freispruch prüfte die zuständige Bezirksrevisorin die Kostenrechnung des Strafverteidigers und schlug dem Gericht eine deutliche Kürzung der angesetzten Mittelgebühren vor.
Leistungsbestimmungsrecht
Das Leistungsbestimmungsrecht ist das gesetzlich verbriefte Recht des Anwalts, die Höhe seiner Gebühren im Rahmen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) selbst festzulegen. Das Gesetz überträgt dem Anwalt diese Aufgabe, weil er seinen eigenen Aufwand und die Schwierigkeit des Falles am besten einschätzen kann, doch die Bestimmung ist nur bindend, wenn sie „billig“ (angemessen) ist.
Beispiel: Der Anwalt machte von seinem Leistungsbestimmungsrecht Gebrauch, indem er für die Hauptverhandlung die Mittelgebühr ansetzte, obwohl das Landgericht den geringen Aktenumfang später als unterdurchschnittlich einstufte.
Mittelgebühr
Die Mittelgebühr ist jener Betrag, der exakt in der Mitte zwischen der Mindest- und Höchstgebühr eines gesetzlichen Gebührenrahmens liegt und in der Praxis für durchschnittliche Fälle angesetzt wird. Diese Gebührenhöhe dient als Orientierungspunkt, denn nur wenn ein Fall in Schwierigkeit, Umfang und Bedeutung im normalen Bereich liegt, gilt die Mittelgebühr als objektiv angemessen.
Beispiel: Da der Fall vor dem Amtsgericht Nürnberg weder besonders komplex noch sehr umfangreich war und nur kurze Termine anfielen, argumentierte das Gericht, dass die angesetzte Mittelgebühr für Grund- und Terminsgebühren unbillig sei.
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, kurz RVG, ist die zentrale Vorschriftensammlung in Deutschland, die festlegt, welche Gebühren Anwälte für ihre Tätigkeiten abrechnen dürfen. Es schafft eine notwendige Transparenz und Rechtssicherheit, indem es für die meisten anwaltlichen Leistungen einen festen Rahmen aus Mindest- und Höchstbeträgen vorgibt.
Beispiel: Um die strittige Höhe der Anwaltsgebühren nach dem Freispruch zu klären, musste das Landgericht die Kriterien des § 14 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes auf den vorliegenden Fall anwenden.
Sofortige Beschwerde
Als Sofortige Beschwerde bezeichnen Juristen ein spezifisches, schnelles Rechtsmittel, mit dem man gerichtliche Entscheidungen in bestimmten Verfahrensfragen, wie zum Beispiel bei Kostenfestsetzungen, anfechten lässt. Dieses Instrument ist wichtig, um die Entscheidung der ersten Instanz schnell durch ein höheres Gericht überprüfen zu lassen, ohne dass das gesamte Hauptverfahren neu aufgerollt werden muss.
Beispiel: Nachdem das Amtsgericht Nürnberg die Anwaltsgebühren gekürzt hatte, legte der Verteidiger sofortige Beschwerde ein, um die endgültige Entscheidung des Landgerichts Nürnberg-Fürth zu erwirken.
Unbillig
Eine Anwaltsgebühr ist unbillig, wenn sie die objektiv angemessene Gebühr, die das Gericht anhand der Kriterien des § 14 RVG errechnet hat, um mehr als 20 % überschreitet. Diese strenge Definition wird angewandt, sobald die Staatskasse die Rechnung begleichen muss, und dient als feste Toleranzgrenze zum Schutz des Steuerzahlers vor überhöhten Forderungen.
Beispiel: Die vom Anwalt geforderte Grundgebühr war nach Auffassung des Landgerichts unbillig, weil 220 Euro gefordert wurden, obwohl die juristische Obergrenze nach Hinzurechnung von 20 % nur bei 198 Euro lag.
Das vorliegende Urteil
LG Nürnberg-Fürth – Az.: 12 Qs 34/25 – Beschluss vom 19.09.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.