Eine 2.000 Euro Geldstrafe für einen Bürgergeld-Empfänger in Borna stellte dessen Existenzminimum auf den Prüfstand. Doch der Gesetzgeber hat klare Regeln, wie bei einer solchen Geldstrafe das Existenzminimum gewahrt bleiben muss.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Experten-Kommentar
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Gilt die 75-Prozent-Regel zur Tagessatz-Berechnung auch für andere Geringverdiener?
- Was passiert, wenn ich eine Geldstrafe als Bürgergeld-Empfänger nicht zahlen kann?
- Wie gehe ich vor, wenn mein Tagessatz im Strafbefehl zu hoch angesetzt ist?
- Darf mein Bürgergeld auch für andere Schulden gepfändet werden?
- Wie kann ich präventiv sicherstellen, dass mein Einkommen bei einer Geldstrafe korrekt berücksichtigt wird?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 5 Qs 29/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landgericht Leipzig
- Datum: 12.06.2025
- Aktenzeichen: 5 Qs 29/25
- Verfahren: Beschwerdeverfahren in einem Strafbefehlsverfahren
- Rechtsbereiche: Geldstrafenbemessung, Existenzminimum, Sozialleistungen
- Das Problem: Ein Mann sollte wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine hohe Geldstrafe zahlen, obwohl er Bürgergeld bekommt. Er legte Einspruch ein, weil die Höhe der Tagesrate sein Existenzminimum gefährdete. Die Staatsanwaltschaft beschwerte sich, weil ein untergeordnetes Gericht die Höhe der Tagesrate nicht korrekt festlegte.
- Die Rechtsfrage: Wie wird die Höhe einer Geldstrafe für jemanden berechnet, der Bürgergeld erhält? Muss das Gericht dabei sicherstellen, dass dem Verurteilten genug Geld zum Leben übrig bleibt?
- Die Antwort: Ja, das Gericht muss sicherstellen, dass dem Verurteilten genug Geld zum Leben bleibt. Die Tagesrate einer Geldstrafe darf höchstens so hoch sein, dass ihm nach Abzug der Strafe mindestens 75 Prozent des Bürgergeld-Regelbedarfs verbleiben. Das Gericht setzte die Tagesrate auf 5,00 EUR fest.
- Die Bedeutung: Dieses Urteil schützt das Existenzminimum von Bürgergeld-Empfängern bei der Festsetzung von Geldstrafen. Es stellt klar, dass die Gerichte die persönlichen Lebenshaltungskosten berücksichtigen müssen und nicht den gesamten Betrag einer Bedarfsgemeinschaft zugrunde legen dürfen.
Der Fall vor Gericht
Wie konnten aus 2.000 Euro Strafe plötzlich nur noch 200 Euro werden?
Ein Strafbefehl über 2.000 Euro, ausgestellt für einen Mann, der am Existenzminimum lebt. Am Ende des Rechtsstreits steht dieselbe Schuld, aber eine Geldstrafe von nur noch 200 Euro. Was war geschehen?
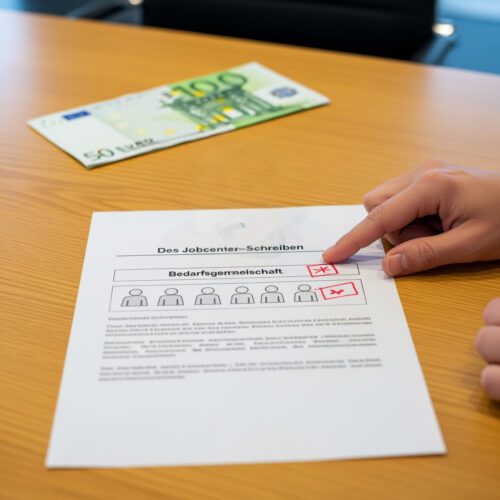
Kein juristischer Freispruch, sondern eine simple, aber folgenschwere Rechenaufgabe, die das Landgericht Leipzig zu lösen hatte. Ein Mann war ohne Führerschein Kleintransporter gefahren. Das Amtsgericht Borna reagierte prompt und verhängte eine Geldstrafe: 40 Tagessätze zu je 50 Euro. Macht 2.000 Euro. Das Gericht schätzte das Einkommen des Mannes, wie es das Gesetz in solchen Fällen erlaubt. Dieser erste Blick sollte sich als grob falsch erweisen.
Weshalb war die erste Schätzung des Gerichts ein Griff ins Leere?
Der Verteidiger des Mannes legte Einspruch ein. Er beschränkte ihn gezielt auf einen einzigen Punkt: die Höhe des Tagessatzes. Sein Mandant war kein Normalverdiener. Er war arbeitssuchend und bezog Bürgergeld. Zum Beweis legte der Anwalt einen Bescheid des Jobcenters vor. Daraus ging hervor, dass der Mann in einer Bedarfsgemeinschaft lebte und monatlich 905,48 Euro ausgezahlt bekam. Diese Zahl war der Knackpunkt. Das erste Gericht hatte vermutlich eine ähnliche Summe als Basis für seine Schätzung genommen und durch 30 Tage geteilt. Hier lag der Denkfehler. Der Betrag von 905,48 Euro war nicht das persönliche Einkommen des Mannes. Es war die Gesamtleistung für eine ganze Bedarfsgemeinschaft – also auch für andere Personen. Ihm allein stand nur ein Bruchteil davon zu.
Welchen cleveren Rechenweg schlug die Verteidigung vor?
Der Anwalt argumentierte, dass eine Geldstrafe einen Menschen nicht unter das Existenzminimum drücken darf. Das Gesetz selbst schreibt vor, dass der „unerlässliche Betrag“ zum Leben bleiben muss. Statt einer groben Schätzung präsentierte die Verteidigung eine präzise Formel. Die Logik war einfach: Man nimmt den Regelbedarf für einen Alleinstehenden – damals 563 Euro. Von diesem Betrag müssen dem Verurteilten nach Abzug der monatlichen Strafzahlung mindestens 75 Prozent verbleiben. Im Klartext bedeutet das: 75 Prozent von 563 Euro sind 422 Euro. Dieser Betrag ist unantastbar. Die Differenz zum vollen Regelbedarf – also 141 Euro – ist der Betrag, den der Mann monatlich für seine Strafe aufbringen kann. Teilt man diese 141 Euro durch 30 Tage, ergibt sich ein Tagessatz von knapp unter 5 Euro. Der Verteidiger beantragte, den Tagessatz auf höchstens 8 Euro, idealerweise aber auf 5 Euro festzusetzen.
Warum folgte das Landgericht dieser 75-Prozent-Regel?
Das Landgericht Leipzig teilte die Ansicht der Verteidigung vollständig. Die Richter erkannten, dass die starre Anwendung des Nettoeinkommensprinzips bei Bürgergeld-Empfängern scheitert. Sie würde den gesetzlichen Schutz des Existenzminimums pulverisieren. Die Kammer stützte sich auf eine neuere Rechtsprechung anderer Obergerichte, die genau diese 75-Prozent-Grenze etabliert hat. Sie dient als Schutzschwelle. Sie stellt sicher, dass die Bestrafung nicht die Lebensgrundlage zerstört. Die Richter übernahmen die Berechnung des Verteidigers Punkt für Punkt. 563 Euro Regelbedarf, davon 75 Prozent als unantastbares Minimum. Der Restbetrag von 141 Euro ist für die Strafe verfügbar. Das ergibt einen Tagessatz von gerundet 5 Euro. Die Geldstrafe sank damit von 2.000 Euro auf 200 Euro. Die ursprüngliche Schätzung des Amtsgerichts war damit vom Tisch.
Wer musste am Ende die Kosten für das Verfahren tragen?
Obwohl die Staatsanwaltschaft das Verfahren mit ihrer Beschwerde erst ins Rollen gebracht hatte – sie hatte die formale Lücke im Beschluss des Amtsgerichts beanstandet –, musste sie die Kosten nicht tragen. Das Landgericht entschied, dass die Staatskasse für die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten aufkommt. Die Begründung ist einleuchtend. Die Staatsanwaltschaft handelte hier nicht als klassische Anklägerin gegen den Mann. Sie agierte vielmehr als Kontrollorgan, um einen fehlerhaften Beschluss korrigieren zu lassen. Sie handelte im Interesse der Rechtsordnung. Und wenn der Staat seine eigenen Fehler korrigiert, trägt er dafür auch die Kosten.
Die Urteilslogik
Gerichte passen die Geldstrafen von Bürgergeld-Empfängern präzise an, um deren Existenzminimum zu sichern.
- Existenzminimumsschutz bei Geldstrafen: Gerichte stellen sicher, dass eine Geldstrafe niemals das Existenzminimum des Verurteilten unterschreitet.
- Spezifische Tagessatzberechnung für Bürgergeld-Empfänger: Zur Berechnung des Tagessatzes für Bürgergeld-Empfänger ziehen Gerichte den individuellen Regelbedarf heran und schützen dabei mindestens 75 Prozent als unantastbares Existenzminimum.
- Individuelle Einkommenszurechnung bei Bedarfsgemeinschaften: Gerichte rechnen Leistungen an Bedarfsgemeinschaften nicht pauschal einer Einzelperson zu, wenn sie das individuelle Einkommen für eine Geldstrafe bemessen.
Diese präzisen Berechnungsmethoden gewährleisten, dass Gerichte Strafen gerecht bemessen und zugleich die menschliche Würde achten.
Benötigen Sie Hilfe?
Beeinträchtigt eine Geldstrafe Ihr Existenzminimum als Bürgergeld-Empfänger? Erhalten Sie eine unverbindliche Ersteinschätzung Ihrer Situation.
Experten-Kommentar
Geldstrafe zahlen, wenn jeder Euro zählt – das ist eine Kunst für sich. Dieses Urteil macht klar: Wer Bürgergeld bezieht, muss zwar für Fehler geradestehen, aber die Strafe darf die Lebensgrundlage nicht zerstören. Das Gericht zieht hier eine klare Linie und rechnet das Einkommen einer Bedarfsgemeinschaft nicht einfach dem Einzelnen zu. Die 75-Prozent-Regel des Regelbedarfs schützt vor Überschuldung und stellt sicher, dass Tagessätze für Bürgergeld-Empfänger wirklich fair bemessen werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gilt die 75-Prozent-Regel zur Tagessatz-Berechnung auch für andere Geringverdiener?
Ja, die zugrunde liegende Logik der 75-Prozent-Regel ist nicht exklusiv für Bürgergeld-Empfänger. Sie dient dem generellen Schutz des gesetzlichen Existenzminimums, das auch für andere Geringverdiener gilt, deren Einkommen kaum über dem Regelbedarf liegt. Gerichte orientieren sich hier am unantastbaren Minimum, um eine Bestrafung nicht existenzvernichtend zu machen.
Die Regel ist eine konkrete Anwendung des Rechtsprinzips, dass niemand durch eine Geldstrafe in die absolute Armut getrieben werden darf. Sie konkretisiert den im Gesetz verankerten Schutz des „unerlässlichen Betrags“ zum Leben. Das Landgericht Leipzig stützte sich hier auf eine wegweisende Rechtsprechung höherer Gerichte. Diese Gerichte haben festgelegt, dass 75 Prozent des Regelbedarfs für Alleinstehende als absolute Untergrenze unantastbar bleiben müssen.
Es geht also nicht primär darum, ob jemand Bürgergeld bezieht, sondern darum, ob das Nettoeinkommen tatsächlich das gesetzlich garantierte Existenzminimum überschreitet. Ob Sie nun Bürgergeld-Empfänger, Minijobber, Rentner mit geringer Rente oder Aufstocker sind – wenn Ihr Einkommen nah am oder unter dem maßgeblichen Regelbedarf liegt, kann diese Schutzregel greifen, um Ihre Lebensgrundlage zu wahren.
Denken Sie an die Situation wie an das Zwiebelschalenprinzip: Nur der äußerste, entbehrliche Teil Ihrer finanziellen Mittel darf für eine Geldstrafe herangezogen werden. Der Kern – Ihr Existenzminimum – muss dabei stets intakt und unantastbar bleiben.
Ermitteln Sie den aktuellen Regelbedarf für Alleinstehende. Dieser Wert ändert sich jährlich. Vergleichen Sie diesen Betrag sorgfältig mit Ihrem monatlichen Nettoeinkommen. Diese erste Einschätzung liefert Ihnen eine solide Grundlage für mögliche Argumentationen und zeigt Ihnen Ihre Spielräume auf.
Was passiert, wenn ich eine Geldstrafe als Bürgergeld-Empfänger nicht zahlen kann?
Wenn Sie als Bürgergeld-Empfänger eine Geldstrafe selbst nach einer möglichen Anpassung des Tagessatzes nicht zahlen können, droht als letzte und gravierendste Konsequenz die Ersatzfreiheitsstrafe. Das bedeutet: Für jeden unbezahlten Tagessatz wird ein Tag Haft verhängt. Wichtig ist, frühzeitig zu handeln und nicht abzuwarten.
Geldstrafen sind ernste strafrechtliche Sanktionen. Juristen nennen das Vollstreckung. Zwar bemühen sich Gerichte – wie der Fall aus Leipzig zeigt – den Tagessatz so anzupassen, dass Ihr Existenzminimum geschützt wird. Doch selbst dann bleibt die Pflicht zur Zahlung bestehen. Eine solche Strafe ist keine Option.
Können Sie dennoch nicht zahlen, wird die zuständige Staatsanwaltschaft aktiv. Sie ist die Vollstreckungsbehörde und wird zunächst Mahnungen versenden. Bleibt die Zahlung aus, wird unweigerlich eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. Für jeden nicht beglichenen Tagessatz müssen Sie einen Tag im Gefängnis verbringen. Eine ernstzunehmende Konsequenz, die viele Betroffene zu Recht fürchten.
Ein passender Vergleich ist der eines Zeitplans: Wenn Sie eine Geldstrafe erhalten, ist das wie eine verbindliche Verabredung. Erscheinen Sie nicht pünktlich – sprich, zahlen oder melden sich nicht –, folgt ein automatischer nächster Schritt. Dieser ist die Ersatzfreiheitsstrafe, bei der für jeden nicht beglichenen Tagessatz ein Tag im Gefängnis ansteht. Das System ist gnadenlos, wenn man nicht aktiv wird.
Das Wichtigste ist: Ignorieren Sie niemals Zahlungsaufforderungen der Justiz. Kontaktieren Sie stattdessen umgehend die zuständige Staatsanwaltschaft (Vollstreckungsbehörde). Erläutern Sie dort Ihre detaillierte finanzielle Situation und die Gründe für Ihre Zahlungsunfähigkeit. Oft lässt sich eine Ratenzahlung vereinbaren, eine Stundung erwirken oder sogar die Umwandlung in gemeinnützige Arbeit erreichen, bevor es zur Ersatzfreiheitsstrafe kommt. Proaktives Handeln kann viel Ärger ersparen.
Wie gehe ich vor, wenn mein Tagessatz im Strafbefehl zu hoch angesetzt ist?
Erhält man einen Strafbefehl, bei dem der Tagessatz zu hoch angesetzt ist, muss man innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen. Dieser Einspruch sollte gezielt auf die Höhe des Tagessatzes beschränkt werden. Legen Sie dabei detaillierte Einkommensnachweise vor und argumentieren Sie mit der sogenannten 75-Prozent-Regel, um Ihr gesetzlich geschütztes Existenzminimum zu wahren. Schnelles Handeln ist hier entscheidend.
Gerichte schätzen das Einkommen oft grob, besonders wenn keine aktuellen Nachweise vorliegen. Genau hier liegt der Knackpunkt für viele Geringverdiener. Legt man keinen Einspruch ein, wird der Strafbefehl nach zwei Wochen unanfechtbar. Dann lässt sich die Höhe der Strafe kaum noch ändern. Daher ist es unerlässlich, diesen Einspruch schriftlich beim zuständigen Gericht einzureichen. Dabei fokussieren Sie sich explizit auf die Bewertung Ihres Einkommens. Das vermeidet, dass die gesamte Schuldfrage erneut verhandelt wird. Fügen Sie Ihrem Einspruch alle relevanten Belege bei. Ein aktueller Bürgergeldbescheid, Lohnabrechnungen oder detaillierte Kontoauszüge sind hier Gold wert, um Ihr geringes Einkommen zu belegen. Zeigen Sie auf, dass der ursprünglich angesetzte Tagessatz Ihr Existenzminimum pulverisieren würde und somit gegen anerkannte Rechtsprechung verstößt.
Denken Sie an die Situation, in der ein Gericht übersehen hat, dass Sie nicht allein von Ihrem Einkommen leben. Der Artikel beschreibt es treffend: Die 75-Prozent-Regel für den Regelbedarf stellt eine Art Schutzzaun dar. Dieser verhindert, dass die Strafe Sie unter das absolut Notwendige drückt, vergleichbar mit einem Mindestbetrag, der immer auf Ihrem Konto verbleiben muss.
Suchen Sie umgehend einen Fachanwalt für Strafrecht auf. Nehmen Sie den Strafbefehl und sämtliche Einkommensnachweise – ob Bürgergeldbescheid, Lohnabrechnungen oder Belege Ihrer Bedarfsgemeinschaft – mit zu diesem Termin. Ein Anwalt kann fristgerecht und fundiert Einspruch einlegen und die korrekte Berechnung des Tagessatzes erwirken. Dies sichert Ihre Rechte effektiv ab.
Darf mein Bürgergeld auch für andere Schulden gepfändet werden?
Bürgergeld ist grundsätzlich nicht pfändbar durch private Gläubiger, da es explizit zur Sicherung des Existenzminimums dient. Es gibt jedoch spezifische Ausnahmen, etwa bei Rückforderungen von Behörden oder Unterhaltspflichten. Für diese Fälle sind gesetzliche Freibeträge über ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) entscheidend, um den Schutz zu gewährleisten.
Juristen nennen das den Schutz des Existenzminimums. Bürgergeld ist als Sozialleistung gemäß § 54 SGB I und § 42 SGB II konzipiert, um Ihnen das Nötigste zum Leben zu sichern. Folglich ist es von der Pfändung durch private Gläubiger – wie beispielsweise Vermieter, Energieversorger oder Banken – grundsätzlich ausgeschlossen. Diese Regel soll verhindern, dass Sie durch Altschulden in eine noch tiefere Notlage geraten.
Allerdings gibt es Ausnahmen, wo auch das Bürgergeld betroffen sein kann. Dazu zählen bestimmte Rückforderungen der öffentlichen Hand, etwa wenn das Jobcenter selbst Überzahlungen oder Vorschüsse geltend macht. Auch bei Pfändungen wegen Unterhaltspflichten kann es zu Zugriffen kommen. Selbst in solchen Fällen greifen aber gesetzliche Pfändungsfreigrenzen und Freibeträge. Diese stellen sicher, dass Ihnen immer noch ein Minimum für den Lebensunterhalt verbleibt. Die im Artikel beschriebene 75-Prozent-Regel bezieht sich übrigens spezifisch auf strafrechtliche Geldstrafen und ist nicht direkt auf die allgemeine Pfändung von Bürgergeld übertragbar. Jedoch verbindet beide Fälle das übergeordnete Prinzip: Ihr Existenzminimum muss geschützt bleiben.
Ein passender Vergleich ist folgender: Ihr Bürgergeld fungiert wie ein existenzieller Rettungsring. Er soll Sie über Wasser halten. Für die meisten Alltagsschulden kann dieser Rettungsring nicht einfach weggenommen werden. Sein primärer Zweck ist der Schutz Ihres Überlebens.
Handeln Sie proaktiv: Eröffnen Sie umgehend ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) bei Ihrer Bank. Dieses Konto schützt Ihre gesetzlichen Freibeträge automatisch bis zu einer bestimmten Höhe. Bei Pfändungsandrohungen ist es entscheidend, sich nicht zu verstecken. Suchen Sie sofort eine Schuldnerberatung oder einen Fachanwalt für Sozialrecht auf. Diese Experten können Ihre individuelle Situation bewerten und Sie zielgerichtet unterstützen. So bewahren Sie sich bestmöglich vor finanziellen Engpässen.
Wie kann ich präventiv sicherstellen, dass mein Einkommen bei einer Geldstrafe korrekt berücksichtigt wird?
Um sicherzustellen, dass Ihr Einkommen bei einer Geldstrafe richtig berechnet wird, ist proaktives Handeln entscheidend. Reichen Sie schon im Ermittlungsverfahren detaillierte und aktuelle Einkommensnachweise, wie Ihren Bürgergeldbescheid oder Lohnabrechnungen, unaufgefordert bei Polizei oder Gericht ein. So vermeiden Sie Fehleinschätzungen und stellen sicher, dass das Gericht Ihr tatsächliches Existenzminimum von Anfang an schützt.
Gerichte sind bei der Berechnung des Tagessatzes verpflichtet, Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen, um eine unverhältnismäßige Belastung zu vermeiden. Oftmals kommt es jedoch zu Schätzungen, wenn keine präzisen Belege vorliegen – gerade bei komplexeren Einkommenssituationen wie dem Bezug von Bürgergeld oder bei Bedarfsgemeinschaften. Das kann, wie der Fall in Leipzig zeigte, zu deutlich überhöhten Tagessätzen führen, die Ihr Existenzminimum gefährden. Ihre aktive Mitwirkung ist hier der beste Schutz.
Die Entscheidung des Landgerichts Leipzig zeigt, dass die 75-Prozent-Regel ein anerkannter Maßstab ist, um den unantastbaren Anteil Ihres Einkommens zu bestimmen. Diese Regel besagt, dass Ihnen mindestens 75 Prozent des Regelbedarfs für Alleinstehende zur freien Verfügung bleiben müssen, bevor ein Tagessatz festgelegt wird. Sie schützt Sie davor, dass eine Strafe Ihre Lebensgrundlage zerstört.
Denken Sie an die Situation eines Bauingenieurs, der vor Baubeginn alle Statikberechnungen akribisch einreicht. Er wartet nicht, bis das Fundament schief ist. Genauso sollten Sie handeln: Stellen Sie sicher, dass die finanzielle „Statik“ Ihrer Tagessatzberechnung von Anfang an auf soliden, belegten Zahlen basiert.
Sammeln Sie daher schon heute alle relevanten Dokumente: aktuelle Bürgergeldbescheide, detaillierte Lohnabrechnungen oder andere Belege über Ihre Sozialleistungen. Zeigen Sie bei Bedarf auch die genaue Zusammensetzung Ihrer Bedarfsgemeinschaft auf. Legen Sie diese Unterlagen unaufgefordert und frühzeitig bei den ermittelnden Behörden oder dem Gericht vor. So gewährleisten Sie eine faire und rechtskonforme Berechnung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Bedarfsgemeinschaft
Eine Bedarfsgemeinschaft ist im Sozialrecht die Haushaltsgemeinschaft von Personen, die gemeinsam leben und deren Einkommen sowie Vermögen gegenseitig bei der Berechnung von Sozialleistungen wie dem Bürgergeld berücksichtigt werden. Das Gesetz stellt so sicher, dass die Unterstützung nicht nur für Einzelpersonen, sondern für den tatsächlichen Bedarf der gesamten im Haushalt lebenden Familie oder Partnerschaft bemessen wird.
Beispiel: Die erste Einschätzung des Amtsgerichts war fehlerhaft, weil es den Bürgergeldbetrag des Mannes nicht als Leistung für eine ganze Bedarfsgemeinschaft erkannte.
Einspruch
Als Einspruch bezeichnen Juristen das formale Rechtsmittel, mit dem man sich gegen einen Strafbefehl wehrt und ihn nicht rechtskräftig werden lässt. Durch dieses wichtige Instrument kann man Fehler in einem Strafbefehl korrigieren oder die gegen einen verhängte Strafe anfechten, ohne dass es sofort zu einer öffentlichen Hauptverhandlung kommt.
Beispiel: Der Verteidiger legte gegen den Strafbefehl Einspruch ein, um die Höhe des Tagessatzes seines Mandanten korrigieren zu lassen.
Ersatzfreiheitsstrafe
Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist die Haftstrafe, die droht, wenn eine verhängte Geldstrafe nicht bezahlt werden kann oder will. Das deutsche Strafrecht stellt damit sicher, dass selbst bei Zahlungsunfähigkeit die strafrechtliche Sanktion nicht ins Leere läuft, sondern für jeden nicht beglichenen Tagessatz ein Tag im Gefängnis verbüßt wird.
Beispiel: Hätte der Mann die angepasste Geldstrafe von 200 Euro nicht gezahlt, hätte ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe gedroht.
Existenzminimum
Das Existenzminimum ist der gesetzlich garantierte Betrag, der einem Menschen zum Leben absolut zusteht und nicht gepfändet oder durch Strafen unterschritten werden darf. Diese rechtliche Schutzschwelle soll verhindern, dass Bürger durch behördliche Maßnahmen in Armut und Obdachlosigkeit geraten und ihre Grundbedürfnisse nicht mehr decken können.
Beispiel: Das Landgericht Leipzig betonte, dass die 75-Prozent-Regel das Existenzminimum des Angeklagten wirksam schützt.
Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Ein Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto genannt, ist ein spezielles Girokonto, das automatisch einen gesetzlichen Freibetrag vor der Pfändung durch Gläubiger schützt. Es dient dazu, trotz Schulden einen Grundbetrag für den Lebensunterhalt zu sichern, sodass jeder Schuldner seine Miete, Nahrung und andere elementare Ausgaben bestreiten kann.
Beispiel: Selbst bei anderen Schulden schützt ein Pfändungsschutzkonto einen Teil des Bürgergeldes vor dem Zugriff privater Gläubiger.
Strafbefehl
Einen Strafbefehl versteht man als eine schriftliche gerichtliche Anordnung, die eine Strafe ohne vorherige Hauptverhandlung festsetzt, wenn die Schuld als geringfügig erachtet wird. Der Gesetzgeber ermöglicht damit eine schnelle und effiziente Ahndung kleinerer Delikte, um die Justiz zu entlasten und langwierige Prozesse zu vermeiden.
Beispiel: Das Amtsgericht Borna erließ einen Strafbefehl über 2.000 Euro, den der Angeklagte durch seinen Anwalt anfechten ließ.
Tagessätze
Als Tagessätze bezeichnen Juristen die Berechnungsgrundlage für Geldstrafen, bei der die Gesamtsumme aus einer bestimmten Anzahl von Tagessätzen und der individuellen Höhe jedes einzelnen Tagessatzes resultiert. Dieses System soll sicherstellen, dass die Höhe einer Geldstrafe nicht nur die Schwere der Tat, sondern auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Verurteilten berücksichtigt, sodass die Strafe für alle gleich empfindlich ist.
Beispiel: Die ursprüngliche Geldstrafe von 2.000 Euro basierte auf 40 Tagessätzen zu je 50 Euro, die das Gericht nachträglich anpassen musste.
Wichtige Rechtsgrundlagen
Geldstrafe nach Tagessätzen (§ 40 Strafgesetzbuch)
Eine Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt, wobei die Anzahl der Tagessätze die Schwere der Schuld und die Höhe eines Tagessatzes das Einkommen des Täters widerspiegelt.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die ursprüngliche Geldstrafe basierte auf einer fehlerhaften Schätzung der Höhe des Tagessatzes, da das Gericht das Einkommen des Angeklagten falsch eingeschätzt hatte.
Schutz des Existenzminimums (Verfassungsrechtlicher Grundsatz)
Jeder Mensch hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, das auch bei der Bemessung von Strafen nicht gefährdet werden darf.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Dieser Grundsatz war entscheidend dafür, dass die Geldstrafe angepasst wurde, denn die ursprüngliche Höhe hätte den Angeklagten unter sein Existenzminimum gedrückt.
Berechnung des Tagessatzes bei Bezug von Bürgergeld (Etablierte Rechtsprechung)
Bei Empfängern von Sozialleistungen wird der Tagessatz so berechnet, dass ein fester Prozentsatz des Regelbedarfs als unantastbares Existenzminimum verbleibt.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht folgte der Argumentation der Verteidigung und legte basierend auf der 75-Prozent-Regel für den Regelbedarf von Bürgergeld-Empfängern einen Tagessatz von 5 Euro fest.
Einspruch gegen den Strafbefehl (§ 410 Strafprozessordnung)
Eine Person, gegen die ein Strafbefehl erlassen wurde, kann innerhalb einer Frist Einspruch einlegen, um den Fall gerichtlich überprüfen zu lassen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Verteidiger legte gezielt Einspruch gegen die Höhe des Tagessatzes ein und ermöglichte so die Korrektur der fehlerhaften Berechnung durch das Amtsgericht.
Kostentragung bei Korrektur staatlicher Fehler (Allgemeiner Rechtsgedanke)
Wenn staatliche Organe einen eigenen Fehler im Interesse der Rechtsordnung korrigieren, trägt in der Regel die Staatskasse die Verfahrenskosten und die notwendigen Auslagen des Betroffenen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Obwohl die Staatsanwaltschaft eine Beschwerde eingereicht hatte, um einen formalen Fehler zu korrigieren, musste die Staatskasse die Kosten tragen, da sie im Interesse der Rechtsordnung gehandelt hatte.
Das vorliegende Urteil
LG Leipzig – Az: 5 Qs 29/25 – Beschluss vom 12.06.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.









