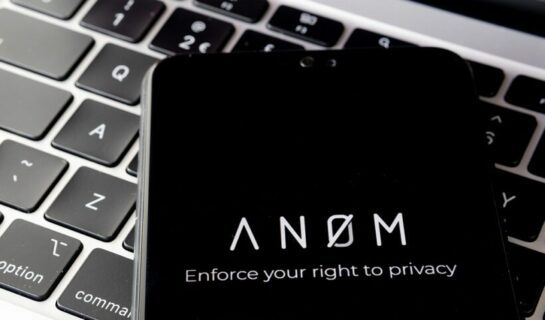E-Scooter-Trunkenheitsfahrt: Fahrverbot statt Fahrerlaubnisentzug
Das Gericht hat entschieden, dass bei einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter, bei der der Angeklagte eine Blutalkoholkonzentration von 1,42 ‰ aufwies, statt einer Fahrerlaubnisentziehung ein Fahrverbot von fünf Monaten verhängt wird. Die Entscheidung berücksichtigt das geständige Verhalten des Angeklagten, seine bisherige Unvorbelastetheit und die geringe Fahrtstrecke ohne konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Diese Maßnahme spiegelt eine Abwägung der Umstände und eine individuelle Betrachtung der Tat und des Täters wider, wobei ein Fahrverbot als ausreichend erachtet wurde, um den Rechtsverstoß zu sanktionieren.
Weiter zum vorliegenden Urteil Az.: 430 Ds 112 Js 16025/21 >>>
✔ Das Wichtigste in Kürze
Die zentralen Punkte aus dem Urteil:
- Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe und einem Fahrverbot von fünf Monaten, sieht aber von einer Fahrerlaubnisentziehung ab.
- Trotz einer Blutalkoholkonzentration von 1,42 ‰ wurde aufgrund der geringen Fahrtstrecke, dem geständigen Verhalten des Angeklagten und seiner Unvorbelastetheit ein Fahrverbot als angemessen erachtet.
- Das Gericht berücksichtigt, dass keine direkte Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vorlag und die Tatzeit (nachts) die Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung minimierte.
- Es wird hervorgehoben, dass der Angeklagte keine Vorstrafen hat und die im Fahreignungsregister verzeichneten Ordnungswidrigkeiten nicht mit Alkohol am Steuer in Verbindung stehen.
- Die Entscheidung unterstreicht die Notwendigkeit der Aufklärung über die rechtlichen Voraussetzungen und Promillegrenzen bei der Nutzung von E-Scootern.
- Der persönliche Eindruck des Gerichts vom Angeklagten führte zu der Überzeugung, dass der Zweck der Maßregel durch das Fahrverbot vollumfänglich erfüllt wird.
- Der Angeklagte zeigte sich einsichtig und hat seit dem Vorfall keine E-Scooter mehr genutzt, was seine positive Entwicklung unterstreicht.
- Die Kosten des Verfahrens und notwendige Auslagen werden vom Angeklagten getragen.
Übersicht
E-Scooter und Trunkenheitsfahrten: Fahrverbot statt Führerscheinentzug?
Im Zusammenhang mit Trunkenheitsfahrten mit Elektrokleinstfahrzeugen wie E-Scootern beschäftigt derzeit die Frage, ob anstelle einer Fahrerlaubnisentziehung ein Fahrverbot ausreichend ist. Zwar wird gemäß § 316 StGB bei Trunkenheitsfahrten grundsätzlich die Fahrerlaubnis entzogen, doch sehen neuere Gerichtsurteile in manchen Fällen auch die Möglichkeit eines Fahrverbots vor. Dieses Vorgehen wirft rechtliche Herausforderungen auf und regt zu einer differenzierten Betrachtung der Konsequenzen von Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern an. Um einen detaillierten Einblick in diese Thematik zu ermöglichen, wird nachfolgend ein konkretes Urteil näher beleuchtet.

Im Zentrum eines bemerkenswerten Falles am Amtsgericht Flensburg stand eine Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter, die zu einer rechtlichen Auseinandersetzung führte, welche das Spannungsfeld zwischen Fahrerlaubnisentziehung und Fahrverbot beleuchtete. Der Angeklagte, ein 1997 geborener Mann, der beruflich als Schweißaufsicht tätig ist und nach eigenen Angaben ein gutes Verhältnis zu seiner Familie pflegt, wurde wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt und erhielt zudem ein Fahrverbot von fünf Monaten.
Trunkenheitsfahrt auf dem E-Scooter führt vor Gericht
Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden, als der Angeklagte nach dem Konsum alkoholischer Getränke beschloss, mit einem E-Scooter zu fahren. Eine Blutprobe ergab eine Alkoholkonzentration von 1,42 ‰. Die Fahrt fand auf einem Geh- und Radweg statt und wurde begonnen, um in der Nähe seines zu Fuß gehenden Bruders zu bleiben. Dieser Umstand führte zu der rechtlichen Fragestellung, inwieweit die Fahruntüchtigkeit unter Alkoholeinfluss auf einem E-Scooter, einem Elektrokleinstfahrzeug, zu ahnden ist.
Rechtliche Einordnung und gerichtliche Entscheidungsfindung
Das Gericht griff bei seiner Entscheidung auf §§ 316 Abs. 1 und Abs. 2, 42, 44 StGB zurück und berücksichtigte dabei die spezifischen Umstände des Falles. Interessant ist die Feststellung, dass ein E-Scooter als Kraftfahrzeug im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 3 eKFV gilt, für welches ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,1‰ die Fahruntüchtigkeit unwiderleglich angenommen wird. Trotz der Schwere des Vergehens entschied das Gericht, von einer Fahrerlaubnisentziehung abzusehen und stattdessen ein Fahrverbot zu verhängen.
Gründe für die Entscheidung gegen die Fahrerlaubnisentziehung
Die Entscheidung des Gerichts basiert auf mehreren Faktoren: Der Angeklagte war bis zum Zeitpunkt des Vergehens strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Sein Geständnis, das reuige Verhalten während der Verhandlung und die Tatsache, dass die Fahrt eine vergleichsweise kurze Distanz umfasste, wurden strafmildernd berücksichtigt. Zudem fand die Fahrt zu einer Uhrzeit statt, zu der eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer als unwahrscheinlich angesehen wurde.
Persönliche Entwicklung und Einsicht des Angeklagten
Besondere Beachtung fand die persönliche Entwicklung und Einsicht des Angeklagten nach dem Vorfall. Er beteuerte, aus dem Vorfall gelernt zu haben und zeigte sich einsichtig. Seit dem Vorfall ist er nicht mehr mit einem E-Scooter gefahren und hat die entsprechende App von seinem Smartphone gelöscht. Diese Umstände, kombiniert mit dem positiven Eindruck, den der Angeklagte auf das Gericht machte, führten zu der Überzeugung, dass die Verhängung eines Fahrverbots als ausreichende Maßnahme angesehen werden kann, um den Angeklagten an seine Pflichten im Straßenverkehr zu erinnern.
Das Gericht kam zu dem Schluss, dass durch die Verhängung eines Fahrverbots und die Durchführung des Strafverfahrens der Zweck der Maßregel vollumfänglich erfüllt werden konnte, ohne die Fahrerlaubnis zu entziehen. Ein solcher Vorfall wird sich nach Überzeugung des Gerichts nicht wiederholen, und der Angeklagte wird seinen Pflichten im Straßenverkehr in Zukunft nachkommen.
Das Amtsgericht Flensburg setzte mit seinem Urteil ein klares Zeichen, dass bei Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern unter bestimmten Voraussetzungen von einer Fahrerlaubnisentziehung abgesehen und stattdessen ein Fahrverbot als adäquate Maßnahme erachtet werden kann.
✔ FAQ: Wichtige Fragen kurz erklärt
Was unterscheidet ein Fahrverbot von einer Fahrerlaubnisentziehung?
Zwischen einem Fahrverbot und der Entziehung der Fahrerlaubnis bestehen wesentliche Unterschiede, die sowohl die Dauer als auch die rechtlichen Folgen betreffen. Ein Fahrverbot ist eine temporäre Maßnahme, die in der Regel für einen Zeitraum von einem bis zu sechs Monaten verhängt wird. Während dieser Zeit ist es dem Betroffenen untersagt, Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr zu führen. Nach Ablauf des Fahrverbots erhält der Betroffene seinen Führerschein automatisch zurück und darf wieder fahren.
Im Gegensatz dazu führt die Entziehung der Fahrerlaubnis dazu, dass die Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen vollständig entzogen wird. Dies geschieht in der Regel bei schwerwiegenderen Verstößen. Nach einer Entziehung der Fahrerlaubnis muss der Betroffene, um wieder fahren zu dürfen, eine neue Fahrerlaubnis beantragen, was unter Umständen die Ablegung einer erneuten Prüfung oder die Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens (MPU) erfordern kann.
Ein weiterer Unterschied liegt in den Voraussetzungen für die jeweilige Maßnahme. Ein Fahrverbot wird häufig als Folge von Ordnungswidrigkeiten wie Geschwindigkeitsüberschreitungen oder dem Fahren unter Alkoholeinfluss verhängt. Die Entziehung der Fahrerlaubnis hingegen erfolgt meist bei schwerwiegenden Verstößen oder wenn aufgrund von Punkten im Fahreignungsregister (Flensburger Punktesystem) die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen grundsätzlich in Frage gestellt wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Fahrverbot eine zeitlich begrenzte Maßnahme darstellt, nach deren Ablauf der Betroffene seine Fahrerlaubnis automatisch zurückerhält. Die Entziehung der Fahrerlaubnis hingegen entzieht dem Betroffenen die Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen dauerhaft, bis eine neue Fahrerlaubnis beantragt und erteilt wird, was mit weiteren Prüfungen oder Auflagen verbunden sein kann.
Welche Rolle spielt die Blutalkoholkonzentration bei der Beurteilung der Fahruntüchtigkeit im Straßenverkehr?
## Blutalkoholkonzentration und Fahruntüchtigkeit
Die Blutalkoholkonzentration (BAK) spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Fahruntüchtigkeit im Straßenverkehr. Ab einem Wert von 0,3 Promille kann von einer „relativen Fahruntüchtigkeit“ ausgegangen werden, wenn zusätzlich Ausfallerscheinungen wie beispielsweise unsicheres Fahrverhalten vorliegen. Diese relative Fahruntüchtigkeit bedeutet, dass die Fahrtüchtigkeit des Fahrers in Verbindung mit weiteren Umständen, wie etwa einem Unfall, in Frage gestellt wird, auch wenn die BAK unter 1,1 Promille liegt.
Bei einer BAK von 1,1 Promille oder höher wird von einer „absoluten Fahruntüchtigkeit“ ausgegangen, unabhängig davon, ob Ausfallerscheinungen beobachtet wurden oder nicht. In diesem Fall ist es rechtlich unerheblich, ob der Fahrer noch in der Lage zu sein scheint, das Fahrzeug sicher zu führen. Die absolute Fahruntüchtigkeit führt in der Regel zu einer Straftat nach § 316 StGB und kann den Entzug der Fahrerlaubnis sowie weitere Sanktionen nach sich ziehen.
Für Fahranfänger und junge Fahrer bis zum 21. Lebensjahr gilt in Deutschland eine 0,0-Promillegrenze. Bei Verstößen drohen neben Bußgeldern auch Punkte im Fahreignungsregister und weitere Maßnahmen wie die Teilnahme an einem Aufbauseminar.
Die Feststellung der BAK erfolgt entweder durch eine Blutprobe oder, vorläufig, durch einen Atemalkoholtest. Bei Verdacht auf Alkoholeinfluss im strafbaren Bereich wird in der Regel eine Blutentnahme durch einen Arzt angeordnet.
Die BAK ist somit ein maßgeblicher Indikator für die Beurteilung der Fahrtauglichkeit und hat direkte Auswirkungen auf die rechtlichen Konsequenzen, die ein Fahrer bei Alkoholkonsum im Straßenverkehr zu erwarten hat.
Das vorliegende Urteil
AG Flensburg – Az.: 430 Ds 112 Js 16025/21 – Urteil vom 16.12.2021
1. Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 40,00 € Geldstrafe verurteilt.
2. Dem Angeklagten wird gestattet, Geldstrafe und Kosten in monatlichen Raten von 100,00 €, zahlbar bis spätestens zum 10. eines Monates, beginnend mit dem ersten auf die Rechtskraft des Urteils folgenden Monats, zu zahlen. Diese Vergünstigung entfällt, sobald eine Rate nicht rechtzeitig gezahlt wird.
3. Ferner wird gegen den Angeklagten ein Fahrverbot von 5 Monaten verhängt. Die Dauer der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis wird auf das Fahrverbot angerechnet.
4. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen.
Angewendete Vorschriften: §§ 316 Abs. 1 und Abs. 2, 42, 44 StGB
Gründe
I.
Der am 1997 geborene Angeklagte absolvierte nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Silberschmied. Anschließend arbeitete er für P.. Dort war er viel auf Montage und diesbezüglich auch auf seinen Führerschein angewiesen. Mittlerweile arbeitet er als Schweißaufsicht.
Das Verhältnis zu seiner Familie beschreibt er als gut.
Sein monatlicher Verdienst liegt bei 2.050,00 € netto.
Ausweislich des in der Hauptverhandlung verlesenen Bundeszentralregisterauszuges vom 02.12.2021 ist der Angeklagte strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten. Das Fahreignungsregister vom 15.12.2021 weist folgende Eintragungen auf: Am 27.04.2019 verhängte die Behörde ein Fahrverbot von einem Monat sowie eine Geldbuße von 160,00 € wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um 31 km/h. Am 16.12.2020 verhängte die Behörde eine Geldbuße in Höhe von 90,00 € wegen Missachtung des Rotlichtes der Lichtzeichenanlage.
II.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht mit einem nach der Lebenserfahrung ausreichenden Maß an Sicherheit, demgegenüber vernünftige und nicht bloß auf denktheoretische Möglichkeiten gegründete Zweifel nicht mehr aufkommen (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 61. Aufl., 2018, § 261 Rn. 2), fest:
Nachdem der Angeklagte Alkohol in einer solchen Menge zu sich genommen hatte, dass die ihm um 03.50 Uhr entnommene Blutprobe Alkohol in einer Konzentration von 1,42 ‰ enthielt, befuhr er gegen 03:35 Uhr mit dem E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen, mit einer Nennleistung von 350 Watt, nutzbar bis zu einem Gewicht des Fahrers von 100 kg, den Geh- und Radweg neben der Straße S.. Die Fahrt begann bei dem Parkhaus der H. und endete auf der Höhe der A.. Da der Angeklagte in der Nähe seines gehenden Bruders bleiben wollte, fuhr er jeweils ein Stück voraus und kehrte nach einer Wendung wieder zu dem Bruder zurück.
Der Angeklagte hätte bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt erkennen können, dass er infolge des Alkoholgenusses fahruntüchtig war.
III.
Die Überzeugung des Gerichts beruht auf dem glaubhaften Geständnis den Angeklagten, der Vernehmung des Zeugen T. sowie der in der Hauptverhandlung eingeführten Lichtbilder sowie Urkunden.
VI.
Demnach hat sich der Angeklagte einer fahrlässigen Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 Abs. 1 und Abs. 2 StGB schuldig gemacht.
Bei dem besagten E-Scooter mit einer Nennleistung von 350 Watt handelt es sich um ein Elektrokleinstfahrzeug im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 3 eKFV und damit um ein Kraftfahrzeug, für das bei einer BAK von 1,1‰ unwiderleglich die Fahruntüchtigkeit angenommen wird.
Zugunsten des Angeklagten ist auch nicht aufgrund seiner Einlassung, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass es sich bei einem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handele, von einem schuldausschließenden Verbotsirrtum gemäß § 17 S. 1 StGB ausgegangen werden. Von dem Nutzer eines Fahrzeuges, auch soweit es sich nicht um ein Motorrad oder ein Pkw handelt, kann insoweit abverlangt werden, dass er sich vor einer Nutzung über die rechtlichen Voraussetzungen der Führung informiert. Das Landgericht Flensburg weist zu Recht darauf hin, dass E-Scooter in den letzten Jahren eine ganz erhebliche Verbreitung im Straßenbild einer jeden größeren Stadt erfahren hätten, deren Nutzung nunmehr weit verbreitet wäre und der ADAC als auch andere Verbraucherportale sich dem Thema gewidmet hätten und Informationen online zu den rechtlichen Voraussetzungen der Nutzung, insbesondere Promillegrenzen, anböten (vgl. Beschluss des Landgerichts Flensburg vom 23.09.2021 – V Qs 21/21, zitiert nach juris, Rn. 16).
V.
Bei der Strafzumessung war vom Strafrahmen des § 316 Abs. 1 StGB, mithin von Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe auszugehen.
Dabei war innerhalb des vorbezeichneten Strafrahmens strafmildernd zu berücksichtigen, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist sowie dass er sich im Rahmen der Hauptverhandlung geständig eingelassen und reuig gezeigt hat. Das Gericht hat darüber hinaus zugunsten des Angeklagten gewürdigt, dass die reine Fahrtstrecke nur wenige 100 Meter betrug.
Des Weiteren ist zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen, dass aufgrund der Tatzeit um 03:35 Uhr eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch deutlich unwahrscheinlicher als zur Tageszeit gewesen ist. Dabei verkennt das Gericht nicht, dass eine konkrete Gefährdung nicht Tatbestandsvoraussetzung des § 316 StGB ist; gleichwohl ist die Art und Weise einer möglichen Gefährdung bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.
Bei Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden Umstände hält das Gericht eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen für tat- und schuldangemessen.
Ausgehend vom Nettoeinkommensprinzip war die Tagessatzhöhe auf 40,00 € festzusetzen. Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse war dem Angeklagten gemäß § 42 StGB eine monatliche Ratenzahlung in Höhe von 100,00 € zu bewilligen.
Von einer Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 StGB war abzusehen. Gemäß § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB ist der Täter einer Trunkenheitsfahrt im Verkehr in der Regel als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen. Eine solche Ungeeignetheit konnte nicht festgestellt werden.
Das Gericht verkennt hierbei nicht die Rechtsprechung des Landgerichts Flensburg, wonach im Falle der Trunkenheitsfahrt mittels eines E-Scooters im Regelfall die Voraussetzungen für die Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegen (vgl. Beschluss des Landgerichts Flensburg vom 23.09.2021 – V Qs 21/21, zitiert nach juris). Ein solcher Regelfall war nach Durchführung der Beweisaufnahme jedoch nicht mehr anzunehmen.
Entgegen der Regelvermutung kann von der Entziehung der Fahrerlaubnis nur dann abgesehen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die den seiner allgemeinen Natur nach schweren und gefährlichen Verstoß in einem anderen Licht erscheinen lassen als den Regelfall oder die nach der Tat die Eignung günstig beeinflusst haben (v. Heintschel/Huber, in: Münchener Kommentar zum StGB, 4. Aufl. 2020, § 69, Rn. 75).
Das Gericht hat im Rahmen dessen stets zu prüfen, ob der Zweck der Maßregel bereits durch vorläufige Maßnahmen wie die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis erreicht ist (vgl. Heuchemer, in: BeckOK StGB, 51. Edition, Stand: 01.11.2021, § 69 Rn. 46). Des Weiteren kann die Regelvermutung widerlegt werden, wenn die Gesamtwürdigung ergibt, dass mit einer Wiederholung nicht zu rechnen ist (v. Heintschel-Heinegg/Huber, aaO, Rn. 77).
Beide diese Voraussetzungen liegen vor. Aufgrund des persönlichen Eindrucks des Gerichts vom Angeklagten ist das Gericht überzeugt, dass mit der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis und der Durchführung des Strafverfahrens der Zweck der Maßregel – unter Erteilung eines Fahrverbots gemäß § 44 StGB – vollumfänglich erfüllt werden konnte. Ein derartiger Vorfall wird sich nicht wiederholen und der Angeklagte wird künftig seinen Pflichten im Straßenverkehr nachkommen.
In der Hauptverhandlung zeigte sich der Angeklagte in einer Art und Weise einsichtig, die über die übliche Reue hinausging. Er versicherte glaubhaft, sich immer regelkonform verhalten zu wollen und dass er selber erschreckt gewesen sei, als ihm sein Vergehen bewusst wurde. Seit dem Vorfall ist der Angeklagte nicht mehr mit einem E-Scooter gefahren und hat darüber hinaus die E-Scooter-App von seinem Smartphone gelöscht. Auch hat sich der Angeklagte bei der polizeilichen Kontrolle derart überdurchschnittlich höflich und zuvorkommend verhalten, dass der Polizeibeamte T. dies ausdrücklich hervorhob.
Ferner war der Angeklagte bereit, sein Trinkverhalten kritisch zu würdigen. Dass er trotz eines BAK-Wertes von 1,42‰ noch derart klar auftreten konnte, kann seinen Grund darin finden, dass der Angeklagte durch die Polizeikontrolle geschockt und um das Äußerste bemüht war, bei den Polizeibeamten einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Der Angeklagte ist strafrechtlich zudem in keiner Weise vorbelastet. Zwar weist das Fahreignungsregister zwei Ordnungswidrigkeiten auf; diese stehen jedoch in keinem Zusammenhang mit Fahrten unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln.
Abschließend war daher – lediglich – auf ein Fahrverbot von 5 Monaten gemäß § 44 Abs. 1 S. 1 StGB zu erkennen, wobei eine Anrechnung gemäß § 51 Abs. 5 StGB stattzufinden hatte.
VI.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 464, 465 Abs. 1 StPO.