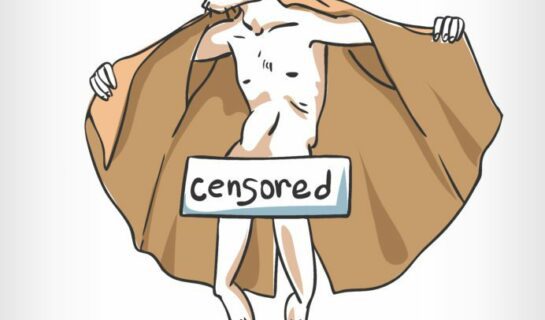Übersicht
- Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Kreditgeschäft ohne Lizenz: Warum der Staat nicht immer das ganze Geld einkassieren darf
- Die Krux mit dem Geld: Gewinn oder Werkzeug?
- Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Klarheit für die Praxis
- Das Ergebnis für Herrn K.: deutlich weniger Geld weg
- Warum dieses Urteil so wichtig ist: Folgen für die Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was genau ist ein unerlaubtes Bankgeschäft?
- Ist nach diesem Urteil jedes illegale Verleihen von Geld weniger riskant geworden?
- Was ist der Unterschied zwischen der Einziehung von Taterträgen (§ 73 StGB) und Tatobjekten (§ 74 StGB)?
- Bedeutet das Urteil, dass illegal erwirtschaftetes Kapital immer sicher ist, wenn es zurückfließt?
- Was sollte ich tun, wenn mir unerlaubtes Betreiben von Bankgeschäften vorgeworfen wird?
- Gilt diese Rechtsprechung auch für Zinsen, die ich aus einem Privatdarlehen erhalte?
- Hat die Reform der Vermögensabschöpfung 2017 ihr Ziel verfehlt?
- Fazit: Ein Balanceakt zwischen Strafverfolgung und Rechtsstaatlichkeit

Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Das wichtigste Ergebnis: Geld, das jemand bei einem unerlaubten Kreditgeschäft nur zurückbekommt (also das ursprünglich verliehene Kapital), darf der Staat nicht einfach als Gewinn einziehen. Nur die echten Profite, wie z. B. die Zinsen, können abgeschöpft werden.
- Wer ist betroffen? Personen, die ohne Erlaubnis Kredite verleihen oder andere unerlaubte Finanzgeschäfte betreiben, sowie Behörden, die diese Fälle verfolgen.
- Praktische Folgen: Wer illegal Geld verleiht, muss mit Strafe und Einziehung der Gewinne (Zinsen) rechnen – das eingesetzte Kapital bleibt aber meist geschützt. Behörden müssen klar unterscheiden, was Gewinn ist und was bloß verliehenes Geld.
- Wichtig zu wissen: Das Gesetz trennt genau zwischen „Gewinnen“ aus Straftaten und den Gegenständen, mit denen die Straftat begangen wird. Das Urteil klärt, dass das verliehene Geld zum Tatgegenstand gehört und nicht automatisch als Gewinn zählt.
- Zeitliche Gültigkeit: Diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 20. Juli 2022 gilt aktuell und beeinflusst laufende und künftige Verfahren rund um illegale Finanzgeschäfte.
Quelle: Bundesgerichtshof (BGH), Beschluss 3 StR 390/21 vom 20. Juli 2022
Kreditgeschäft ohne Lizenz: Warum der Staat nicht immer das ganze Geld einkassieren darf
Ein wegweisendes Urteil des Bundesgerichtshofs erschüttert die Praxis der Vermögensabschöpfung bei illegalen Finanzgeschäften. Es zeigt: Nicht jeder Euro, der im Rahmen einer Straftat fließt, ist automatisch „Gewinn“, den der Staat einziehen kann. Besonders brisant wird es, wenn es um das Herzstück des Geschäfts geht – das eingesetzte Kapital.
Stellen Sie sich Herrn K. vor. Ein Mann, der nebenbei ein einträgliches, aber illegales Geschäft betrieb. Er verlieh Geld an Bekannte und verlangte dafür horrende Zinsen – 10 Prozent pro Monat. Eine Banklizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für solche Kreditgeschäfte zwingend erforderlich ist, besaß er nicht. Über mehrere Jahre hinweg verlieh Herr K. so insgesamt 55.000 Euro. Seine Kunden zahlten ihm über die Zeit rund 59.000 Euro zurück, zusätzlich wurden in einem Fall noch 2.500 Euro Zinsen durch Arbeitsleistungen beglichen. Neben diesen illegalen Bankgeschäften war Herr K. auch im Drogenhandel aktiv.
Als seine Geschäfte aufflogen, landete der Fall vor dem Landgericht Duisburg. Die Richter verurteilten Herrn K. nicht nur zu einer Freiheitsstrafe von über drei Jahren, sondern ordneten auch die sogenannte Einziehung von Wertersatz an. Das bedeutet, der Staat wollte das Geld kassieren, das Herr K. durch seine Straftaten erlangt hatte. Die Summe war beachtlich: Rund 135.000 Euro sollte Herr K. an die Staatskasse zahlen. Dieser Betrag setzte sich zusammen aus den geschätzten Gewinnen aus dem Drogenhandel und – das ist der entscheidende Punkt – den vollständigen zurückgezahlten Darlehensbeträgen von 59.000 Euro. Das Landgericht sah also nicht nur die Zinsen, sondern auch das ursprünglich verliehene und zurückgeflossene Geld als strafbaren Ertrag an.
Herr K. akzeptierte die Verurteilung wegen der Drogendelikte und der unerlaubten Bankgeschäfte, doch gegen die Höhe der Einziehung legte er Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Seine zentrale Frage: Ist es rechtens, dass ihm auch das Geld weggenommen wird, das er ursprünglich selbst eingesetzt und lediglich zurückerhalten hat? Am 20. Juli 2022 fällte der 3. Strafsenat des BGH unter dem Aktenzeichen 3 StR 390/21 eine Entscheidung, die weit über den Fall von Herrn K. hinaus Bedeutung erlangt hat.
Die Krux mit dem Geld: Gewinn oder Werkzeug?
Im Kern ging es um eine juristisch feine, aber praktisch enorm wichtige Unterscheidung, die das Strafgesetzbuch (StGB) bei der Einziehung von Vermögenswerten trifft: die Abgrenzung zwischen Taterträgen (§ 73 StGB) und Tatobjekten (§ 74 StGB).
Taterträge sind, vereinfacht gesagt, der Gewinn oder Vorteil, den ein Täter durch seine Straftat erlangt. Das klassische Beispiel ist die Beute aus einem Diebstahl oder der Verkaufserlös aus Drogengeschäften. Der Staat will verhindern, dass sich Verbrechen lohnt, und schöpft deshalb diese Erträge ab. Seit einer Reform des Einziehungsrechts im Jahr 2017 ist der Begriff des Tatertrags sehr weit gefasst, um möglichst umfassend kriminell erwirtschaftete Vermögen einzuziehen.
Tatobjekte hingegen sind Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht. Das können die Drogen sein, mit denen gehandelt wird, die Tatwaffe bei einem Überfall oder eben auch – so argumentierte die Verteidigung von Herrn K. – das Geld, das bei einem illegalen Kreditgeschäft verliehen und zurückgezahlt wird.
Tatobjekte können unter bestimmten, engeren Voraussetzungen ebenfalls eingezogen werden, etwa wenn sie gefährlich sind (wie Waffen oder Drogen) oder wenn eine spezielle gesetzliche Regelung dies vorsieht. Es geht hier aber nicht primär darum, einen Gewinn abzuschöpfen, sondern eher darum, das „Werkzeug“ oder den „Gegenstand“ der Tat dem Täter zu entziehen.
Die Frage für den BGH lautete also: Sind die 55.000 Euro, die Herr K. verliehen hatte und die er von seinen Schuldnern (zuzüglich Zinsen) zurückbekam, als „durch die Tat erlangter“ Tatertrag anzusehen, wie das Landgericht meinte? Oder handelt es sich bei diesem Kapital um das Tatobjekt, den eigentlichen Gegenstand des verbotenen Bankgeschäfts?
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Klarheit für die Praxis
Der BGH gab der Revision von Herrn K. in diesem Punkt statt und korrigierte die Entscheidung des Landgerichts erheblich. Die Richter in Karlsruhe stellten klar: Zurückgezahlte Darlehensbeträge aus unerlaubt betriebenen Bankgeschäften sind Tatobjekte, keine Taterträge.
Die Argumente der Richter im Detail
Die Begründung des BGH ist aufschlussreich und zieht klare Linien für die Zukunft:
1. Das Geld als Kern der Straftat (Tatobjekt)
Der BGH betonte, dass die Straftat des Herrn K. gerade darin bestand, Gelddarlehen zu gewähren, ohne die erforderliche Erlaubnis zu besitzen (§ 54 KWG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG). Das Auszahlen und das (beabsichtigte) Zurückerhalten des Geldes waren die strafbare Handlung, nicht nur deren Ergebnis.
Das Darlehenskapital, die sogenannte Darlehensvaluta, ist somit der notwendige Gegenstand, auf den sich die Straftat des unerlaubten Bankgeschäfts bezieht. Ohne dieses Geld gäbe es kein Kreditgeschäft. Daher ist die Valuta – sowohl bei der Auszahlung als auch bei der Rückzahlung – als Tatobjekt im Sinne des § 74 Abs. 2 StGB einzuordnen.
2. Geld ist Geld (Fungibilität)
Das Argument, dass Herr K. ja nicht exakt dieselben Geldscheine zurückbekommen habe, die er verliehen hatte, ließ der BGH nicht gelten. Die Richter wiesen darauf hin, dass es bei einem Gelddarlehen um die Rückzahlung einer bestimmten Geldsumme geht (§ 488 Abs. 1 Satz 1 BGB), nicht um die Rückgabe identischer Scheine oder Münzen. Geld ist ein sogenanntes fungibles Gut, es ist austauschbar. Wirtschaftlich gesehen erhält der Darlehensgeber denselben Wert zurück, den er eingesetzt hat. Es wäre unsachgemäß, die rechtliche Bewertung davon abhängig zu machen, ob zufällig dieselben oder andere Banknoten zurückfließen. Die wirtschaftliche Identität des Betrages ist entscheidend.
3. Tatobjekt schließt Tatertrag aus (Vorrangprinzip)
Der BGH bekräftigte einen fundamentalen Grundsatz des Einziehungsrechts: Ein Gegenstand kann nicht gleichzeitig Tatobjekt und Tatertrag sein. Die Einordnung als Tatobjekt (oder Tatmittel) hat Vorrang. Wenn sich die Straftat unmittelbar auf einen Gegenstand bezieht, wie hier das Darlehenskapital auf das unerlaubte Kreditgeschäft, dann ist dieser Gegenstand eben nicht zusätzlich „durch die Tat erlangt“ im Sinne des § 73 StGB.
Zur Verdeutlichung zog der BGH eine Parallele zum Betäubungsmittelrecht: Drogen, die ein Dealer verkauft, sind eindeutig Tatobjekte. Auch wenn der Dealer sie zuvor vielleicht selbst illegal erworben und damit begrifflich „erlangt“ hat, werden sie nach einer speziellen Vorschrift (§ 33 BtMG) als Tatobjekte eingezogen – und eben nicht als Tatertrag. Genauso verhält es sich mit der Darlehensvaluta: Sie ist der Kern des verbotenen Geschäfts und damit Tatobjekt.
4. Kein Gewinn durch Kapitalrückfluss (Wirtschaftliche Betrachtung)
Auch wenn man theoretisch erwägen würde, die zurückgezahlte Valuta als „erlangt“ anzusehen, würde eine Einziehung nach § 73 StGB scheitern, so der BGH. Denn die Einziehung von Taterträgen setzt voraus, dass beim Täter ein messbarer wirtschaftlicher Vorteil, eine Vermögensmehrung eingetreten ist. Herr K. hat durch die Rückzahlung der 55.000 Euro aber keinen Gewinn gemacht. Er hat lediglich sein eigenes, zuvor eingesetztes Kapital zurückerhalten. Ökonomisch betrachtet liegt hier keine Bereicherung vor, sondern nur eine Rückführung. Die Einziehung nach § 73 StGB zielt aber auf den Netto-Vorteil, den Profit aus der Tat. Dieser Gedanke, oft als „Netto-Prinzip“ bezeichnet, wurde durch die Reform 2017 sogar eher gestärkt. Der Gesetzgeber wollte Kriminalität unrentabel machen, indem er den Gewinn abschöpft, nicht notwendigerweise jeden Umsatz oder jedes eingesetzte Kapital.
5. Keine spezielle Einziehungsregel im Kreditwesengesetz
Tatobjekte können zwar grundsätzlich eingezogen werden, aber § 74 StGB stellt dafür bestimmte Anforderungen. Oft gibt es in Spezialgesetzen (wie dem Betäubungsmittelgesetz oder dem Waffengesetz) klare Regeln, die die Einziehung bestimmter Tatobjekte anordnen, um sie dem Verkehr zu entziehen. Im Kreditwesengesetz (KWG) fehlt jedoch eine solche spezielle Vorschrift, die die Einziehung von Geldbeträgen anordnet, die Gegenstand eines unerlaubten Bankgeschäfts waren. Da keine gesetzliche Grundlage existiert, um Herrn K. das zurückgezahlte Darlehenskapital als Tatobjekt wegzunehmen, durfte es nicht eingezogen werden.
Expertenwissen: Tatertrag vs. Tatobjekt – Der feine Unterschied
- Tatertrag (§ 73 StGB): Der Gewinn, der durch die Straftat erzielt wird (z. B. Verkaufserlös, Zinsen, Bestechungsgeld). Ziel der Einziehung ist die Abschöpfung des unrechtmäßigen Profits. „Crime doesn’t pay!“
- Tatobjekt (§ 74 StGB): Der Gegenstand, auf den sich die Straftat bezieht (z. B. Diebesgut, Drogen, Falschgeld, Tatwaffe – oder eben das verliehene Geld beim illegalen Kreditgeschäft). Ziel der Einziehung ist oft die Sicherung oder die Beseitigung des gefährlichen Gegenstands.
- Wichtig: Ein Gegenstand ist entweder das eine oder das andere. Die Einordnung als Tatobjekt hat Vorrang. Ist etwas Tatobjekt, kann es nicht gleichzeitig Tatertrag sein.
Das Ergebnis für Herrn K.: deutlich weniger Geld weg
Die Entscheidung des BGH hatte für Herrn K. direkte finanzielle Folgen. Von den ursprünglich vom Landgericht angeordneten rund 135.000 Euro Einziehungssumme blieben nach dem Urteil aus Karlsruhe nur noch 80.003,92 Euro übrig. Dieser Betrag setzte sich nun korrekt zusammen aus:
- Den Zinsen aus den illegalen Darlehen: Diese stellten den tatsächlichen Gewinn, den Profit aus dem unerlaubten Bankgeschäft dar und waren somit als Tatertrag (§ 73 StGB) einzuziehen. Das Landgericht hatte hier 6.500 Euro festgestellt (59.000 € Rückzahlung – 55.000 € ursprüngliches Kapital + 2.500 € verrechnete Zinsen durch Arbeitsleistungen).
- Den geschätzten Erlösen aus dem ebenfalls abgeurteilten Drogenhandel: Diese waren unstreitig Tatertrag und wurden vom BGH mit 73.503,92 Euro bestätigt.
Die zurückgezahlte Darlehensvaluta von 55.000 Euro durfte hingegen nicht eingezogen werden, da sie als Tatobjekt qualifiziert wurde und eine spezielle gesetzliche Grundlage für ihre Einziehung fehlte. Die Revision des Herrn K. hatte also in Bezug auf die Höhe der Einziehung vollen Erfolg.
Warum dieses Urteil so wichtig ist: Folgen für die Praxis
Die Entscheidung des BGH (3 StR 390/21) ist weit mehr als nur eine Korrektur im Einzelfall. Sie hat grundlegende Bedeutung für die Strafverfolgung und die Vermögensabschöpfung in Deutschland, insbesondere im Bereich der Finanz- und Wirtschaftskriminalität.
Mehr Klarheit bei Finanzdelikten
Das Urteil schafft dringend benötigte Klarheit bei der Abgrenzung von Taterträgen und Tatobjekten im Kontext von Finanzdienstleistungen, die ohne Erlaubnis erbracht werden. Es korrigiert eine Tendenz mancher Gerichte und Staatsanwaltschaften, nach der Reform von 2017 möglichst alles Geld, das im Zusammenhang mit einer Straftat fließt, pauschal als Tatertrag zu behandeln. Der BGH stellt klar: Die dogmatischen Kategorien des § 73 und § 74 StGB sind weiterhin strikt zu trennen, und die funktionale Rolle des Geldes im konkreten Delikt ist entscheidend.
Konsequenzen für Verfahren nach KWG und ZAG
Für Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Betreibens von Bankgeschäften (§ 54 KWG) oder unerlaubten Erbringens von Zahlungsdiensten (§ 63 ZAG) bedeutet das Urteil: Das bloße Transferieren oder Verleihen von Geldern (Kundengelder, Darlehenskapital) führt nicht automatisch dazu, dass diese Beträge als Tatertrag eingezogen werden können. Die Staatsanwaltschaften müssen sich bei der Einziehung nach § 73 StGB auf die tatsächlich erzielten Gewinne konzentrieren – also Zinsen, Gebühren, Provisionen. Will der Staat auch das eingesetzte Kapital einziehen, muss er die (oftmals schwierigeren) Voraussetzungen des § 74 StGB für die Einziehung von Tatobjekten darlegen und beweisen, oder es muss eine spezielle gesetzliche Ermächtigung dafür geben.
Bestätigung des Netto-Prinzips
Das Urteil unterstreicht das Netto-Prinzip bei der Abschöpfung: Der Staat soll dem Täter den unrechtmäßigen Gewinn entziehen, ihn aber nicht zwingend um das eingesetzte Kapital bringen, wenn dieses lediglich zurückfließt. Es geht darum, zu verhindern, dass sich Kriminalität lohnt, nicht darum, den Täter über den Entzug des Profits hinaus zu bestrafen oder ihm sein ursprünglich legales Vermögen (das er als Kapital einsetzte) wegzunehmen, nur weil es Teil einer illegalen Transaktion war.
Signalwirkung für andere Deliktsbereiche
Der vom BGH formulierte Grundsatz – Tatobjekt/Tatmittel hat Vorrang vor Tatertrag – wurde seitdem in weiteren Entscheidungen bestätigt und auf andere Bereiche angewendet:
- Hawala-Banking: Gelder, die über illegale Finanztransfer-Systeme verschoben werden, gelten in Bezug auf das Betreiben des Systems (§ 63 ZAG) oder die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB) als Tatmittel oder Tatobjekte (§ 74 StGB), nicht als Tatertrag der Betreiber (vgl. BGH, Beschl. v. 28.06.2022 – 3 StR 403/20).
- Illegale Einfuhren: Rechtswidrig eingeführte Waren (z. B. Holz ohne Genehmigung) wurden unter Berufung auf die Logik aus 3 StR 390/21 als Tatobjekte (§ 74 Abs. 2 StGB) klassifiziert (vgl. BGH, Beschl. v. 21.02.2023 – 3 StR 278/22).
- Steuerhehlerei: Auch hier wird zur dogmatischen Abgrenzung auf die Grundsätze verwiesen, auch wenn z.B. unversteuerte Zigaretten beim Hehler, der sie zum Weiterverkauf erwirbt, anders als beim ursprünglichen Schmuggler, als Tatertrag gelten können (vgl. BGH, Urt. v. 14.12.2022 – 3 StR 111/22).
Diese konsistente Anwendung zeigt, dass der BGH eine übergreifende Leitlinie für das reformierte Einziehungsrecht etabliert hat, die auf einer funktionalen Analyse der Rolle von Vermögenswerten im jeweiligen Delikt basiert.
Herausforderung für den Gesetzgeber?
Das Urteil macht auch deutlich: Wenn der Gesetzgeber will, dass in bestimmten Bereichen – wie dem unerlaubten Bankgeschäft – auch das eingesetzte Kapital (als Tatobjekt) regelmäßig eingezogen werden kann, muss er dafür eine spezifische gesetzliche Grundlage schaffen, ähnlich wie im Betäubungsmittel- oder Waffenrecht. Solange eine solche Norm fehlt, sind die Gerichte an die allgemeine Unterscheidung zwischen Tatertrag und Tatobjekt gebunden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Das Urteil wirft bei Betroffenen und Interessierten oft Fragen auf. Hier einige Antworten auf die häufigsten:
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was genau ist ein unerlaubtes Bankgeschäft?
Ist nach diesem Urteil jedes illegale Verleihen von Geld weniger riskant geworden?
Was ist der Unterschied zwischen der Einziehung von Taterträgen (§ 73 StGB) und Tatobjekten (§ 74 StGB)?
Bedeutet das Urteil, dass illegal erwirtschaftetes Kapital immer sicher ist, wenn es zurückfließt?
Was sollte ich tun, wenn mir unerlaubtes Betreiben von Bankgeschäften vorgeworfen wird?
Gilt diese Rechtsprechung auch für Zinsen, die ich aus einem Privatdarlehen erhalte?
Hat die Reform der Vermögensabschöpfung 2017 ihr Ziel verfehlt?
Fazit: Ein Balanceakt zwischen Strafverfolgung und Rechtsstaatlichkeit
Das BGH-Urteil 3 StR 390/21 ist ein wichtiger Meilenstein in der Auslegung des modernen Einziehungsrechts. Es zieht eine klare Grenze: Das eingesetzte Kapital bei einem unerlaubten Kreditgeschäft ist kein automatisch abschöpfbarer „Gewinn“, sondern der Gegenstand der Tat selbst. Nur der tatsächliche Profit, wie etwa die Zinsen, unterliegt als Tatertrag der Einziehung nach § 73 StGB, sofern keine spezielle gesetzliche Regelung die Einziehung des Kapitals als Tatobjekt erlaubt.
Die Entscheidung stärkt die Rechtssicherheit für Betroffene und gibt der Praxis eine klare Leitlinie an die Hand. Sie betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung und einer sauberen juristischen Begründung, bevor der Staat Vermögenswerte einzieht. Gleichzeitig bleibt das unerlaubte Betreiben von Bankgeschäften eine ernstzunehmende Straftat mit empfindlichen Konsequenzen. Das Urteil ist somit ein Beispiel dafür, wie Gerichte das staatliche Interesse an effektiver Kriminalitätsbekämpfung gegen die Notwendigkeit abwägen, rechtsstaatliche Prinzipien und die Dogmatik des Strafrechts zu wahren. Für jeden, der im Finanzbereich tätig ist oder Kredite vergibt, unterstreicht es die immense Bedeutung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben – und die Notwendigkeit kompetenter Rechtsberatung im Konfliktfall.