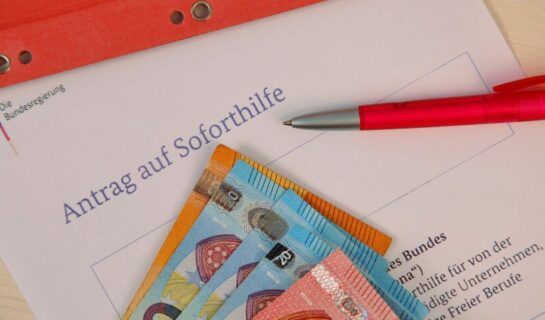Ein Therapeut wurde wegen sexuellen Übergriffs durch eine Patientin zweifach verurteilt, doch die Beweiswürdigung im Strafverfahren barg unerwartete Fehler. Dieses vermeintlich klare ‚Aussage gegen Aussage‚-Urteil musste daraufhin von höchster Instanz völlig neu geprüft werden.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Experten Kommentar
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Welche Beweismittel stärken meine Position bei ‚Aussage gegen Aussage‘?
- Wie schütze ich meine Rechte, wenn ich einer falschen Anschuldigung gegenüberstehe?
- Was tun bei einer lückenhaften Beweiswürdigung in meinem Urteil?
- Kann ein Trauma die Glaubwürdigkeit meiner Aussage beeinflussen?
- Wie sichere ich frühzeitig Beweise für meine Version der Ereignisse?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil 203 StRR 332/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Bayerisches Oberstes Landesgericht
- Datum: 18.08.2025
- Aktenzeichen: 203 StRR 332/25
- Verfahren: Strafrevision
- Rechtsbereiche: Strafrecht, Strafprozessrecht
- Das Problem: Ein Physiotherapeut wurde wegen sexuellen Missbrauchs und sexueller Nötigung verurteilt. Er fand die Beweiswürdigung des Landgerichts unzureichend.
- Die Rechtsfrage: War die Beweiswürdigung des Landgerichts ausreichend, um den Angeklagten zu verurteilen?
- Die Antwort: Nein, das Gericht hob das Urteil auf. Die Beweiswürdigung des Landgerichts war lückenhaft und fehlerhaft.
- Die Bedeutung: Das Gericht hat nicht über Schuld oder Unschuld entschieden. Der Fall wird neu verhandelt, da die ursprüngliche Beweisprüfung nicht korrekt war.
Der Fall vor Gericht
Woran kann ein Urteil scheitern, das bereits zweimal bestätigt wurde?
Die Geschichte schien abgeschlossen. Eine Patientin beschuldigt ihren Therapeuten eines sexuellen Übergriffs in der Praxis. Gerichte hören Zeugen, wägen ab und befinden den Mann für schuldig – erst das Amtsgericht, dann das Landgericht.

Doch die Verteidigung gibt nicht auf und zieht vor das Bayerische Oberste Landesgericht. Dort schauen die Richter nicht mehr auf die Gesichter der Zeugen, sondern nur noch auf das geschriebene Wort des letzten Urteils. Und in diesem Text finden sie etwas, das schlimmer ist als ein Widerspruch: Sie finden Leere. Die entscheidenden Fragen wurden nie gestellt.
Warum ist ein „Aussage gegen Aussage“-Fall so heikel für Richter?
Ein Strafprozess lebt von Beweisen. Gibt es keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, keine unbeteiligten Augenzeugen, wird die Lage kompliziert. Steht am Ende nur die Anschuldigung des Opfers gegen das Leugnen des Angeklagten, stehen die Richter vor ihrer schwierigsten Aufgabe. Das Gesetz verlangt für eine Verurteilung eine Überzeugung, die jeden vernünftigen Zweifel ausschließt. Ein bloßes Bauchgefühl – „Ich glaube dem Opfer mehr“ – genügt nicht.
Die Rechtsprechung hat für solche Konstellationen deshalb strenge Regeln entwickelt. Ein Gericht muss die Aussage des Belastungszeugen regelrecht sezieren. Es muss die Entstehungsgeschichte der Aussage beleuchten: Wann und wem wurde die Geschichte zuerst erzählt? Es muss die Aussage selbst auf innere Stimmigkeit, auf Details und auf Konstanz prüfen: Verändert sich die Erzählung über die Zeit? Gibt es Widersprüche? Und es muss alle Umstände, die für oder gegen den Angeklagten sprechen, in eine lückenlose Gesamtwürdigung einbeziehen. Jedes Argument muss auf den Tisch. Jede Ungereimtheit muss aufgeklärt oder plausibel erklärt werden. Ein Urteil darf keine logischen Löcher haben. Genau hier lag der Denkfehler des Landgerichts.
Welche konkreten Fehler pulverisierten die Urteilsbegründung?
Das Bayerische Oberste Landesgericht las das Urteil des Landgerichts nicht als Anklageschrift, sondern als Rechenschaftsbericht. Und dieser Bericht war unvollständig. Die Richter fanden gleich mehrere Stellen, an denen die Vorinstanz ihre Arbeit nicht sauber dokumentiert oder schlichtweg nicht gemacht hatte.
Ein zentraler Punkt war die fehlende Konstanzprüfung. Die Patientin hatte ihre Geschichte mehrfach erzählt – bei der Polizei, vor dem ersten Gericht, in der Berufung. Das Landgericht hätte die verschiedenen Versionen nebeneinanderlegen müssen. Gab es Abweichungen? Wurden Details später hinzugefügt oder weggelassen? Solche Vergleiche sind entscheidend, um die Zuverlässigkeit einer Erinnerung zu bewerten. Das Urteil schwieg dazu. Es erwähnte nicht einmal den Inhalt der früheren Aussagen. Ein schwerer Mangel.
Zudem hatte die Frau direkt nach dem Vorfall Gedächtnisprotokolle angefertigt und mit ihrem Ehemann gesprochen. Diese ersten Schilderungen sind oft die authentischsten. Doch auch diese Beweismittel tauchten in der Urteilsbegründung nicht auf. Das Gericht hatte sie offenbar ignoriert, anstatt sie als Puzzleteile für das Gesamtbild zu nutzen.
Den größten argumentativen Sprengstoff enthielt jedoch ein Telefonat. Die Patientin rief den Therapeuten an, während eine Freundin zuhörte. Der Therapeut soll dabei sinngemäß gesagt haben, ihm sei „ein Fehler passiert“ und es tue ihm leid. Das Landgericht wertete dies als verkapptes Geständnis eines sexuellen Fehlverhaltens. Das Obergericht sah das anders. Die Formulierungen waren viel zu vage. „Ein Fehler“ kann alles Mögliche bedeuten – eine ungeschickte Bewegung, eine missverständliche Bemerkung. Die Richter hätten ernsthaft prüfen müssen, ob diese Worte nicht auch eine völlig andere, nicht-sexualisierte Deutung zulassen. Das taten sie nicht.
Die Situation wurde noch rätselhafter durch die Aussage der Freundin. Sie sollte das Telefonat als Zeugin bestätigen. Doch sie konnte sich an die entscheidenden, belastenden Formulierungen, die ihre Freundin gehört haben wollte, seltsamerweise nicht erinnern. Ein massiver Widerspruch, den das Landgericht einfach überging, anstatt ihn aufzuklären. Es hatte damit eine Erklärung, die den Angeklagten entlasten könnte, ohne Begründung vom Tisch gewischt.
Was bedeutet die Zurückverweisung für den angeklagten Therapeuten?
Das Urteil des Bayerischen Obersten Landesgerichts ist kein Freispruch. Die Richter haben nicht entschieden, dass der Physiotherapeut unschuldig ist. Sie haben etwas anderes festgestellt: Seine Schuld wurde nicht nach den Regeln der Kunst bewiesen. Die lückenhafte Beweiswürdigung macht das Urteil des Landgerichts rechtswidrig. Es muss aufgehoben werden.
Der Fall geht nun zurück an den Start. Eine andere Kammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth muss den gesamten Prozess neu aufrollen. Alle Zeugen müssen erneut gehört werden. Alle Beweismittel müssen auf den Tisch. Dieses Mal muss das Gericht die vom Obergericht angemahnten Hausaufgaben erledigen: Es muss die verschiedenen Aussagen der Patientin vergleichen, die Gedächtnisprotokolle analysieren und die Widersprüche rund um das Telefonat aufklären. Am Ende steht wieder die Frage: Reichen die Beweise aus, um den Angeklagten ohne jeden vernünftigen Zweifel zu verurteilen? Der Ausgang ist wieder völlig offen.
Die Urteilslogik
Eine Verurteilung im Strafrecht erfordert stets eine lückenlose Beweiswürdigung, die selbst in komplexen „Aussage gegen Aussage“-Konstellationen keine Zweifel zulässt.
- Rigorose Prüfung der Zeugenaussage: Gerichte müssen Zeugenaussagen, insbesondere in „Aussage gegen Aussage“-Fällen, umfassend auf ihre Entstehungsgeschichte und Konstanz prüfen und alle entlastenden wie belastenden Umstände lückenlos würdigen, um eine schlüssige Überzeugungsbildung zu erreichen.
- Urteilsaufhebung bei Mängeln: Weist eine gerichtliche Beweiswürdigung wesentliche Lücken auf, ignoriert sie entscheidende Beweismittel oder klärt Widersprüche nicht auf, kann die Verurteilung keinen Bestand haben und das höhere Gericht hebt das Urteil auf, um den Fall neu verhandeln zu lassen.
Solche strengen Anforderungen schützen die Rechtsstaatlichkeit und stellen sicher, dass Urteile auf einer unanfechtbaren Tatsachengrundlage beruhen.
Benötigen Sie Hilfe?
Wurde die Beweiswürdigung in Ihrem Strafverfahren als unzureichend beanstandet? Kontaktieren Sie uns für eine professionelle Ersteinschätzung Ihrer Lage.
Experten Kommentar
Zweimal verurteilt – und trotzdem ist noch nichts entschieden. Das Bayerische Oberste Landesgericht hat hier deutlich gemacht: Bei „Aussage gegen Aussage“ muss ein Gericht jeden Aspekt der Zeugenaussage beleuchten und auch entlastende Punkte würdigen. Es reicht nicht, Lücken in der Beweiskette zu übergehen. Wer eine Verurteilung anfechten will, findet hier eine klare Orientierung, welche hohen Anforderungen an eine ordentliche Beweiswürdigung gestellt werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Beweismittel stärken meine Position bei ‚Aussage gegen Aussage‘?
Um Ihre Position in einem „Aussage gegen Aussage“-Fall zu stärken, sind nicht nur direkte Zeugen, sondern insbesondere die Dokumentation der Entstehungsgeschichte und Konstanz Ihrer eigenen Aussage sowie frühzeitig gesicherte schriftliche oder auditive Belege entscheidend. Halten Sie Ihre Erlebnisse unverzüglich fest und teilen Sie diese vertrauenswürdigen Personen mit. So schaffen Sie Vertrauen in Ihre Glaubwürdigkeit.
Juristen nennen die detaillierte Überprüfung von Aussagen die „Beweiswürdigung“. Steht nur Wort gegen Wort, müssen Gerichte die verschiedenen Darstellungen regelrecht sezieren. Dabei legen sie großen Wert auf die Entstehungsgeschichte der Aussage: Wann und wem wurde das Geschehene zum ersten Mal erzählt? Ebenso wichtig sind die innere Stimmigkeit, Detailtiefe und Konstanz Ihrer Schilderung über die Zeit hinweg. Eine über längere Zeit konsistente Darstellung, die sich in wesentlichen Punkten nicht verändert, stärkt die Glaubwürdigkeit erheblich. Jede Ungereimtheit oder Abweichung muss schlüssig erklärt werden.
Darüber hinaus sind objektive Indizien und Zeugenaussagen Dritter von großer Bedeutung. Hierzu zählen Chatverläufe, E-Mails oder Anrufprotokolle, die den Kontext untermauern. Auch wenn diese Personen den eigentlichen Vorfall nicht direkt beobachtet haben, können sie bestätigen, dass Sie ihnen unmittelbar danach davon berichtet haben oder in welcher emotionalen Verfassung Sie sich befanden. Solche begleitenden Informationen schaffen ein umfassendes Bild, das über die reine Aussage hinausgeht und Ihre Version der Ereignisse substanziell stützt.
Denken Sie an ein Protokoll bei einem wichtigen Meeting: Ohne eine schriftliche Fixierung verlassen Sie sich auf Erinnerungen, die trügen können. Mit einem präzisen Protokoll haben Sie einen belastbaren Beleg, den alle nachvollziehen und überprüfen können.
Erstellen Sie noch heute ein detailliertes Gedächtnisprotokoll zu den entscheidenden Ereignissen. Notieren Sie darin Datum, Uhrzeit und alle beteiligten Personen. Suchen Sie zudem alle frühen Kommunikationsnachweise wie Nachrichten oder Anruflisten zusammen. Besprechen Sie Ihre Erlebnisse auch mit einer vertrauten Person, die später bezeugen kann, wann und wie Sie sich ihr anvertraut haben.
Wie schütze ich meine Rechte, wenn ich einer falschen Anschuldigung gegenüberstehe?
Wenn Sie mit einer falschen Anschuldigung konfrontiert sind, ist es entscheidend, Ihre Rechte nicht nur durch das Betonen Ihrer Unschuld zu schützen. Aktivität zählt: Zeigen Sie methodische Mängel der Gegenseite auf, dokumentieren Sie jede entlastende Information präzise und bringen Sie diese frühzeitig anwaltlich ein. Dies ist der Weg, um in einem solchen Fall Ihre Glaubwürdigkeit zu stärken und Ihre Position zu sichern.
Der erste und wichtigste Schritt ist der umgehende Gang zu einem Fachanwalt. Spezialisten für Strafrecht navigieren Sie sicher durch das Verfahren und erkennen frühzeitig juristische Fallstricke. Sprechen Sie nicht mit der Polizei oder anderen Behörden, bevor Sie juristischen Beistand haben. Jede unbedachte Äußerung kann sonst später gegen Sie verwendet werden.
Danach beginnt die aktive Beweissicherung. Hier sammeln Sie proaktiv alle entlastenden Informationen; denken Sie an Alibis, Nachrichtenverläufe oder Zeugen, die Ihre Version stützen können. Analysieren Sie die Anschuldigung genau. Suchen Sie nach inkonsistenten Details, Lücken oder fehlender Konstanz in der Geschichte des Anklägers. Prüfen Sie alternative Deutungsmöglichkeiten belastender Aussagen; der Satz „Mir ist ein Fehler passiert“ kann schließlich vieles bedeuten und ist selten ein klares Geständnis. Ganz entscheidend ist die sofortige und detaillierte Dokumentation. Erstellen Sie umgehend ein minutiöses Gedächtnisprotokoll aus Ihrer Sicht, sichern Sie alle digitalen Kommunikationsspuren und informieren Sie vertrauenswürdige Personen über die Situation. Ihre frühen Schilderungen können später als Zeugen für die Entstehungsgeschichte Ihrer Verteidigung dienen.
Ein passender Vergleich ist ein undichtes Fundament. Ein Haus kann nur auf einem soliden Fundament stehen. Wenn die Anschuldigung Lücken, Widersprüche oder ungenaue Formulierungen aufweist, wird ihr Fundament schwach. Ihre Aufgabe als Beschuldigter ist es, diese Schwachstellen zu finden und offenzulegen, um das Gebäude der Anklage ins Wanken zu bringen und Ihre Unschuld zu untermauern.
Zögern Sie niemals. Kontaktieren Sie noch heute einen Fachanwalt für Strafrecht. Beginnen Sie parallel umgehend, ein minutiöses Gedächtnisprotokoll aller relevanten Ereignisse und Kommunikationen aus Ihrer Perspektive zu erstellen. Jedes Detail, jede frühe Aufzeichnung kann entscheidend sein.
Was tun bei einer lückenhaften Beweiswürdigung in meinem Urteil?
Wenn Ihr Urteil eine lückenhafte Beweiswürdigung aufweist, bedeutet das einen schwerwiegenden Verfahrensfehler. Juristen nennen das einen Mangel, der die Rechtswidrigkeit des gesamten Urteils begründet. Oft führt dies zur Aufhebung durch ein höheres Gericht und zur Zurückverweisung Ihres Falles für eine komplette Neuverhandlung. Das bietet Ihnen eine echte Chance zur Korrektur.
Die Regel lautet: Ein Gericht muss alle Argumente und Beweise auf den Tisch legen und sorgfältig abwägen. Doch manchmal übersehen Richter entscheidende Punkte. Vielleicht wurden Ihre frühzeitigen Gedächtnisprotokolle ignoriert, wichtige Zeugenaussagen Dritter nicht beachtet oder gravierende Widersprüche in der gegnerischen Darstellung nicht aufgeklärt. Genau diese Art von „Leerstellen“ oder mangelhafter Konstanzprüfung macht ein Urteil angreifbar.
Deshalb ist es jetzt entscheidend, dass Sie Ihr Urteil unverzüglich von einem auf Rechtsmittel spezialisierten Anwalt überprüfen lassen. Dieser Experte wird gezielt nach solchen Fehlern suchen. Er prüft, ob wirklich alle Beweismittel – auch die, die für Sie sprechen – erwähnt, analysiert und in die Gesamtbewertung einbezogen wurden. Eine lückenhafte Begründung ist ein Geschenk für die nächste Instanz.
Ein passender Vergleich ist der eines Architekten, der ein Haus plant. Wenn er entscheidende Statikberechnungen weglässt, mag das Haus erstmal stehen, aber es ist instabil und kann jederzeit einstürzen. Genauso wackelig ist ein Urteil ohne vollständige Beweiswürdigung: Die logische Grundlage fehlt.
Verlieren Sie keine Zeit! Kontaktieren Sie innerhalb weniger Tage nach Erhalt Ihres Urteils einen Fachanwalt für Strafrecht, der Erfahrung mit Berufungen oder Revisionen hat. Nur so können die knappen Fristen für Rechtsmittel gewahrt und die Mängel in der Beweiswürdigung von einer höheren Instanz überprüft werden.
Kann ein Trauma die Glaubwürdigkeit meiner Aussage beeinflussen?
Ein Trauma kann die Erinnerungsfähigkeit tatsächlich stark beeinflussen und so zu scheinbaren Widersprüchen in Ihrer Aussage führen. Doch Gerichte müssen die psychologischen Auswirkungen eines Traumas bei der Glaubwürdigkeitsprüfung angemessen berücksichtigen. Wichtig ist, dass Gedächtnislücken oder Veränderungen nicht vorschnell als Unglaubwürdigkeit gedeutet werden, solange sie plausibel erklärt werden können. Offenheit gegenüber dem Anwalt ist hier Gold wert.
Juristen wissen: Traumatische Erlebnisse können die Art und Weise verändern, wie unser Gehirn Informationen speichert und abruft. Manche Details verschwimmen, andere werden überdeutlich erinnert. Das ist keine Absicht, sondern eine natürliche Reaktion des menschlichen Gehirns auf extremen Stress. Für die juristische Bewertung bedeutet dies, dass ein Gericht nicht nur auf die reine Konstanz einer Aussage achtet. Es muss auch die Entstehungsgeschichte der Aussage beleuchten und alle Umstände würdigen, die für oder gegen die Glaubhaftigkeit sprechen.
Dazu gehört die Möglichkeit, dass Trauma-bedingte Erinnerungslücken oder -verschiebungen plausibel erklärt werden. Die Regel lautet: Jede Ungereimtheit im Prozess muss aufgeklärt oder zumindest stichhaltig begründet werden. Wenn ein Trauma die Ursache für vermeintliche Widersprüche ist, muss dies entsprechend im Verfahren thematisiert und idealerweise durch Sachverständige untermauert werden.
Denken Sie an die Situation, wenn Sie unter Schock stehen: Ihre Wahrnehmung ist verzerrt, bestimmte Details gehen verloren, während andere sich ins Gedächtnis brennen. Es ist wie ein Puzzle, bei dem einige Teile fehlen oder verrutscht sind, aber das Gesamtbild dennoch erkennbar bleibt. Das Gericht muss das Puzzle als Ganzes betrachten und verstehen, warum einzelne Teile vielleicht ungenau erscheinen.
Besprechen Sie alle Erinnerungslücken oder Unsicherheiten, die mit einem möglichen Trauma zusammenhängen, umgehend und offen mit Ihrem Rechtsbeistand. Ihr Anwalt kann dann entscheiden, ob ein psychologisches Gutachten sinnvoll ist, um die Auswirkungen des Traumas fundiert darzulegen. Verschweigen Sie nichts – Ehrlichkeit ist in diesem Kontext Ihre größte Stärke.
Wie sichere ich frühzeitig Beweise für meine Version der Ereignisse?
Um frühzeitig Beweise für Ihre Version der Ereignisse zu sichern, sollten Sie unverzüglich detaillierte Gedächtnisprotokolle erstellen. Kritisch ist auch, alle relevanten digitalen Kommunikationsspuren zu sichern und vertrauenswürdige Personen als Zeugen der Entstehungsgeschichte Ihrer Aussage hinzuzuziehen. Dieser umfassende Ansatz stärkt Ihre Glaubwürdigkeit erheblich und ist entscheidend für die gerichtliche Bewertung.
Juristen nennen das Beweissicherung. Es geht darum, Ihre Erinnerungen und Beobachtungen so früh und nachvollziehbar wie möglich zu fixieren. Erinnerungen verblassen schnell. Erzählungen können sich unter Druck verändern. Daher ist die frühe Dokumentation absolut entscheidend. Gerichte legen größten Wert auf die „Entstehungsgeschichte der Aussage“: Wann haben Sie wem was zuerst erzählt? Ihre Glaubwürdigkeit hängt maßgeblich davon ab, wie konsistent Ihre Schilderungen über die Zeit bleiben.
Dokumentieren Sie sofort alle Fakten. Schreiben Sie exakte Daten, Uhrzeiten, Orte und beteiligte Personen auf. Fügen Sie präzise Zitate und Ihre damaligen Gefühle hinzu. Diese detailreichen Protokolle gelten als besonders authentisch. Gleichzeitig sollten Sie alle digitalen Spuren sichern. Denken Sie an E-Mails, SMS, Chatverläufe oder Anruflisten. Solche objektiven Anhaltspunkte können Ihre Geschichte untermauern. Auch das Einbeziehen von Vertrauenspersonen ist klug. Teilen Sie ihnen den Vorfall umgehend mit. Deren Zeugenaussage kann später belegen, dass Ihre Geschichte von Anfang an konsistent war.
Ein passender Vergleich ist das Führen eines Tagebuchs nach einem wichtigen Ereignis. Je frischer die Erinnerung, desto genauer sind die Details. Wer später versucht, sich nur auf sein Gedächtnis zu verlassen, riskiert Lücken und Ungenauigkeiten. Ein Tagebuch ist ein unbestechlicher Zeuge.
Nehmen Sie sich sofort Zeit. Verfassen Sie ein umfassendes, chronologisches Gedächtnisprotokoll aller relevanten Begebenheiten. Sichern Sie zudem alle digitalen Nachrichten. Sprechen Sie abschließend mit einer vertrauten Person über die Situation. Diese Schritte sind jetzt entscheidend.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Beweiswürdigung
Beweiswürdigung ist der Prozess, in dem Richter alle im Verfahren vorgebrachten Beweismittel sorgfältig prüfen, bewerten und ihre Schlussfolgerungen begründen. Das Gericht muss nachvollziehbar darlegen, welche Fakten es als erwiesen ansieht und warum. Diese detaillierte Analyse stellt sicher, dass Urteile auf einer überzeugenden und transparenten Grundlage basieren.
Beispiel: Die lückenhafte Beweiswürdigung des Landgerichts, das wichtige Gedächtnisprotokolle ignorierte, führte zur Aufhebung des Urteils durch die höhere Instanz.
Entstehungsgeschichte der Aussage
Juristen beleuchten die Entstehungsgeschichte der Aussage, also die Umstände, unter denen eine Schilderung eines Zeugen erstmals gemacht wurde, um deren Glaubhaftigkeit zu beurteilen. Dieses Vorgehen hilft Richtern, mögliche Einflüsse oder Veränderungen über die Zeit hinweg zu erkennen und die ursprüngliche Glaubwürdigkeit zu bewerten.
Beispiel: Die fehlende Untersuchung der Entstehungsgeschichte der Aussage der Patientin, insbesondere wann und wem sie die Vorfälle zuerst erzählte, war ein kritischer Mangel im Urteil.
Gesamtwürdigung
In einem Strafprozess bedeutet eine Gesamtwürdigung, dass ein Gericht alle relevanten Beweise und Umstände nicht isoliert, sondern in ihrem wechselseitigen Zusammenspiel betrachtet. Damit soll sichergestellt werden, dass keine entlastenden oder belastenden Details übersehen werden und ein umfassendes Bild zur Wahrheitsfindung entsteht.
Beispiel: Das Landgericht versäumte es, eine lückenlose Gesamtwürdigung aller Indizien vorzunehmen, insbesondere der widersprüchlichen Aussage der Freundin zum Telefonat.
Konstanzprüfung
Die Konstanzprüfung ist eine Methode, bei der Gerichte verschiedene Versionen einer Zeugenaussage über die Zeit hinweg vergleichen. Diese Analyse hilft festzustellen, ob eine Aussage in ihren Kernpunkten gleichbleibend ist oder ob sich wesentliche Details ändern, was für die Glaubwürdigkeit einer Person entscheidend sein kann.
Beispiel: Ohne eine gründliche Konstanzprüfung der mehrfach erzählten Geschichte konnte das Gericht die Zuverlässigkeit der Erinnerungen der Patientin nicht angemessen bewerten.
Überzeugungsgrundsatz
Der Überzeugungsgrundsatz verlangt von Richtern in einem Strafverfahren, dass sie die volle Überzeugung von der Schuld des Angeklagten erlangen, um ihn zu verurteilen. Dieses Prinzip schützt den Angeklagten vor Verurteilungen bei bloßem Verdacht und stellt sicher, dass jeder vernünftige Zweifel ausgeräumt ist.
Beispiel: Das Bayerische Oberste Landesgericht sah den Überzeugungsgrundsatz als nicht erfüllt an, da die lückenhafte Beweiswürdigung des Landgerichts nicht jeden vernünftigen Zweifel ausräumen konnte.
Zurückverweisung
Eine Zurückverweisung ist die Anweisung eines höheren Gerichts an eine untergeordnete Instanz, einen Fall aufgrund schwerwiegender Fehler erneut zu verhandeln. Das passiert, wenn das höhere Gericht einen Rechtsfehler im ursprünglichen Urteil feststellt, der eine neue Beweisaufnahme oder Sachprüfung erforderlich macht.
Beispiel: Aufgrund der lückenhaften Beweiswürdigung kam es zur Zurückverweisung des Falls an eine andere Kammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth für eine komplette Neuverhandlung.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ (In dubio pro reo)
Ein Angeklagter darf nur verurteilt werden, wenn das Gericht von seiner Schuld restlos überzeugt ist und keinerlei vernünftige Zweifel mehr bestehen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Gerichte durften den Therapeuten nicht verurteilen, wenn ihre Überzeugung nur auf einem „Bauchgefühl“ beruhte und nicht jeden Zweifel an seiner Schuld ausschloss. - Anforderungen an die Beweiswürdigung in „Aussage gegen Aussage“-Fällen (§ 261 StPO)
Gerade in Fällen, in denen nur die Aussage des Opfers gegen das Bestreiten des Angeklagten steht, muss das Gericht die Belastungszeugen besonders umfassend und kritisch auf Glaubwürdigkeit und Konstanz ihrer Aussage prüfen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht hätte die verschiedenen Aussagen der Patientin detailliert vergleichen und alle Umstände, die ihre Glaubwürdigkeit beeinflussen könnten, akribisch untersuchen müssen. - Begründungspflicht des Urteils (§ 267 Abs. 1 S. 3, Abs. 5 S. 1 StPO)
Jedes Strafurteil muss schriftlich und nachvollziehbar begründen, welche Tatsachen als bewiesen gelten und wie das Gericht zu seiner Überzeugung gelangt ist.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht hat im Urteil nicht dokumentiert, wie es frühere Aussagen oder bestimmte entlastende Aspekte bewertet hat, wodurch die Urteilsbegründung lückenhaft und unverständlich wurde. - Revisionsgerichtliche Überprüfung von Rechtsfehlern (§ 337 StPO)
Ein Revisionsgericht überprüft nicht erneut die Fakten eines Falles, sondern kontrolliert ausschließlich, ob das untere Gericht bei seiner Entscheidung Rechtsfehler gemacht hat.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Bayerische Oberste Landesgericht hat das Urteil aufgehoben, weil das Landgericht Fehler bei der Beweiswürdigung und der Begründung gemacht hat, ohne dabei selbst die Schuldfrage neu zu entscheiden.
Das vorliegende Urteil
BayObLG – Az.: 203 StRR 332/25 – Beschluss vom 18.08.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.