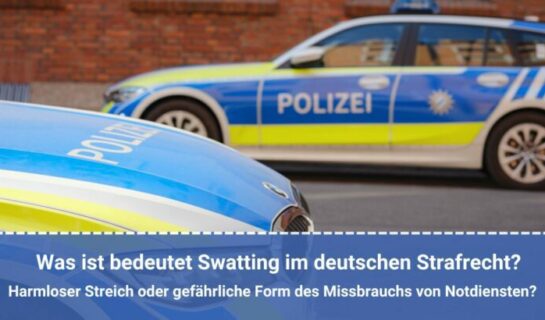Übersicht
- Das Wichtigste: Kurz & knapp
- BGH zieht klare Grenze: Wann ein geplanter Raub straflos bleibt
- Die überraschende Wende: Warum der Bundesgerichtshof „Nein“ zum Versuch sagte
- Das „Jetzt-geht’s-los“-Prinzip: Der wichtigste Moment im Strafrecht
- Ein Fehler der Vorinstanz: Wie das Landgericht die Fakten falsch bewertete
- Was das Urteil für die Praxis bedeutet: Die feine Linie im Alltag
- Konkrete Handlungsempfehlungen: Wie Sie sich in rechtlichen Grauzonen verhalten
- Die rechtliche Tragweite: Ein Urteil, das die Grundpfeiler des Strafrechts festigt
- Häufig gestellte Fragen zur Grenze zwischen Vorbereitung und Versuch einer Straftat
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Die Täter waren doch am Tatort und bewaffnet. Warum ist das noch kein strafbarer Versuch?
- Hätte sich die Lage geändert, wenn der Käufer ausgestiegen wäre, bevor die Täter den Plan aufgaben?
- Spielt es rechtlich eine Rolle, dass die Täter wegen der zweiten Person unsicher wurden und telefoniert haben?
- Heißt das, ich kann jede Straftat planen und komme straffrei davon, solange ich sie nicht beginne?
- Wenn ich mich bedroht fühle, bin ich also rechtlich besser geschützt, wenn ich in meinem Auto oder Haus bleibe?
- Warum schützt das Gesetz Täter, die zögern, anstatt die böse Absicht von Anfang an zu bestrafen?
- Schutzschild Rechtsstaat: Die Grenze zwischen böser Absicht und strafbarer Tat

Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Der BGH hob eine Verurteilung wegen versuchten Raubes auf, da die Grenze zwischen strafloser Vorbereitung und strafbarem Versuch nicht überschritten war.
- Strafbarer Versuch (§ 22 StGB) erfordert „unmittelbares Ansetzen“ („Jetzt-geht’s-los“): einen festen Tatentschluss und Handlungen, die direkt zur Tat führen.
- Die Täter zögerten und berieten sich; ihr Entschluss war nicht final, wodurch die subjektive Schwelle zum Versuch fehlte.
- Auch objektiv lag kein Versuch vor, da die Opfer geschützt im Auto blieben, die „Gefahrenzone“ nicht betreten wurde und ein wesentlicher Zwischenakt fehlte.
- Das Urteil stärkt den Schutz vor „Gesinnungsstrafrecht“ und verdeutlicht, dass ein rechtzeitiger Abbruch oder Zögern Straflosigkeit bedeuten kann.
- Hinweis: Die Verabredung zu einem Verbrechen kann gem. § 30 StGB auch ohne Versuchsbeginn bereits eigenständig strafbar sein.
Quelle: Bundesgerichtshof, Beschluss vom 4. März 2025, Az. 3 StR 551/24
BGH zieht klare Grenze: Wann ein geplanter Raub straflos bleibt
Der Plan der beiden Männer, nennen wir sie Herr M. und Herr E., war ebenso perfide wie vermeintlich einfach. Um schnell an Geld zu kommen, inserierten sie auf der bekannten Online-Plattform „mobile.de“ einen BMW mit angeblichem Motorschaden. Der Preis von 15.000 Euro war verlockend genug, um einen Interessenten anzulocken. Doch das Auto war nur ein Köder. Der wahre Plan war, dem Käufer bei der Übergabe das mitgebrachte Bargeld gewaltsam abzunehmen. Alles schien nach Plan zu laufen. Sie mieteten ein Fluchtfahrzeug und fuhren zum vereinbarten, abgelegenen Treffpunkt. Herr E. stieg aus, bewaffnet mit einer Dose Pfefferspray, und postierte sich lauernd auf der Straße, während Herr M. im Auto wartete und die Umgebung sicherte. Sie waren bereit.
Doch dann kam die unerwartete Wendung. Ein Auto fuhr vor, doch darin saßen zwei Personen. Der Plan geriet ins Wanken. Hektisch griffen die Täter zum Telefon, um sich zu beraten. Wer von den beiden war der Käufer? Hatten sie das Geld überhaupt dabei? Der Interessent hatte keinen Anhänger mitgebracht, was untypisch für jemanden ist, der ein defektes Auto abholen will. Die Unsicherheit wuchs, die Entschlossenheit schwand. Noch während die beiden potenziellen Opfer im sicheren Inneren ihres Wagens saßen, trafen Herr M. und Herr E. eine Entscheidung: Sie brachen die Aktion ab. Die Frage, die später die höchsten deutschen Strafrichter beschäftigen sollte: War dieser fast durchgeführte Raubüberfall bereits eine strafbare Tat? Oder war es nur eine straflose Vorbereitung, weil die entscheidende Grenze noch nicht überschritten war?
Die überraschende Wende: Warum der Bundesgerichtshof „Nein“ zum Versuch sagte
Für das Landgericht (LG) Koblenz war der Fall klar. Es verurteilte Herrn M. und Herrn E. wegen versuchten besonders schweren Raubes in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung zu Freiheitsstrafen von jeweils über fünf Jahren. Die Richter der Vorinstanz sahen in dem planvollen Vorgehen, dem Auflauern am Tatort und der Bewaffnung bereits den Beginn einer strafbaren Handlung. Für sie war das kriminelle Vorhaben weit über eine bloße Idee hinausgegangen.
Doch die Angeklagten legten gegen dieses Urteil Revision ein und brachten den Fall vor den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Eine Revision ist keine neue Tatsachenverhandlung; der BGH prüft vielmehr, ob das vorinstanzliche Gericht das Recht korrekt angewendet hat. Und in seinem Beschluss vom 4. März 2025 (Az. 3 StR 551/24) kamen die obersten Strafrichter zu einem völlig anderen Ergebnis: Sie hoben die Verurteilung wegen versuchten Raubes auf. Der Grund ist eine der fundamentalsten und für Laien oft schwer greifbaren Unterscheidungen im deutschen Strafrecht: die zwischen der straflosen Vorbereitung und dem strafbaren Versuch einer Tat.
Das ist vergleichbar mit dem Plan, ein großes Fest zu veranstalten. Solange Sie nur darüber nachdenken, Gästelisten schreiben und Rezepte sammeln, ist das Ihre Privatsache. Niemand kann Sie dafür belangen. Erst wenn Sie die Einladungen verschicken und damit eine Erwartungshaltung bei anderen schaffen, treten Sie in eine neue Phase ein. Im Strafrecht ist diese Schwelle ungleich wichtiger, denn sie entscheidet über Freiheit oder eine langjährige Haftstrafe.
Das „Jetzt-geht’s-los“-Prinzip: Der wichtigste Moment im Strafrecht
Das Herzstück der BGH-Entscheidung ist die Auslegung des § 22 des Strafgesetzbuches (StGB). Dort heißt es schlicht: „Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt.“ Der entscheidende Begriff hier ist „unmittelbar ansetzt“. Über Jahrzehnte hat der BGH diesen unklaren Begriff mit Leben gefüllt und eine berühmte Formel entwickelt, die auch hier den Ausschlag gab: die „Jetzt-geht’s-los“-Formel.
Nach dieser ständigen Rechtsprechung liegt ein strafbarer Versuch nur dann vor, wenn zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
- Subjektiv: Der Täter muss innerlich die Schwelle zum „Jetzt geht’s los“ überschritten haben. Er darf nicht mehr zögern oder die Tat von weiteren Bedingungen abhängig machen. Sein Entschluss zur Tatausführung muss endgültig sein.
- Objektiv: Der Täter muss Handlungen vornehmen, die nach seinem Tatplan ohne wesentliche Zwischenschritte direkt in die eigentliche Straftat münden. Es muss eine unmittelbare Gefahr für das Opfer oder das geschützte Rechtsgut entstehen.
Der BGH prüfte den Fall von Herrn M. und Herrn E. akribisch anhand dieser beiden Kriterien und kam zu dem Schluss, dass beide nicht erfüllt waren.
Die subjektive Schwelle: Der fehlende „letzte Willensimpuls“
Der vielleicht wichtigste Punkt in der Argumentation des BGH war die innere Verfassung der Täter. Als die unerwartete Situation mit zwei Personen im Auto eintrat, waren Herr M. und Herr E. nicht mehr fest entschlossen, den Raub durchzuziehen. Im Gegenteil: Ihr Telefongespräch diente nicht der Koordination des Angriffs, sondern der Krisenberatung. Sie wogen das Risiko ab und waren unsicher.
Der BGH formulierte es juristisch präzise: Es hätte noch „eines weiteren Willensimpulses bedurft“, um von der Phase des Zögerns und Überlegens in die Phase des Handelns überzugehen. Diese innere Hürde war aber noch nicht genommen. Die Täter standen bildlich gesprochen auf dem Sprungbrett, hatten sich aber noch nicht zum Sprung entschieden. Ihr Tatentschluss war nicht mehr unbedingt, sondern hing von einer neuen Bewertung der Lage ab.
Für Herrn M. und Herrn E. war genau diese dokumentierte Unsicherheit ihr entscheidender Vorteil vor Gericht. Sie zeigte, dass sie die mentale „Point of no Return“-Linie noch nicht überschritten hatten. Das Gericht stellte klar: Solange Täter aufgrund unvorhergesehener Umstände noch in Beratungen über das Ob und Wie der Tat begriffen sind, haben sie die subjektive Schwelle zum Versuch nicht überschritten. Das bedeutet für Sie in einer vergleichbaren Lage, dass Zögern und die Neubewertung einer gefährlichen Situation rechtlich einen fundamentalen Unterschied machen können.
Die objektive Hürde: Die „Gefahrenzone“ war noch nicht betreten
Neben dem inneren Zögern fehlte es laut BGH auch an der äußeren, objektiven Voraussetzung für einen Versuch. Die beiden potenziellen Opfer befanden sich die ganze Zeit über in ihrem Auto. Sie waren damit in einem geschützten Raum und noch nicht in der unmittelbaren Einflusssphäre der Täter. Die Richter bezeichneten dies als fehlenden Eintritt in die „Gefahrenzone“.
Stellen Sie sich vor, ein Einbrecher will in Ihr Haus. Solange er auf der anderen Straßenseite steht und das Haus beobachtet, ist das Vorbereitung. Selbst wenn er Ihr Grundstück betritt, kann dies noch als Vorbereitungshandlung gewertet werden. Der Versuch beginnt in der Regel erst dann, wenn er das Fenster aufhebelt oder die Tür aufbricht – wenn er also die schützende Hülle Ihres Hauses unmittelbar angreift. Das Auto der Opfer war in diesem Fall wie die verschlossene Haustür.
Der BGH stellte fest, dass noch ein „wesentlicher Zwischenakt“ fehlte: Das Opfer hätte aus dem Auto aussteigen müssen, um dem mit Pfefferspray bewaffneten Herrn E. schutzlos ausgeliefert zu sein. Da die Täter ihren Plan aber bereits aufgaben, bevor dieser Zwischenakt überhaupt stattfinden konnte, war die Gefahr für die Opfer nie konkret und unmittelbar. Für die beiden Männer im Auto war die Karosserie ihres Fahrzeugs somit nicht nur ein physischer, sondern auch ein juristischer Schutzschild, der eine Verurteilung wegen Versuchs verhinderte.
Ein Fehler der Vorinstanz: Wie das Landgericht die Fakten falsch bewertete
Der BGH kritisierte in seinem Beschluss auch die Arbeitsweise des Landgerichts Koblenz. Die Vorinstanz hatte die zeitliche Abfolge der Ereignisse nicht präzise genug gewürdigt. Das Landgericht war der Meinung, dass der Plan bereits so weit fortgeschritten war, dass das Erscheinen am Tatort als Versuchsbeginn ausreichte. Es übersah dabei aber den entscheidenden Punkt: Die Täter hatten ihren Entschluss bereits wieder aufgegeben, bevor die Opfer überhaupt in eine konkrete Gefährdungslage geraten konnten.
Dieser Fall zeigt, wie entscheidend die genaue Rekonstruktion eines Tathergangs ist. Die juristische Bewertung kann von Sekunden abhängen. Es ist wie bei einer Schiedsrichterentscheidung im Sport, die per Videobeweis überprüft wird: War der Ball schon über der Linie? Fand das Foul noch im Strafraum statt? Im Fall von Herrn M. und Herrn E. war die entscheidende Frage: Wann genau wurde der Plan aufgegeben? Die Antwort des BGH war klar: Er wurde aufgegeben, bevor die Tat in ihr Versuchsstadium eintreten konnte.
Die Entscheidung des Landgerichts, die Angeklagten zu verurteilen, war somit ein Rechtsfehler, der vom BGH korrigiert werden musste. Das bedeutet für Sie als Bürger, dass selbst bei einem offensichtlich kriminellen Vorhaben die Gerichte sehr genau hinschauen müssen, wie weit die Umsetzung tatsächlich gediehen war, bevor eine Strafbarkeit angenommen werden kann.
Was das Urteil für die Praxis bedeutet: Die feine Linie im Alltag
Auch wenn der Fall extrem wirkt, berührt die Entscheidung des BGH Grundfragen, die auch in alltäglicheren Konfliktsituationen eine Rolle spielen können. Die klare Abgrenzung zwischen Absicht und Tat ist ein Schutz für jeden Bürger.
Für die Strafverfolgung: Eine höhere Hürde für Ankläger
Für Staatsanwaltschaften bedeutet dieses Urteil eine Mahnung zur Sorgfalt. Es reicht nicht aus, einen Tatplan und Vorbereitungshandlungen nachzuweisen. Die Anklage muss, insbesondere bei abgebrochenen Taten, stichhaltig belegen können, dass die Täter den Punkt der Beratung und des Zögerns bereits hinter sich gelassen hatten. Beweismittel wie Telefonverbindungsdaten, die im Fall von Herrn M. und Herrn E. auf eine andauernde Beratung hindeuteten, können eine Anklage wegen Versuchs zu Fall bringen. Es muss bewiesen werden, dass der Täter nicht nur konnte und wollte, sondern auch den finalen Schritt zum „Jetzt geht’s los“ gemacht hat.
Die Unterscheidung zwischen Vorbereitung und Versuch ist nicht nur bei Raubüberfällen relevant. Sie spielt in vielen Bereichen eine Rolle:
- Heftiger Streit: Wer in einem Wutanfall droht, „Ich bring dich um!“, begeht in der Regel keine Straftat. Greift die Person aber zu einem Messer und geht auf den anderen zu, ist die Schwelle zum versuchten Tötungsdelikt schnell überschritten.
- Betrug im Internet: Hier ist die Abgrenzung besonders wichtig. Während der versuchte Betrug tatsächlich erst beginnt, wenn der Täter zur Täuschung eines Opfers ansetzt (z.B. indem er eine gefälschte Zahlungsaufforderung versendet), hat der Gesetzgeber hier eine Ausnahme geschaffen: Bestimmte Vorbereitungshandlungen für einen Computerbetrug sind bereits als eigenständige Tat strafbar. Nach § 263a Abs. 3 StGB macht sich bereits strafbar, wer sich spezielle Software (z.B. Phishing-Programme) oder fremde Passwörter und Daten beschafft, um einen solchen Betrug zu begehen. Das reine Erstellen einer leeren Webseite mag noch straflos sein, das Beschaffen der „digitalen Tatwerkzeuge“ ist es jedoch nicht.
- Versicherungsbetrug: Der Gedanke, das eigene Auto anzuzünden, um die Versicherungssumme zu kassieren, ist straflos. Auch der Kauf von Benzin kann noch als mehrdeutige Vorbereitung gelten. Der Versuch beginnt jedoch, wenn man das Benzin über das Auto schüttet und das Feuerzeug zückt.
- Häusliche Gewalt: Das Belauern des Ex-Partners vor dessen Wohnung ist eine Sache. Der Versuch, die Tür einzutreten, um in die Wohnung zu gelangen, ist eine andere. Hier wird die schützende Hülle der Wohnung angegriffen und die Gefahr unmittelbar.
- Ladendiebstahl: Das Einstecken einer Ware in die Jackentasche wird von Gerichten in der Regel bereits als vollendeter Diebstahl gewertet, da der Täter die Ware in seine persönliche „Gewahrsamssphäre“ gebracht hat. Hier ist die Schwelle also sehr niedrig.
Wichtig zu wissen: Vorbereitung kann ausnahmsweise strafbar sein
Grundsätzlich ist die Vorbereitung einer Straftat straflos. Es gibt jedoch wichtige Ausnahmen.
- Verabredung zum Verbrechen (§ 30 StGB): Für besonders schwere Delikte (Verbrechen wie Raub oder Mord) ist bereits die ernsthafte Absprache zur gemeinsamen Tatbegehung strafbar. Im Fall von Herrn M. und Herrn E. hätte also eine Verurteilung wegen Verabredung zum Verbrechen geprüft werden können.
- Vorbereitung von Cyberkriminalität (z.B. § 263a Abs. 3 StGB): Eine praxisrelevantere Ausnahme betrifft den Computerbetrug. Wie oben im Beispiel erwähnt, macht sich bereits strafbar, wer sich Passwörter, fremde Daten oder spezielle Computerprogramme verschafft, um damit einen Betrug zu begehen. Der Gesetzgeber will hier frühzeitig eingreifen und bestraft daher schon das „Sich-Verschaffen der digitalen Tatwerkzeuge“.
Die Strafbarkeit kann also bereits weit vor dem eigentlichen „Jetzt-geht’s-los“-Moment beginnen.
Konkrete Handlungsempfehlungen: Wie Sie sich in rechtlichen Grauzonen verhalten
Aus dem Urteil lassen sich keine direkten Tipps für die Begehung von Straftaten ableiten, aber es schärft das Bewusstsein für rechtliche Prinzipien, die im Leben wichtig sind. Das Wissen um die Grenze zwischen Absicht und Tat kann helfen, Konflikte zu deeskalieren und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Wenn Sie sich jemals in einer Situation befinden, in der Emotionen hochkochen oder eine schlechte Idee im Raum steht, sollten Sie bedenken, dass ein Rückzieher nicht nur moralisch richtig, sondern auch rechtlich entscheidend sein kann. Das aktive Verwerfen eines Plans, bevor eine reale Gefahr für andere entsteht, ist der sicherste Weg, eine strafrechtliche Verfolgung zu verhindern.
In vielen Situationen ist es klug, bewusst einen „wesentlichen Zwischenakt“ einzubauen, bevor eine unüberlegte Handlung erfolgt. Das kann bedeuten, bei einem Streit den Raum zu verlassen, anstatt die Konfrontation zu suchen. Dieser Abstand schafft nicht nur Zeit zum Nachdenken, sondern verändert auch objektiv die rechtliche Situation. Sie sollten auch wissen, dass die objektive Umgebung eine Rolle spielt. Eine verschlossene Tür oder die Distanz zu einer anderen Person sind effektive Schutzmechanismen. Wer sich bedroht fühlt, sollte diese Barrieren nutzen, denn sie haben auch eine rechtliche Schutzfunktion. Das Urteil lehrt uns vor allem, dass das Strafrecht nicht primär die böse Absicht, sondern die konkrete gefährliche Handlung bestraft.
Für Zeugen bedeutet dies, dass das Zögern oder die Beratung von potenziellen Tätern ein kritisches Zeitfenster sein kann. In diesem Moment ist die Tat noch nicht endgültig beschlossen, und ein Eingreifen oder das Rufen der Polizei kann die Tat noch verhindern, bevor sie überhaupt das Versuchsstadium erreicht.
Die rechtliche Tragweite: Ein Urteil, das die Grundpfeiler des Strafrechts festigt
Der Beschluss des BGH mag auf den ersten Blick wie ein juristischer Freispruch für zwei Kriminelle wirken. Doch in Wahrheit ist er eine wichtige Stärkung der fundamentalen Prinzipien unseres Rechtsstaates. Indem der BGH die Hürde für die Annahme eines strafbaren Versuchs hochhält, schützt er die Bürger vor einer Ausuferung des Strafrechts in den Bereich der reinen Gedanken und Absichten.
Die Entscheidung ist eine Bekräftigung des Grundsatzes „Keine Strafe ohne Gesetz“ (nulla poena sine lege). Dieser verlangt, dass die Grenzen des strafbaren Verhaltens klar und vorhersehbar definiert sind. Die Bestrafung einer Handlung, die noch keine unmittelbare Rechtsgutsgefährdung darstellt und auf einem noch nicht endgültigen Willensentschluss beruht, wäre mit diesem Prinzip unvereinbar.
Das Rechtssystem fungiert hier wie ein Schiedsrichter mit einem sehr genauen Regelwerk. Es bestraft nicht die Planung eines Fouls, sondern erst das Foul selbst. Dieses Urteil sorgt dafür, dass die Linie, die übertreten werden muss, nicht willkürlich verschoben wird. Es verhindert eine Art „Gesinnungsstrafrecht“, bei dem schon der böse Wille bestraft wird. Damit sichert der BGH einen entscheidenden Freiheitsraum für alle Bürger und stellt sicher, dass die Macht des Staates, zu bestrafen, erst dann eingreift, wenn es wirklich notwendig ist: wenn aus einer bösen Absicht eine konkrete Gefahr für die Gemeinschaft wird.
Häufig gestellte Fragen zur Grenze zwischen Vorbereitung und Versuch einer Straftat
Hier finden Sie vertiefende Antworten auf die wichtigsten Fragen, die sich aus der BGH-Entscheidung zur Abgrenzung von strafloser Planung und strafbarem Handeln ergeben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Täter waren doch am Tatort und bewaffnet. Warum ist das noch kein strafbarer Versuch?
Allein die Anwesenheit am Tatort, selbst mit einer Waffe, reicht für eine Verurteilung wegen Versuchs nicht aus. Das deutsche Strafrecht verlangt nach der „Jetzt-geht’s-los“-Formel zwei Dinge gleichzeitig: Zum einen müssen die Täter innerlich fest entschlossen sein, die Tat ohne weiteres Zögern durchzuziehen. Zum anderen müssen sie eine Handlung vornehmen, die ohne wesentliche Zwischenschritte direkt zur Tat führt und eine unmittelbare Gefahr für das Opfer schafft. Im beschriebenen Fall scheiterte es an beidem. Die Täter waren noch am Beraten und Zögern, und das Opfer befand sich noch sicher in seinem Auto, also außerhalb der direkten Gefahrenzone.
Hätte sich die Lage geändert, wenn der Käufer ausgestiegen wäre, bevor die Täter den Plan aufgaben?
Ja, das hätte die Situation juristisch fundamental verändert. Das Aussteigen aus dem Auto wäre der entscheidende „wesentliche Zwischenakt“ gewesen, der laut Bundesgerichtshof noch fehlte. In dem Moment, in dem das Opfer sein geschütztes Fahrzeug verlassen hätte, wäre es in die unmittelbare Einflusssphäre und die „Gefahrenzone“ des bewaffneten Täters getreten. Hätten die Täter zu diesem Zeitpunkt noch ihren ursprünglichen Plan verfolgt, wäre die Schwelle zum strafbaren Versuch mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten gewesen, da dann eine konkrete und unmittelbare Gefahr für das Opfer bestanden hätte.
Spielt es rechtlich eine Rolle, dass die Täter wegen der zweiten Person unsicher wurden und telefoniert haben?
Ja, diese Unsicherheit und die daraus folgende Beratung waren sogar der entscheidende Punkt für das Gericht. Das Telefongespräch diente nicht der Koordination des Angriffs, sondern war eine „Krisenberatung“. Es belegte, dass die Täter innerlich nicht mehr fest entschlossen waren, sondern die Lage neu bewerteten. Die Richter sagten, es hätte „eines weiteren Willensimpulses bedurft“, um tatsächlich loszuschlagen. Da dieser letzte, finale Entschluss aber fehlte und die Tat von der Neubewertung abhing, war die subjektive Schwelle zum „Jetzt geht’s los“ noch nicht überschritten.
Heißt das, ich kann jede Straftat planen und komme straffrei davon, solange ich sie nicht beginne?
Im Grundsatz ja, die reine Planung und Vorbereitung der meisten Straftaten ist in Deutschland nicht strafbar. Es gibt jedoch eine wichtige Ausnahme, die im Artikel erwähnt wird: die Verabredung zu einem Verbrechen. Verbrechen sind Taten, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind, wie zum Beispiel Raub oder Mord. Wenn sich zwei oder mehr Personen ernsthaft absprechen, ein solches Verbrechen gemeinsam zu begehen, machen sie sich bereits nach <a href=“https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__30.html“>§ 30 des Strafgesetzbuches</a> strafbar. Die Täter im geschilderten Fall hätten also möglicherweise wegen der Verabredung zum Raub verurteilt werden können, auch wenn der Versuch selbst verneint wurde.
Wenn ich mich bedroht fühle, bin ich also rechtlich besser geschützt, wenn ich in meinem Auto oder Haus bleibe?
Ja, diese Entscheidung kann nicht nur Ihre Sicherheit erhöhen, sondern hat auch eine wichtige rechtliche Schutzfunktion. Wie der Fall zeigt, stellt eine verschlossene Auto- oder Haustür eine Barriere dar, die das Gericht als „geschützten Raum“ anerkennt. Solange sich ein potenzielles Opfer in diesem Raum befindet, ist es für einen Angreifer schwer, eine unmittelbare Gefahr zu schaffen, die für den Beginn eines strafbaren Versuchs nötig ist. Die Karosserie Ihres Autos oder die Wände Ihrer Wohnung sind somit nicht nur ein physischer, sondern auch ein juristischer Schutzschild, der die Schwelle für eine Strafbarkeit des Angreifers erhöht.
Warum schützt das Gesetz Täter, die zögern, anstatt die böse Absicht von Anfang an zu bestrafen?
Das mag zunächst paradox klingen, ist aber ein Kernprinzip unseres Rechtsstaates. Das Strafrecht soll nicht die böse Absicht oder eine verwerfliche Gesinnung bestrafen, sondern nur die konkrete Handlung, die eine reale Gefahr für andere darstellt. Würde man schon die reine Planung oder das Zögern vor einer Tat bestrafen, würde man die Grenzen des Strafrechts gefährlich ausweiten. Diese hohe Hürde schützt alle Bürger davor, für bloße Gedanken oder unüberlegte Äußerungen belangt zu werden. Der Staat greift erst dann mit seiner härtesten Maßnahme – der Strafe – ein, wenn aus einer bösen Idee eine greifbare Gefahr für die Rechtsgüter anderer, wie deren Leben, Gesundheit oder Eigentum, wird.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Schutzschild Rechtsstaat: Die Grenze zwischen böser Absicht und strafbarer Tat
Dieses Urteil ist mehr als ein Freispruch im Einzelfall; es ist eine justizielle Leitplanke. Der BGH schützt den entscheidenden Freiheitsraum, indem er bestätigt: Strafbar ist nicht die böse Absicht, sondern erst die Handlung, die eine unmittelbare und konkrete Gefahr schafft. Das Zögern vor dem letzten Schritt oder eine physische Barriere wie eine Autotür sind somit keine juristischen Spitzfindigkeiten, sondern fundamentale Schutzmechanismen, die für jeden Bürger gelten.
Die zentrale Botschaft lautet daher: Das Strafrecht bestraft die gefährliche Tat, nicht den bloßen Gedanken. Diese hohe Hürde bewahrt uns alle vor einem ausufernden Gesinnungsstrafrecht und festigt das Prinzip, dass erst die tatsächliche Gefährdung anderer das harte Eingreifen des Staates rechtfertigt.